HVV-Kooperationsvertrag Auszug Anlagen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
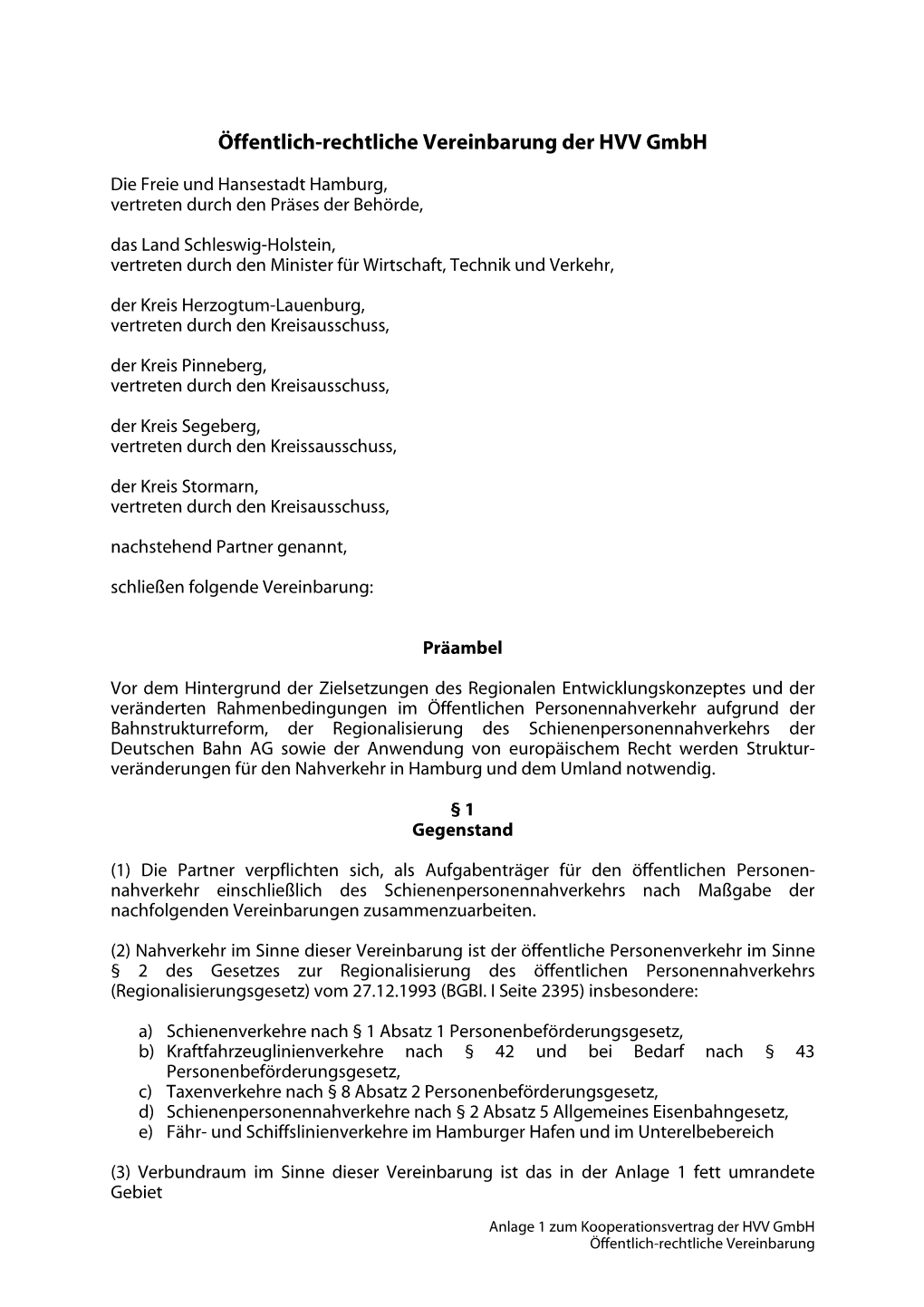
Load more
Recommended publications
-

Anlage C 2.1 Auftraggeberin AKN Eisenbahn Gmbh Rudolf-Diesel
Anlage C 2.1 Auftraggeberin AKN Eisenbahn GmbH Rudolf-Diesel-Straße 2 24568 Kaltenkirchen Auftragnehmerin EGL - Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH Unzerstr. 1-3 22767 Hamburg Bearbeiter/-in Dipl. Ing. Sabine Schwirzer Dipl. Ing. Andrea Keller B. Eng. Katharina Höchst gez. Planstellungsunterlage vom 21.12.2016 Deckblatt, vollständig überarbeitete Fassung 10.10. 2019 Landschaftspflegerischer Begleitplan Elektrifizierung der AKN - Strecke A1 S21 Eidelstedt - Kaltenkirchen 2. Planfeststellungsabschnitt: Landesgrenze FHH/SH - Kaltenkirchen I Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 1.1 Planungsanlass und Aufgabenstellung 1 1.2 Rechtliche Grundlagen 2 1.3 Kurzdarstellung des Vorhabens 3 1.4 Lage, Abgrenzung und Charakter des Untersuchungsgebiets 7 1.5 Planerische Rahmenbedingungen 10 1.5.1 Übergeordnete Planungen 10 1.5.2 Schutzgebiete 10 1.5.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die durch andere Vorhaben planungsrechtlich gesichert sind 12 2. Methodik zur Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans 13 3. Bestandsaufnahme und Bewertung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 14 3.1 Naturhaushaltsfunktion Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume 14 3.1.1 Bestand Biotoptypen/ Pflanzen 14 3.1.2 Bestand Tiere 23 3.1.2.1 Vögel 23 3.1.2.2 Fledermäuse 31 3.1.2.3 Haselmaus 34 3.1.2.4 Weitere Tierarten 34 3.1.3 Vorkommen von artenschutzrechtlich besonders zu berücksich- tigenden Tierarten 36 3.1.4 Zusammenfassende Bewertung Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume 37 3.2 Naturhaushaltsfunktion Boden 39 3.2.1 Bestand 39 3.2.2 Bewertung 40 3.3 Naturhaushaltsfunktion Wasser 41 3.3.1 Bestand 41 3.3.2 Bewertung 43 3.4 Naturhaushaltsfunktion Klima/ Luft 44 3.4.1 Bestand 44 3.4.2 Bewertung 45 3.5 Landschaftsbild 46 Landschaftspflegerischer Begleitplan 10.10.2019 Elektrifizierung der AKN - Strecke A1 S21 Eidelstedt - Kaltenkirchen 2. -
Neumünster – Eidelstedt (– Hamburg Hbf)
Neumünster – Eidelstedt (– Hamburg Hbf) Fahrplan der Linie A1 Gültig vom 15.12.2019 – 12.12.2020 Mit Hinweis auf bereits gut ausgelastete Züge und Einsatz barrierefreier (Lint-)Züge www.akn.de Allgemeine Hinweise Tarifhinweise und Fahrkarten • alle Züge 2. Klasse Auf den Linien der AKN gelten der Gemeinschaftstarif des Hamburger • alle Züge fahren ohne Begleitpersonal Verkehrsverbundes (HVV-Tarif) und der Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif) • Gruppenreisen ab 6 Personen bitte 14 Tage vorher am Telefon innerhalb ihrer jeweiligen Bestimmungen. unter 04191 933933 oder in unseren Servicestellen in Quickborn und Kaltenkirchen abstimmen. Der schnelle Weg zur richtigen Fahrkarte: • Die Anschlusszeiten an die Regionalbahn in Neumünster können • der einfachste Weg führt an unseren Automaten über die Taste innerhalb des Jahres und an Feiertagen variieren. „Zielhaltestelle suchen...“ • folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm • der Automat zeigt Ihnen nun die Fahrkarten an, die zu Ihrer Fahrtroute Barrierefreiheit passen Auf der AKN-Linie A1 fahren VTA- und Lint-Fahrzeuge. Nur die Lint sind • Sie brauchen nur noch zwischen einfacher Fahrt, Tageskarte usw. barrierefrei zugänglich. Damit mobilitätseingeschränkte Personen ihre Fahrt zu wählen besser planen können, haben wir den Einsatz der Lint-Fahrzeuge in diesem Mehr Details finden Sie in unserem Flyer „In nur vier Schritten zu Fahrplan mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet. Ihrem Fahrschein“. Hinweise zur Fahrradmitnahme Service- und Verkaufsstellen Wir nehmen Ihr Fahrrad gern und kostenfrei in unseren Zügen mit. • AKN-Servicestelle Kaltenkirchen Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise: am Bahnhof, 24568 Kaltenkirchen, Tel.: 04191 933112 • Die Fahrradmitnahme ist im Bereich des HVV Montag - Freitag zwischen Beratung und Verkauf 6 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr nicht zulässig. -

Gültigkeit Von RIT / Railly-Tickets in Privatbahnen
Gültigkeit von RIT / Railly-Tickets in Privatbahnen Gültigkeit von RIT / Rail&Fly in Nahverkehrszügen innerhalb Name und Adresse Bezeichnung einbezogene Verkehre / Linien Deutschlands in der genannten Zuggattung (Zugbez.) d. EVU Essen - Bochum - Witten - Hagen - Letmathe - ABELLIO Rail NRW GmbH ABR ja Iserlohn/Finnentrop - Siegen Postfach 0123 Essen - Bochum - Witten - Hagen ja 58001 Hagen Gelsenkirchen - Wanne-Eickel - Bochum ja ABELLIO Rail Mitteldeutschland GmbH ABR Kassel - Bitterfeld ja Magdeburger Str 51 Naumburg(Saale) - Erfurt ja 06112 Halle/Saale Leipzig - Erfurt ja Leinefelde - Dessau ja Leipzig - Saalfeld(Saale) ja Halle - Eisenach ja Naumburg(saale) - Saalfel(Saale) ja Heilbad Heiligenstadt - Nordhausen ja Erfurt - Dessau ja Nordhausen - Eilenburg ja agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG ag agilis Mitte: Galgenbergstraße 2a (E-Netz Regensburg) ja 93053 Regensburg Neumarkt-Regensburg-Plattling ja Ulm-Ingolstadt-Regensburg-Landshut ja agilis Nord: (D-Netz Oberfranken) ja Bad Rodach-Lichtenfels-Bayreuth-Weiden ja Bad Steben-Hof-Müncherg-Kulmbach ja Hof-Selb Stadt ja Ebern-Bamberg-Ebermannstadt ja Bamberg-Lichtenfels ja Bayreuth-Weidenberg ja Bayreuth-Makrredwitz ja Markredwitz-Hof ja Hamburg-Eidelstedt - Neumünster, Elmshorn - Ulzburg AKN Eisenbahn AG AKN nein Süd, Norderstedt-Mitte - Ulzburg Süd Rudolf-Diesel-Straße 2 24568 Kaltenkirchen alex ALX ja Vogtlandbahn GmbH Ohmstraße 2 08946 Neumarkt Arriva Openbaar Vervoer N.V. DB ARR NL Leer(Ostfriesland) - Weener (- Groningen) ja Afdeling Trein Groningen en Fryslân Postbus 626 -

Akn Eisenbahn Ag Kaltenkirchen Lagebericht Für Das Geschäftsjahr 2017
Anlage 4 Seite 1 AKN EISENBAHN AG KALTENKIRCHEN LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017 A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen 1. Allgemeines Die AKN Eisenbahn AG (AKN) besteht seit 1883 als Eisenbahnunternehmen und ist seit 1884 im Gebiet von Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg als Eisenbahnverkehrs- und -infrastrukturunternehmen tätig. Sie betreibt in dieser Region öffentlichen Personennahverkehr mit Schienenfahrzeugen und nimmt dabei die Aufgaben eines integrierten Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmens wahr. Die AKN erbringt Eisenbahnverkehrsleistungen auf ihrem eigenen Streckennetz in Schleswig-Holstein und Hamburg und im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Norderstedt (VGN) auf dem Streckennetz der VGN. Die Infrastruktur der AKN wird in Eigenregie betrieben und unterhalten. Zusätzlich übernimmt die AKN Leistungen zur Instandhaltung der Infrastruktur Dritter, insbesondere für die Verkehrsgesellschaft Norderstedt (VGN) auf der Strecke Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd, und für verschiedene Regional- und Hafenbahnen in Schleswig-Holstein. 2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 1 Die Wirtschaftskonjunktur hat sich auch im Jahr 2017 positiv entwickelt. Gegenüber dem Tiefstand im Jahr 2016 sind die Rohölpreise im Jahr 2017 deutlich gestiegen. Das Zinsniveau hat sich jedoch kaum verändert; der kurzfristige Interbankenzinssatz „EURIBOR liegt immer noch im leicht negativen Bereich. Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im Jahr 2017 mit einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,2 % gerechnet. Für das Folgejahr wird eine Wachstumsrate von 2,4 % angenommen. Die privaten Konsumausgaben sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Sie sind in 2017 um 2,0 % gestiegen. Maßgeblich dafür sind der weiterhin hohe Grad der Beschäftigung mit 1,5 % mehr Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr und ein weiterer Anstieg der Löhne und Gehälter. 1 Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018, Deutsc e Wirtschaft 2017 Anlage 4 Seite 2 3. -

Angaben Für Das Streckenbuch AKN - Regionalbereich 1
AKN Eisenbahn GmbH Betrieb Infrastruktur Rudolf-Diesel-Straße 2 24568 Kaltenkirchen Angaben für das Streckenbuch AKN - Regionalbereich 1 gültig ab 13. Dezember 2020 - 2 - Streckenverzeichnis AKN-Regionalbereich 1 Teil A 1 Strecke Hmb-Eidelstedt - Neumünster Teil A 2 Strecke Norderstedt - Ulzburg Süd Teil A 3 Strecke Elmshorn - Henstedt-Ulzburg Zuständigkeiten der Fahrdienstleiter Stellwerk "Kf", Kaltenkirchen Den Fahrdienstleitern Stellwerk "Kf", Kaltenkirchen sind Fdl-Zuständigkeitsbereiche (örtlich zuständiger Fahrdienstleiter "özF") zugeordnet. Der AKN-Bereichsübersicht sind die özF-Bereiche mit den jeweiligen Rufnummern zu entnehmen. Stand: 10/2020 - 3 - Stand: 10/2020 - 4 - Hinweise für die Benutzung Die “Angaben für das Streckenbuch“ umfassen Regelungen zu den ferngesteuerten Strecken: Hmb-Eidelstedt - Neumünster (A1) Norderstedt - Ulzburg Süd (A2) Elmshorn - Henstedt-Ulzburg (A3) 1) Der örtlich zuständige Fdl auf Stw “Kf“, Kaltenkirchen ist vom Triebfahrzeugführer auch in der Funktion als Betriebszentrale gemäß der Richtlinie 408.21-27 anzusprechen. 2) Den Regeln sind Stichworte zugeordnet. Die Angaben gelten für beide Fahrtrichtungen, wenn ihre Gültigkeit nicht durch einen Pfeil oder im Text nur auf eine Fahrtrichtung beschränkt ist. 3) Bedeutung der Symbole: ☼ Blinklicht- oder Lichtzeichenanlage, auch mit Halbschranken. Der Pfeil nach unten zeigt die Richtung an, die durch die Kilometrierung der Strecke gekennzeichnet ist. Der Pfeil nach oben zeigt die "Gegenrichtung" an. Angaben, die für das Gegengleis gelten, sind in Winkel < > gesetzt. 4) Für die Verfügbarkeit von Hemmschuhen sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) eigenverantwortlich. 5) Bezeichnung der Fahrdienstleiter a) Wenn eine Regelung für mehrere Fahrdienstleiterbereiche gilt, wird im Text die Bezeichnung "özF" oder auch "örtlich zuständiger Fahrdienstleiter" verwendet. b) Wenn eine Regelung nur für einen bestimmten Fahrdienstleiter (özF) gilt, wir der Fahrdienstleiter konkret benannt und dabei die Bezeichnung z. -

Annual Report 2009
Annual Report 2009 Drive Schleswig- Holsteinein Heide Büsum NeumünsterNeumünster Mecklenburg-Vorpommern Cuxhaven LübeckLübeck Kaltenkirchen WismarWismar Bad Oldesloe Hamburg Hamburg-Altona Schwerin Hamburg Central Waren (Müritz) Stade Bremervörde Hamburg-Harburg Hagenow Parchim Buxtehude NeustrelitzNeustrelitz Bremen Buchholz Lüneburg Ludwigslust Mirow Tostedt otenburgotenburg (Wümme) JoaJoachimsthalchimsthal Uelzen Brandenburg Wittenberge cchsenhsen EbeEberswalderswalde Berlin- Rathenow Berlin Celle Stendal Spandau Werneuchen Berlin-Lichtenberg Berlin- Fürstenwalde HanHanoverover Wannsee Berlin Brandenburg Central (Spree) Bad Saarow KönigsKönigs KlinikumKlinikum Frankfurt (Oder) Wuster-Wuster- hausen Elze BeesBeeskowko JüterbogJüterbog Sachsen-Anhalt Cottbus Forst Northeim Hoyerswerda Göttingen Niesky EiEichenbergchenberg Kassel Central Kassel-Wilhelmshöhe Görlitz EschwegeEschwege BischofswerdaBischofswerda Sachsen Zittau EisenaEisenachch Bebra LauterbachLauterbach FuldaFulda Thüringen Neuhof Bad Steben Bad Rodach Hof Helm- brechts Coburg Bus depots Hessen Ebern Selb-Stadt Lichten- fels Weiden- berg Marktredwitz Bayreuth Workshops Bamberg Kirchenlaibach Forchheim Ebermannstadt Weiden Bayern Neumarktkt RegensburgRegensburg StraubingStraubing Plattling Ingolstadt Passau Donauwörth Landshut Ulm Munich LocA BEnEX PARticiPAtions – tions An oVERViEw As of 1 jAnuARy 2010 ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (www.odeg.info) BenEX GmbH 50 percent, PEG Prignitzer Eisenbahn GmbH 50 percent Light rail public transport operator on routes in Berlin, Brandenburg, -

Mobilitätsprogramm 2013 – Aktualisierung Der Datenblätter, Stand 2019
Aktualisierung der Datenblätter 2019 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Pressestelle Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg Mobilitätsprogramm 2013 – Aktualisierung der Datenblätter, Stand 2019 Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 1. Ausbau und Deckel A 7 (nördlich Elbtunnel) 2. Ausbau A 7 (südlich Elbtunnel) 3. Neubau A 26 (Landesgrenze bis A 7) 4. Neubau A 26-Ost (A 7 bis A 1)/ Hafenpassage Hamburg 34. Ausbau A1 (AD HH-Südost – AS HH-Harburg) 5. Verlegung Wilhelmsburger Reichsstraße 6. Eisenbahnknoten Hamburg 29. Hauptbahnhof und Umfeld 30. Verlagerung des Fernbahnhofs Hamburg Altona 7. Hafenbahn 8. Bundesverkehrswegeplan 2030 9. Erhaltungsmanagement Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 10. Programm zur Verbesserung des Bussystems 11. U4 Jungfernstieg – HafenCity – Elbbrücken 31. Neubau der U-Bahn-Linie U5 (einschl. einer Schnellbahnanbindung des Hamburger Westens 32. U1 – Haltestelle Oldenfelde 33. U4- Verlängerung zur Horner Geest 12. S-Bahn-Haltepunkt Elbbrücken 13. S4 Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe 14. S21 Eidelstedt – Kaltenkirchen (Elektrifizierung AKN) 15. S-Bahn-Haltepunkt Ottensen 16. Barrierefreier Ausbau von Schnellbahn-Haltestellen 17. P+R (Park-and-Ride) 18. B+R (Bike-and-Ride) Mobilität effizient managen und vernetzen 19. Verkehrsmanagement 20. Programm der lautesten Straßen -– Teil: Senkung der zulässigen Geschwindigkeiten in besonders betroffenen Abschnitten 21. CarSharing 35. RideSharing 22. Mobilitätsmanagement 23. Mobilitäts-Service-Punkte (switchh) 24. Parkraumbewirtschaftung Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und Lebensräume gestalten 25. Elektromobilität 26. Bündnis für den Radverkehr/ Radverkehrsstrategie 27. StadtRAD 28. Fußgängerverkehr Seite 1 Mobilitätsprogramm 2013 – Aktualisierung der Datenblätter, Stand 2019 Handlungsfeld Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 1 Maßnahme Ausbau und Deckel A 7 (nördlich Elbtunnel) Bestandteil VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004 HEP Hafenentwicklungsplan 2012 LRP Luftreinhalteplan, 2. -

Wo Gilt Meine Fahrvergünstigung?
Wo gilt meine Fahrvergünstigung? Allgemeine Regelungen Einzelvereinbarungen Fahrvergünstigungsgemeinschaft Deutscher Eisenbahnen (FDE) Regionale Busgesellschaften Deutsche Bahn AG / SIEMENS Deutsche Bahn AG / Ralf Braum Deutsche Bahn AG / Andreas Varnhorn Deutsche Bahn AG / Uwe Miethe zurück zur Fahrvergünstigungsgemeinschaft Allgemeine Regelungen Einzelvereinbarungen Regionale Busgesellschaften Übersichtskarte Deutscher Eisenbahnen (FDE) Anleitung zur interaktiven eBroschüre Bitte beachten Sie, dass Sie die interaktive Navigation auf mobilen Endgeräten nur mit dem kostenlosen Adobe Reader verwenden können. Alternativ finden Sie ein klassisches Inhaltsverzeichnis auf den folgenden Seiten. Betreiber herausfinden. Hilfreich hierfür sind die Verbindugssuchen auf 1 www.bahn.de und im DB Navigator Klicken Sie auf der Übersichtskarte auf Seite 3 auf das gewünschte 2 Bundesland. Zur Einsicht der Details klicken Sie auf das gewünschte 3 Verkehrsunternehmen. Welche Fahrscheinarten werden anerkannt? 4 Sie finden die Hinweise zur Anerkennung Ihrer Fahrvergünstigung unter dem Verkehrsunternehmen und/oder in der Kopfzeile. Navigieren Sie über die Fußzeile zur Übersichtskarte und zu anderen 5 Themen. zurück zur Fahrvergünstigungsgemeinschaft Allgemeine Regelungen Einzelvereinbarungen Regionale Busgesellschaften Übersichtskarte Deutscher Eisenbahnen (FDE) Navigation Interaktive Navigation Klicken Sie auf das gewünschte Bundesland – anschließend auf das Verkehrsunternehmen. Schleswig- Holstein Mecklenburg- Vorpommern Niedersachsen Brandenburg Hamburg -

Umdruck 16/4273 Des Landes Schleswig-Holstein
Ministerium für Wissenschaft, Schleswig-Holsteinischer Landtag Wirtschaft und Verkehr Umdruck 16/4273 des Landes Schleswig-Holstein Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | Minister Postfach 71 28 | 24171 Kiel An den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages Herrn Hans-Jörn Arp, MdL Landeshaus 24105 Kiel Kiel, 12. Mai 2009 Sehr geehrter Herr Vorsitzender, der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in seiner 109. Sitzung am 27. März 2009 den Bericht zum LNVP (Drs. 16/2449) behandelt und an den Wirtschaftsausschuss zur abschließenden Beratung überwiesen. Selbstverständlich stelle ich Ihnen die Stellungnahmen der Beteiligten zur Verfügung und freue mich auf eine konstruktive Debatte mit Ihnen. Mit freundlichen Grüßen gez. Dr. Jörn Biel Anlage: Stellungnahmen nach Beteiligten Seite 1 von 1 Postfach 71 28 24171 Kiel Düsternbrooker Weg 94 24105 Kiel Telefon (0431) 988-4400 Telefax (0431) 988-4815 e-mail: [email protected] internet: www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de Stellungnahmen nach Beteiligten LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH Landesweiter Nahverkehrsplan 2008 - 2012 Stellungnahmen nach Beteiligten Stand: 15.04.2009 AKN Eisenbahn AG (Nr. 1) Stellungnahmen Einwender ID Kommentare des Vorhabenträgers Zum Abschnitt 5.1 Angebotsmaßnahmen, Variante "Fortschreibung", 81 Nachfragezahlen: Nachfrageveränderung 2005 - 2025, Seiten 76+77: Im Gegensatz zur AKN / SHB gehen die LVS und der Gutachter, der die Studie zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf den ÖPNV In Anlehnung an unsere Argumentation zu den für das Jahr 2012 erstellt hat, nicht davon aus, dass die in der Vergangenheit zweifellos genannten Nachfrage-Erwartungswerten halten wir die für das Jahr 2025 erzielten Zuwächse sich langfristig in dem gleichen Maße fortsetzen. genannte Nachfrageerwartung für die Linien A 1, A 2 und A 3 für zu Der Nachfragerückgang auf der Linie 137 Hamburg - Kaltenkirchen - gering angesetzt. -

30. Beteiligung Des Landes an Der AKN Eisenbahn AG
238 30. Beteiligung des Landes an der AKN Eisenbahn AG Weder Steigerungen der Betriebs- und Verkehrsleistungen noch interne Rationalisierungsmaßnahmen konnten den deutlichen Anstieg der Defizite der landeseigenen AKN verhindern. Ursäch- lich sind neben einer seit 1999 vereinbarten erheblichen Verrin- gerung der Anteile an den Einnahmen innerhalb des Hamburger Verkehrsverbundes insbesondere Finanzierungskosten, Ab- schreibungen, Altlasten sowie insgesamt hohe Fixkosten. Seit der ebenfalls ab 1999 zuungunsten des Landes veränderten Aufteilung der Verluste auf die Eigentümer übernimmt das Land rd. 75 % dieser Defizite. Um den damit verbundenen von Jahr zu Jahr noch steigenden hohen finanziellen Belastungen entgegenzuwirken, sind grund- legende strukturelle Veränderungen erforderlich. Auf der Grund- lage entsprechender Vorüberlegungen des Verkehrsministe- riums ist in Abstimmung mit dem Mitgesellschafter, der Freien und Hansestadt Hamburg, umgehend eine finanziell tragbare Lösung zu entwickeln und zu verwirklichen. 30.1 Vorbemerkung Die AKN Eisenbahn AG (AKN) ist seit 1884 in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig. Sie befindet sich seit Jahrzehnten im überwiegenden Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) (50 %) und des Landes (49,89 %) und stellt eines der finanziell bedeutendsten Unterneh- men im Beteiligungsbestand Schleswig-Holsteins dar. Tochterunterneh- men sind die Schleswig-Holstein Bahn GmbH (SHB), die Güterkraftverkehr Hamburg-Holstein GmbH sowie zu gleichen Teilen gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn AG die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (NBE). Der LRH hat die Betätigung des Landes Schleswig-Holstein als Gesell- schafter bei der AKN und deren Tochtergesellschaften unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze gem. § 92 LHO geprüft. Im Hinblick auf die hohen an die AKN geflossenen und weiterhin fließen- den Betriebs- und Investitionszuschüsse für den Schienenpersonennah- verkehr (SPNV) und für Güterverkehre hat der LRH zusätzlich eine Zu- wendungsprüfung nach § 91 LHO durchgeführt. -

DL PFB Elektrifizierung
Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Planfeststellungsbehörde Planfeststellungsbeschluss für die Elektrifizierung der AKN-Strecke A1/S21 zwischen Eidelstedt und der Landesgrenze der Freien und Hansestadt Hamburg zu Schleswig-Holstein (Planfeststellungsabschnitt 1) 1. November 2018 Az: 150.1409-500 Seite 2 des Planfeststellungsbeschlusses vom 1. November 2018 für die Elektrifizierung der AKN-Strecke A1/S21 Seite 3 des Planfeststellungsbeschlusses vom 1. November 2018 für die Elektrifizierung der AKN-Strecke A1/S21 INHALTSVERZEICHNIS ENTSCHEIDUNG 8 Planfeststellung 8 Festgestellte Unterlagen 8 Erläuterungsbericht 8 Pläne 9 Verzeichnisse 11 Schalltechnische Untersuchung 12 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 12 Weitere Unterlagen 13 Pläne, Gutachten etc. 13 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 13 Artenschutzrechtliche Prüfung 13 Biotoptypen-Übersichtskartierung 14 NEBENBESTIMMUNGEN 14 Baubeginn 14 Stichspeisung der Oberleitungsanlage / Installation eines Rückleiterseiles ohne Isolierstöße14 Freihaltung der Oberleitungsmasten und Verstärkerleitungen – Entschädigungspflicht 15 Bodenmanagementkonzept 15 Gewässerschutz 15 Baum- und Gehölzschutz 15 Baustelleneinrichtung 16 Baustelleneinrichtungsfläche auf den Flurstücken 6477 und 6537 16 Sondernutzung öffentlicher Wege 16 Gefahren durch die Bauausführung 16 Brandschutz 17 Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 17 Anwendung von Verwaltungsvorschriften des Eisenbahn-Bundesamtes 19 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen 19 Räumliche Begrenzung der dauerhaften -

Das Barrierefreiheitsprogramm Der AKN Eisenbahn Gmbh
Das Barrierefreiheitsprogramm der AKN Eisenbahn GmbH September 2018, 1. Aktualisierung Juli 2021 www.akn.de 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ................................................................................................................................ 4 Inklusion funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit. .............................................................................................. 4 Warum ist Barrierefreiheit so wichtig? ................................................................................................................... 4 Der demographische Wandel ................................................................................................................................... 4 Was bedeutet das für die AKN? ................................................................................................................................ 5 2. Die mobilitätseingeschränkten Gruppen ......................................................................... 5 3. Die Kund:innenkommunikation ......................................................................................... 5 3.1 Der persönliche Kontakt............................................................................................................................... 5 • Das Servicetelefon ............................................................................................................................................................................... 5 • Notruf- und Infosäulen .....................................................................................................................................................................