Belastung Und Reintegration
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
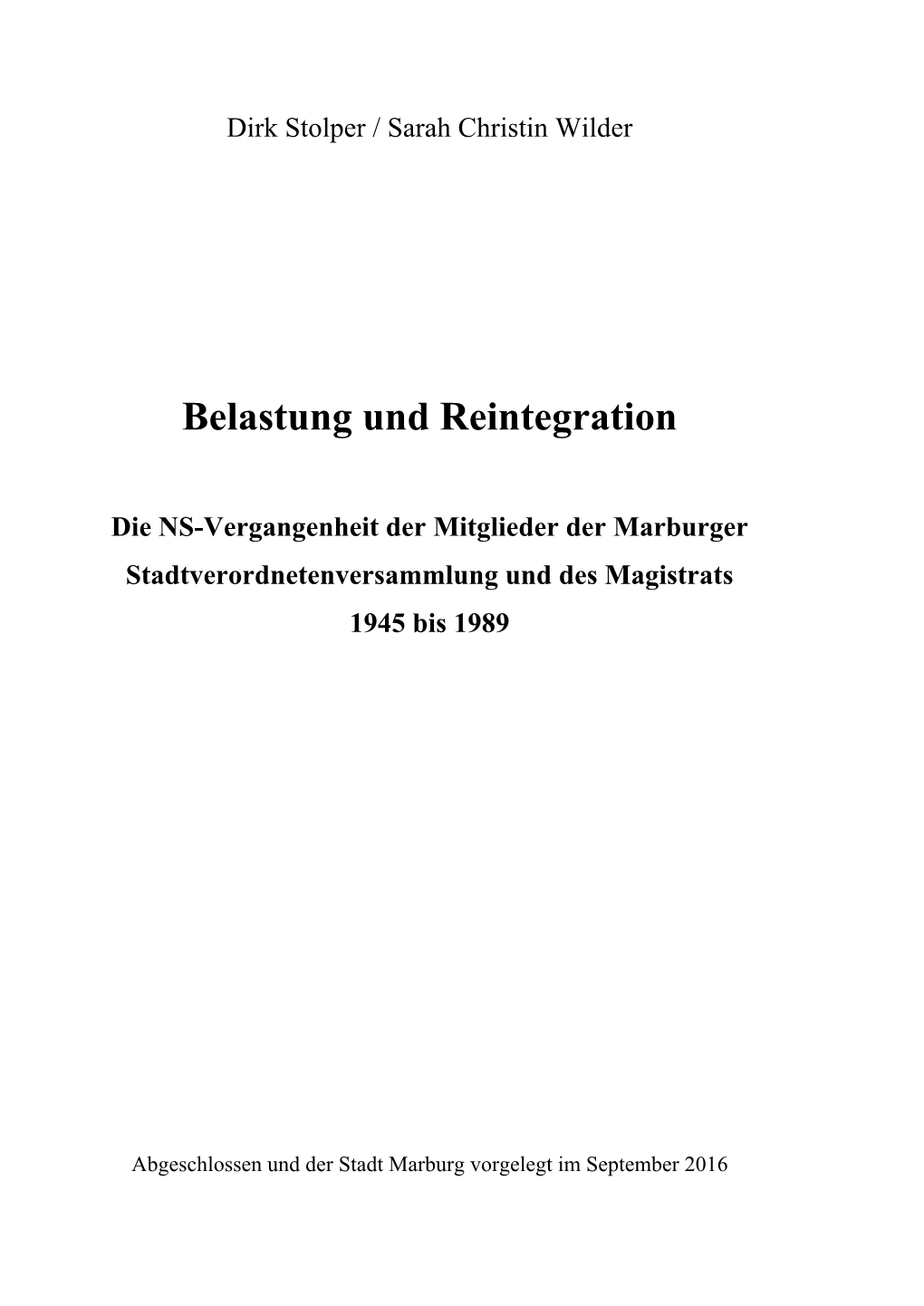
Load more
Recommended publications
-

Hans Kelsen's Contributions to the Changing Notion of International Criminal Responsibility
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 5-2019 Between Politics and Morality: Hans Kelsen's Contributions to the Changing Notion of International Criminal Responsibility Jason Kropsky The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3249 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] BETWEEN POLITICS AND MORALITY: HANS KELSEN’S CONTRIBUTIONS TO THE CHANGING NOTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL RESPONSIBILITY by JASON REUVEN KROPSKY A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Political Science in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2019 © 2019 JASON REUVEN KROPSKY All Rights Reserved ii Between Politics and Morality: Hans Kelsen’s Contributions to the Changing Notion of International Criminal Responsibility by Jason Reuven Kropsky This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Political Science in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date John Wallach Chair of Examining Committee Date Alyson Cole Executive Officer Supervisory Committee: John Wallach Bruce Cronin Peter Romaniuk THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Between Politics and Morality: Hans Kelsen’s Contributions to the Changing Notion of International Criminal Responsibility by Jason Reuven Kropsky Advisor: John Wallach The pure theory of law analyzes the legal normative basis of jurisprudence. -

Field-Marshal Albert Kesselring in Context
Field-Marshal Albert Kesselring in Context Andrew Sangster Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy University of East Anglia History School August 2014 Word Count: 99,919 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or abstract must include full attribution. Abstract This thesis explores the life and context of Kesselring the last living German Field Marshal. It examines his background, military experience during the Great War, his involvement in the Freikorps, in order to understand what moulded his attitudes. Kesselring's role in the clandestine re-organisation of the German war machine is studied; his role in the development of the Blitzkrieg; the growth of the Luftwaffe is looked at along with his command of Air Fleets from Poland to Barbarossa. His appointment to Southern Command is explored indicating his limited authority. His command in North Africa and Italy is examined to ascertain whether he deserved the accolade of being one of the finest defence generals of the war; the thesis suggests that the Allies found this an expedient description of him which in turn masked their own inadequacies. During the final months on the Western Front, the thesis asks why he fought so ruthlessly to the bitter end. His imprisonment and trial are examined from the legal and historical/political point of view, and the contentions which arose regarding his early release. -

United States of America V. Erhard Milch
War Crimes Trials Special List No. 38 Records of Case II United States of America v. Erhard Milch National Archives and Records Service, General Services Administration, Washington, D.C. 1975 Special List No. 38 Nuernberg War Crimes Trials Records of Case II United States of America v. Erhard Milch Compiled by John Mendelsohn National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1975 Library of Congress Cataloging in Publication Data United States. National Archives and Records Service. Nuernberg war crimes trial records. (Special list - National Archives and Records Service; no. 38) Includes index. l. War crime trials--N emberg--Milch case,l946-l947. I. Mendelsohn, John, l928- II. Title. III. Series: United States. National Archives and Records Service. Special list; no.38. Law 34l.6'9 75-6l9033 Foreword The General Services Administration, through the National Archives and Records Service, is· responsible for administering the permanently valuable noncurrent records of the Federal Government. These archival holdings, now amounting to more than I million cubic feet, date from the <;lays of the First Continental Congress and consist of the basic records of the legislative, judicial, and executive branches of our Government. The presidential libraries of Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, and Lyndon B. Johnson contain the papers of those Presidents and of many of their - associates in office. These research resources document significant events in our Nation's history , but most of them are preserved because of their continuing practical use in the ordinary processes of government, for the protection of private rights, and for the research use of scholars and students. -

NUREMBERG) Judgment of 1 October 1946
INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG) Judgment of 1 October 1946 Page numbers in braces refer to IMT, judgment of 1 October 1946, in The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany , Part 22 (22nd August ,1946 to 1st October, 1946) 1 {iii} THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL IN SESSOIN AT NUREMBERG, GERMANY Before: THE RT. HON. SIR GEOFFREY LAWRENCE (member for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) President THE HON. SIR WILLIAM NORMAN BIRKETT (alternate member for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) MR. FRANCIS BIDDLE (member for the United States of America) JUDGE JOHN J. PARKER (alternate member for the United States of America) M. LE PROFESSEUR DONNEDIEU DE VABRES (member for the French Republic) M. LE CONSEILER FLACO (alternate member for the French Republic) MAJOR-GENERAL I. T. NIKITCHENKO (member for the Union of Soviet Socialist Republics) LT.-COLONEL A. F. VOLCHKOV (alternate member for the Union of Soviet Socialist Republics) {iv} THE UNITED STATES OF AMERICA, THE FRENCH REPUBLIC, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS Against: Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin -

Insolvent Local Government: Lessons from Germany
Insolvent Local Government: Lessons from Germany Thomas Duve 1 and Wolfgang Drechsler 2 1 Introduction The current global crisis, and/or its aftermath, are affecting local governments in most European – and other “Western” – countries with particular impact, not least because the general and “time-honored” tendency of national and regional governance bodies to “hand down” financial obligations to the municipal level. (Schwarting 2008, 268; Faber 2005, 945) That this is a problem is exacerbated by two current phenomena: The increase of the importance of the local life-world for the citizens in a globalized and, where applicable, European world on the one hand (see Stern 1996, esp. 43; also e.g. Isin 2002; Drechsler 1999), which makes more and not less financial resources necessary, and, on the other hand, the late ideological tendency in public administration (PA), associated with the concept of the New Public Management (NPM), to dismantle local autonomy in the name of efficiency and – simply assumed – economies of scale, i.e. a bias in favor of larger and more centralized units and against anything local and municipal. (e.g. Seitz 2008) Although the latter has been more or less abolished on the academic and scholarly level, at least in Europe, with the rise of the concept of the Neo-Weberian State (NWS) as the post-NPM paradigm (cf. Pollitt et al. 2009), it is still alive and well in policy, and especially on the municipal level. (Reichwein 2007) The NWS is the logical PA paradigm both for getting out of the crisis and for times to come, it is true; also, in its rhetoric and general assumption, NPM is very much “pre-crash” and indeed part of the way of thinking that has led to, or at least significantly helped, the crash to come about as harshly as it did (see Drechsler 2009c); still, one reaction by financially troubled countries has been to force savings, cuts and such NPM measures that “reduce the state” (see Peters et al. -

Niemand Darf Den Anderen Richten, Es Sei Denn, Er Richtet Ihn in Der Inneren Verbundenheit, Als Ob Er Es Selbst Wäre
Datei: A7F:\Daten\Texte\Bücher\Alfred M. de Zayas_Die Wehrmacht und die Nürnberger Prozesse.docx Niemand darf den anderen richten, es sei denn, er richtet ihn in der inneren Verbundenheit, als ob er es selbst wäre. Karl Jaspers Die Wehrmacht und die Nürnberger Prozesse Alfred de Zayas1 Audiatur et altera pars ist ein fundamentales Prinzip, dass nicht nur für Juristen gilt. Auch Historiker, Politiker und Journalisten sollten bemüht sein, beide Seiten zu hö- ren, bzw. alle Aspekte einer Frage sine ira et studio abzuwägen. Dies ist eine selbst- verständliche Voraussetzung bei der Wahrheitssuche. Nur Theologen und Funda- mentalisten können dieses Prinzip ausschalten, denn sie meinen, bereits im Besitz der Wahrheit zu sein, und ihre Aufgabe darin verstehen, Dogma auch sei es durch Gewalt durchzusetzen. Dass Wehrmachtsoldaten Kriegsverbrechen begangen haben, ist aktenkundig. Die Nürnberger Prozesse und etliche Verfahren vor alliierten und deutschen Gerichten haben dies ausreichend belegt. Dass Soldaten anderer Armeen Kriegsverbrechen begangen haben, wurde seinerzeit von der Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Ver- letzungen des Völkerrechts durch richterliche Ermittlungen dokumentiert. Diese Ori- ginalakten sind im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg i.Br. aufbewahrt. Über die Echtheit und Zuverlässigkeit dieser Ermittlungen gibt es keinen Zweifel. Alliierte Kriegsverbrechen sind auch von seriösen nicht-deutschen Historikern untersucht worden, vor allem von Amerikanern, Briten und Kanadiern. Eine andere Frage ist, ob die Kriegsverbrechen der deutschen, sowjetischen, ameri- kanischen und britischen Armeen als Einzelverbrechen oder als Organisationsver- brechen anzusehen sind. Mit anderen Worten: Verhielten sich das Oberkommando der Wehrmacht und die kämpfende Truppe systematisch außerhalb der Bestimmun- gen der Haager und Genfer Konventionen, und wenn ja, geschah dies in allen 1 Gastprofessor des Völkerrechts, Chicago. -

Nuremberg, the Last Battle
NUREMBERG, THE LAST BATTLE David Irving NUREMBERG THE LAST BATTLE ‘David Irving is in the first rank of Britain’s historical chroniclers’ – THE TIMES F FOCAL POINT NUREMBERG, THE LAST BATTLE David Irving is the son of a Royal Navy commander. Edu- cated at Imperial College of Science & Technology and at Uni- versity College London, he subsequently spent a year in Ger- many working in a steel mill and perfecting his fluency in the language. Among his thirty books the best-known include Hit- ler’s War; The Trail of the Fox: The Life of Field-Marshal Rommel; Accident, the Death of General Sikorski; The Rise and Fall of the Luftwaffe, and Göring: a Biography. He has translated several works by other authors. He lives in Grosvenor Square, London, and is the father of five daughters. In he published The Destruction of Dresden. This became a best-seller in many countries. In he issued a revised edi- tion, Apocalypse , as well as his important biography, Goebbels. Mastermind of the Third Reich and the second volume of Church- ill’s War. For source notes go to ( + N) page et seq. NUREMBERG, THE LAST BATTLE For Jessica Copyright © , Parforce (UK) Ltd. Copyright Website edition © Focal Point Publications All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. Copies may be downloaded from our website for research purposes only. No part of this publication may be commercially repro- duced, copied, or transmitted save with written permission in accordance with the provisions of the Copyright Act 1956 (as amended). -

Texte 73.Indd 1 19.06.12 16:51 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 73
Schlesien zählte in den Nachkriegsjahrzehnten zu jenen Themen, die weitgehend den Vertriebenenverbänden überlassen wurden. Als eine Geburtsstätte des Widerstands gegen das Kapital blieb Schlesien bestenfalls durch den Aufstand der schlesischen Weber Texte 1844 in einer breiteren Öffentlichkeit präsent – vor allem über Heines und Hauptmanns Werke. Als ein Ort antisemitischer Verfolgungen, aber auch als ein wichtiges Zentrum des Widerstands gegen die Nazidiktatur ist Schlesien hingegen fast vollständig vergessen. Hier werden die aus Breslau stammenden, rassistisch und poli- tisch Verfolgten Fred und Martin Löwenberg sowie ihre Familie und Mitkämpfer dem Vergessen entrissen. Quellenmaterial und viele Details über die antifaschistische Arbeit, über Heimatverlust und die neue Zugehörigkeit Schlesiens zu Polen fließen ein. Erstmals wird auch ein Täterprofil des gefürchteten Gestapo-Beamten Josef Kluske aus Breslau erstellt, dessen Prozess in der Bundesrepublik während des Kalten Krieges eingestellt wurde. Cornelia Domaschke, Daniela Fuchs-Frotscher, Günter Wehner (Hrsg.) Widerstand Widerstand und Heimatverlust und Heimatverlust ISBN 978-3-320-02278-5 Deutsche Antifaschisten in Schlesien 9 783320 022785 ROSA E 14,90 [D] LUXEMBURG www.dietzberlin.de STIFTUNG 73 73 US_Texte 73.indd 1 19.06.12 16:51 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 73 1 2 Rosa-Luxemburg-Stiftung Cornelia Domaschke / Daniela Fuchs-Frotscher / Günter Wehner (Hrsg.) Widerstand und Heimatverlust Deutsche Antifaschisten in Schlesien Karl Dietz Verlag Berlin 3 Bildnachweise: S. 26, 38, -

NS-Vergangenheit Ehemaliger Hessischer Landtagsabgeordneter
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur Vorstudie „NS-Vergangenheit ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter“ der Kommission des Hessischen Landtags für das Forschungsvorhaben „Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen“ Autor: Dr. Albrecht Kirschner Herausgeber: Hessischer Landtag Mitglieder der Arbeitsgruppe „NS-Vergangenheit ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter“ der Kommission des Hessischen Landtags für das Forschungsvorhaben „Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen“: Koordinator: Ltd. Archivdirektor Dr. Andreas Hedwig (Hessisches Staatsarchiv Marburg) Prof. Dr. Marie-Luise Recker (Goethe-Universität Frankfurt a.M.) Prof. Dr. Eckart Conze (Philipps-Universität Marburg) Prof. Dr. Dirk van Laak (Justus-Liebig-Universität Gießen) Prof. Dr. Walter Mühlhausen (Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert Gedenkstätte Heidelberg) Ltd. Archivdirektor Prof. Dr. Klaus Eiler (Hessisches Hauptstaatsarchiv) Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur Vorstudie „NS-Vergangenheit ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter“ der Kommission des Hessischen Landtags für das Forschungsvorhaben „Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen“ Dr. Albrecht Kirschner Vorstudie „NS-Vergangenheit ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter“ - Abschlussbericht - Inhaltsübersicht Einleitung.........................................................................................3 1. Gesamtergebnis ................................................................................4 2. Fragestellung -

1 Field Marshal Erich Von Manstein, a Leading Figure in The
1 Field Marshal Erich von Manstein, a leading figure in the Wehrmacht High Command during the Second World War, was the defendant in the final British war crimes trial of the immediate postwar era. This politically sensitive case was heard in the final months of 1949 and, unlike most other instances of legal redress for Nazi atrocities, inspired an exceptionally clamorous public reaction in Britain. Lord Hankey, exemplifying one facet of this debate, condemned Manstein’s prosecution as a wrong comparable to the execution of King Charles I, a mistake reminiscent of the burning of Joan of Arc, and a marring of justice that undermined Britain’s renowned standards of chivalry, honour, and common sense.1 However, as will become clear, there were also those who applauded the trial and its verdict with a similar vehemence. One newspaper editorial proclaimed that ‘Von Manstein has got no more than he deserved’, stressing that ‘there is no need…for anyone on this side of the Channel to wax sentimental because retribution has at last caught up with a man who plied his grim trade of death and destruction with such ruthlessness’.2 The hearing transpired at a vital moment in the evolution of Britain’s postwar foreign policy, with the nascent Cold War inspiring the rapid rehabilitation of Germany from pariah state to important ally. Manstein’s trial was a key juncture in Britain’s postwar experience vis-a-vis Germany and offers acute insight into the character of popular relations in the context of Anglo-German political reconciliation. Scholars have, until now, typically engaged with the Manstein trial as a touchstone of Britain’s postwar international relations outlook regarding Germany and the balance of power in Europe.3 In this reading we see how the realpolitik surrounding the hearing led to months of governmental deliberations over its political desirability, before in 1953 eventually securing the release of Manstein after he had served less than one-fifth of his 1 Lord M. -

Siegfried Marck. Politische Biographie Eines Jüdisch-Intellektuellen Sozialdemokraten
Siegfried Marck. Politische Biographie eines jüdisch-intellektuellen Sozialdemokraten Dissertation zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von Markus Schulz aus Gehrden Göttingen, im November 2014 1. Gutachter: Prof. Dr. Peter Aufgebauer 2. Gutachter: Prof. Dr. Karsten Rudolph Tag der mündlichen Prüfung: 27. Januar 2016 EINLEITUNG 1 FORSCHUNGSINTERESSE UND FRAGESTELLUNG 12 FORSCHUNGSSTAND 21 QUELLENLAGE UND -AUSWAHL 24 ZUR BIOGRAPHISCHEN METHODE UND DEREN UMSETZUNG 28 DER ERSTE KULTURKREIS – BRESLAUER JAHRE 35 DIE FAMILIE MARCK 35 BILDUNGSBIOGRAPHIE 40 DIE EHE MIT LOLA LANDAU 50 DER ÜBERGANG ZUR SOZIALDEMOKRATIE 58 DIE EHE MIT KLÄRE ROSENSTOCK 69 WEGGEFÄHRTEN UM DIE BRESLAUER VOLKSWACHT 72 ALS GEISTIGER ARBEITER 83 EIN NOVEMBERSOZIALIST ALS STADTVERORDNETER 91 DIE JUNGSOZIALISTEN – EIN RUCK NACH LINKS 124 EINE UNLAUTERE BERUFUNG? 142 IM ZWEITEN KULTURKREIS – IM FRANZÖSISCHEN EXIL 151 ZWISCHEN OPPOSITION UND KAMPFKARTELL 151 TÄTIGKEITEN IN DER VOLKSFRONT 161 ALS IDEENGEBER DES FREIHEITLICHEN BÜRGERTUMS 171 IM DRITTEN KULTURKREIS – IM AMERIKANISCHEN EXIL 187 FLUCHT UND FIXIERUNG 187 FÜR EINE NEUORDNUNG EUROPAS – EIN DRITTER WEG 203 DIE „FREUNDSCHAFT“ MIT THOMAS MANN 237 AUF VORTRAGSREISE NACH DEUTSCHLAND 246 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG 255 LITERATUR 269 Einleitung Es waren bewegende Momente für Siegfried Marck, als er im Juli 1951 Paul Löbe auf der Dachterrasse des Bundeshauses in Bonn die Hand schütteln durfte. Der etwas untersetze, mittelgroße und sich in seinen Erntejahren befindende Sozialdemokrat, mit lichtem Haar, zog immer wenn er nervös oder besonders angespannt war seine rechte Augenbraue hoch und strich sich mit dem Daumen darüber. So wird es auch gewesen sein, als er dort auf den Alterspräsidenten des Ersten Deutschen Bundestages traf. -

Der Fall Marburg
Sebastian Chwala Frank Deppe Rainer Rilling Jan Schalauske (Hrsg.) Die gekaufte Stadt? Der Fall Marburg: Auf dem Weg zur »Pohl-City«? VSA: Sebastian Chwala / Frank Deppe / Rainer Rilling / Jan Schalauske (Hrsg.) Die gekaufte Stadt? Der Fall Marburg: Auf dem Weg zur »Pohl-City«? Sebastian Chwala / Frank Deppe / Rainer Rilling / Jan Schalauske (Hrsg.) Die gekaufte Stadt? Der Fall Marburg: Auf dem Weg zur »Pohl-City«? Eine Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stiftung VSA: Verlag Hamburg www.vsa-verlag.de Die in diesem Band abgedruckten Fotos stammen von Godela Linde und Rainer Rilling. Dieses Buch wird unter den Bedingungen einer Creative Com- mons License veröffentlicht: Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivs 3.0 Germany License (abrufbar unter www. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode). Nach dieser Lizenz dür- fen Sie die Texte für nichtkommerzielle Zwecke vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen unter der Bedingung, dass die Namen der Autoren und der Buchtitel inkl. Verlag genannt werden, der Inhalt nicht bearbeitet, abge- wandelt oder in anderer Weise verändert wird und Sie ihn unter vollständigem Abdruck dieses Lizenzhinweises weitergeben. Alle anderen Nutzungsformen, die nicht durch diese Creative Commons Lizenz oder das Urheberrecht gestattet sind, bleiben vorbehalten. © VSA: Verlag 2016, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg Umschlagfoto: Alte und neue Macht – das Marburger Schloss und der Finanzmarktkonzern Druck- und Buchbindearbeiten: Beltz Bad Langensalza GmbH ISBN 978-3-89965-683-1 Inhalt Vorwort der Herausgeber ................................................................... 7 Reinfried Pohl, die DVAG und Marburg – ein Glücksfall? Jürgen Nordmann Anerkennung für Geld, Geld gegen Anerkennung ............................ 15 Reinfried Pohl und die Stadt Marburg Frank Deppe Der »Homo politicus«.