Die Konstitution Des Wunderbaren. Zu Einer Poetik Des Science Fiction
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Media Industry Approaches to Comic-To-Live-Action Adaptations and Race
From Serials to Blockbusters: Media Industry Approaches to Comic-to-Live-Action Adaptations and Race by Kathryn M. Frank A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Communication) in the University of Michigan 2015 Doctoral Committee: Associate Professor Amanda D. Lotz, Chair Professor Susan J. Douglas Professor Lisa A. Nakamura Associate Professor Aswin Punathambekar © Kathryn M. Frank 2015 “I don't remember when exactly I read my first comic book, but I do remember exactly how liberated and subversive I felt as a result.” ― Edward W. Said, Palestine For Mom and Dad, who taught me to be my own hero ii Acknowledgements There are so many people without whom this project would never have been possible. First and foremost, my parents, Paul and MaryAnn Frank, who never blinked when I told them I wanted to move half way across the country to read comic books for a living. Their unending support has taken many forms, from late-night pep talks and airport pick-ups to rides to Comic-Con at 3 am and listening to a comics nerd blather on for hours about why Man of Steel was so terrible. I could never hope to repay the patience, love, and trust they have given me throughout the years, but hopefully fewer midnight conversations about my dissertation will be a good start. Amanda Lotz has shown unwavering interest and support for me and for my work since before we were formally advisor and advisee, and her insight, feedback, and attention to detail kept me invested in my own work, even in times when my resolve to continue writing was flagging. -

1566563531375.Pdf
Introduction In the year 1954, the United States government performed 6 nuclear weapons tests in and around the Pacific Ocean. However, this is just the official story. The truth of the matter is that the U.S. Government and Monarch, a multinational, cryptozoological research organization, were trying to kill an ancient and terrifying apex predator. A Titan. This titans name is Titanus Gojira, more recognizably called Gojira or Godzilla. Godzilla’s species ruled the Earth hundreds of millions of years ago, when radiation levels on the planet were astronomically higher. The advent and testing of nuclear weapons awoke Godzilla from his hibernation on the bottom of Earth’s sea floor, where he was feeding off of the planets geothermal radiation. Despite being the first titan to awake, Godzilla is not the only titan that exists on Earth. There are countless others that still sleep or dwell in hidden areas around the world. You begin your stay within this world in 2014, just a scant few weeks before Joe and Ford Brody witness the awakening of the titan known as the MUTO. A scant few weeks before Godzilla becomes known to the world. Location San Francisco, California (1) San Francisco is a massive American metropolis with an area of about 231 square miles. It is bustling with a population nearing one million and holds some of America’s most iconic landmarks. However, this could all change very quickly in the coming years. This city will become the site of an incredible battle between Godzilla and the two MUTO in the year 2014, which will cause severe damage to the city as a whole. -

Alternate Americas: Science Fiction Film and American Culture
Alternate Americas: Science Fiction Film and American Culture M. Keith Booker PRAEGER Alternate Americas Science Fiction Film and American Culture F M. Keith Booker Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Booker, M. Keith. Alternate Americas : science fiction film and American culture / M. Keith Booker. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0–275–98395–1 (alk. paper) 1. Science fiction films—United States—History and criticism. I. Title. PN1995.9.S26B56 2006 791.43'615—dc22 2005032303 British Library Cataloguing in Publication Data is available. Copyright # 2006 by M. Keith Booker All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 2005032303 ISBN: 0–275–98395–1 First published in 2006 Praeger Publishers, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. www.praeger.com Printed in the United States of America The paper used in this book complies with the Permanent Paper Standard issued by the National Information Standards Organization (Z39.48–1984). 10987654321 For Benjamin Booker Contents Introduction 1 1 F The Day the Earth Stood Still 27 2 F Forbidden Planet 43 3 F Invasion of the Body Snatchers 59 4 F 2001: A Space Odyssey 75 5 F Planet of the Apes 91 6 F Star Wars 109 7 F Close Encounters of the Third Kind 125 8 F Alien 141 9 F E.T. the Extra-Terrestrial 157 10 F Blade Runner 171 11 F The Terminator 187 12 F Robocop 203 13 F The Abyss 219 viii u Contents 14 F Independence Day 233 15 F The Matrix 247 Conclusion: Science Fiction Film and American Culture 265 Index 269 Photo essay follows chapter 7. -

Ultimate Movie Collectables London - Los Angeles
Ultimate Movie Collectables London - Los Angeles Prop Store - London Office Prop Store - Los Angeles Office Great House Farm 9000 Fullbright Ave Chenies Chatsworth, CA 91311 Rickmansworth USA Hertfordshire Ph: +1 818 727 7829 WD36EP Fx: +1 818 727 7958 UK Contact: Ph: +44 1494 766485 Stephen Lane - Chief Executive Officer Fx: +44 1494 766487 [email protected] [INTRODUCTION] Prop Store Office: London Prop Store Office: Los Angeles How do you best serve your greatest passion in life? the pieces that they sought, but also establish the standards for finding, You make it your business. acquiring and preserving the props and costumes used in Hollywood’s most beloved films. In 1998, UK native Stephen Lane did just that. Stephen’s love for movies led him ENTER: THE PROP STORE OF LONDON to begin hunting for the same props and Stephen and his team came to market already looking beyond the business costumes that were used to create his of simply collecting and selling movie props. Instead, the Prop Store team favorite films. It was the early days of the set out like a band of movie archaeologists, looking to locate, research internet and an entire world of largely and preserve the treasure troves of important artifacts that hid in dark, isolated collectors was just beginning to sometimes forgotten corners all over the world. And it’s now thanks to come together. As Stephen began making Stephen’s vision and the hard work of his dedicated team that so many of friends and connections all over the world— film history’s most priceless artifacts have found their way into either the relationships that continue today—he loving hands of private collectors or, as one of Stephen’s greatest movie realized that he was participating in the explosion of a hobby that would heroes would say, “into a museum!” soon reach every corner of the globe. -
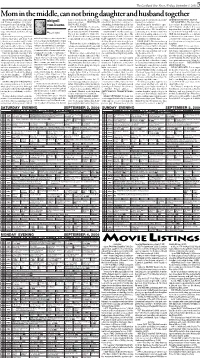
Mom in the Middle, Can Not Bring Daughter and Husband Together DEAR ABBY: I Was Recently Mar- Want to Tell Them Who Did It
The Goodland Star-News / Friday, September 1, 2006 5 Mom in the middle, can not bring daughter and husband together DEAR ABBY: I was recently mar- want to tell them who did it. I really coming a young woman, and sharing transsexual. Your friend needs under- BRENDA IN AUSTIN, TEXAS ried. I have a daughter, “Courtney,” abigail need some advice. — HURTING IN a bed with her father could be too standing, not isolation. DEAR BRENDA: The type of par- from a previous relationship. Things van buren HAYWARD, CALIF. stimulating, for both of them. If he has By all means he should see a psy- ties you have described are more for were great before the wedding. We DEAR HURTING: Pick up the further doubts about this, he should chiatrist — one who specializes in adults than for children. It is more even included Courtney in the plan- phone and call the Rape, Abuse and consult his daughter’s pediatrician. gender disorders. He should have important that your little girl be able ning. Afterward, however, things Incest National Network (RAINN). DEAR ABBY: About a month ago, counseling if he wants to take this to enjoy her birthday with some of dear abby turned sour. • The toll-free number is (800) 656- I was shocked out of my shoes. My where it is heading, and also to cope HER friends than it be a command Courtney kept causing problems 4673. Counselors there will guide you longtime friend, “Orville,” told me he with the loss of his friends. It would performance for your sisters. -

Vigilantes, Incorporated: an Ideological Economy of the Superhero Blockbuster
VIGILANTES, INCORPORATED: AN IDEOLOGICAL ECONOMY OF THE SUPERHERO BLOCKBUSTER BY EZRA CLAVERIE DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in English with a minor in Cinema Studies in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2016 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Associate Professor José B. Capino, Chair Associate Professor Jim Hansen Associate Professor Lilya Kaganovsky Associate Professor Robert A. Rushing Professor Frank Grady,Department of English, University of Missouri, Saint Louis ii ABSTRACT Since 2000, the comic-book superhero blockbuster has become Hollywood’s most salient genre. “Heroes, Incorporated: A Political Economy of the Superhero Blockbuster” examines these seemingly reactionary fantasies of American power, analyzing their role in transmedia storytelling for a conglomerated and world-spanning entertainment industry. This dissertation argues that for all their apparent investment in the status quo and the hegemony of white men, superhero blockbusters actually reveal the disruptive and inhuman logic of capital, which drives both technological and cultural change. Although focused on the superhero film from 2000 to 2015, this project also considers the print and electronic media across which conglomerates extend their franchises. It thereby contributes to the materialist study of popular culture and transmedia adaptation, showing how 21st century Hollywood adapts old media for new platforms, technologies, and audiences. The first chapter traces the ideology of these films to their commercial roots, arguing that screen superheroes function as allegories of intellectual property. The hero’s “brand” identity signifies stability, even as the character’s corporate owners continually revise him (rarely her). -

MARK HOLDING - Sound Mixer
MARK HOLDING - Sound Mixer WONDERWELL Director: Vlad Marsavin. Producer: Richard Schlesinger. Starring: Keira Millard, Carrie Fisher and Lloyd Owen. Strange Quark Films. BLACK SAILS (Series 4) Directors: Lukas Ettlin, Alik Sakharov and Roel Reine. Producers: Nina Heyns and Dan Shotz. Starring: Zach McGowan, Toby Stephens, Luke Arnold and Jessica Parker Kennedy. Starz / Film Afrika Worldwide. TUT Director: David Von Ancken. Producer: Guy J. Louthan. Starring: Ben Kingsley and Avan Jogia. Muse Entertainment. TRANSPORTER (Series 2) Directors: Eric Vallete, Stefan Pleszczynski and PJ Pesce. Producer: Marc Jenny. Starring: Chris Vance and Violante Placido. Atlantique Productions. THE MUSKETEERS Directors: Toby Haynes, Richard Clark, Farren Blackburn, Andy Hay and Saul Metzstein. Producer: Colin Wratten. Starring: Tom Burke, Santiago Cabrera, Peter Capaldi, Tamla Kari, Maimie McCoy, Luke Pasqualino and Hugo Speer. BBC America. THE LAST KNIGHTS Director: Kazuaki Kiriya. Producer: Luci Y. Kim. Starring: Morgan Freeman, Clive Owen, Cliff Curtis, Ayelet Zuret and Shohreh Aghdashloo. Czech Anglo Productions / Luka Productions International. 4929 Wilshire Blvd., Ste. 259 Los Angeles, CA 90010 ph 323.782.1854 fx 323.345.5690 [email protected] 300: BATTLE OF ARTEMISIA Director: Noam Murro. Producers: Zack Snyder, Mark Canton, Bernie Goldman, Gianni Nunnari, Deborah Snyder and Thomas Tull. Starring: Eva Green, Rodrigo Santoro, Jack O’Connell, Sullivan Stapleton and Andrew Tiernan. Atmosphere Entertainment. SNOWPIERCER Director: Joon-ho Bong. Producer: Chan-wook Park. Starring: Chris Evans, Jamie Bell, Octavia Spencer, Tilda Swinton, John Hurt and Alison Pill. Moho Films. MISSING Director: Steve Shill. Producer: David Minkowski. Starring: Sean Bean, Ashley Judd and Cliff Curtis. ABC Studios / Little Engine Productions / Stillking Films. -

Final Version
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by SHAREOK repository UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA Edmond, Oklahoma Jackson College of Graduate Studies Spandex Cinema: Three Approaches to Comic Book Film Adaptation A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN ENGLISH By Benjamin Smith Edmond, Oklahoma 2009 ABSTRACT OF THESIS University of Central Oklahoma Edmond, Oklahoma NAME: Benjamin Smith TITLE OF THESIS: Spandex Cinema: Three Approaches to Comic Book Film Adaptation DIRECTOR OF THESIS: Dr. John P. Springer PAGES: 66 Adapting graphic novels requires new approaches in the theoretical models currently available to film theorists. Comic book films must be dissected beyond references to character, setting, plot, or story; analysis must consider the choice of plot and story within or outside a preexisting canon, the exclusion or inclusion of thematic elements, and the fidelity of visual narrative. The intertextual variability intensifies when considering comic book films and new methodologies are required for a proper examination of this genre. Using the works of comics scholars (McCloud, Eisner, and Ewert, et al), the studies of film theorists (Andrew, Wager, Ryan, Bordwell, et al) and graphic novels from highly regarded authors and artists (Miller, Moore, et al) new modes of adaptation emerge as specifically designed both for the comic book film and a greater understanding of visual narrative. iii Acknowledgements In the winter of my sophomore year of college I was told by a friend to read Watchmen and The Dark Knight Returns. -

Sherlock Holmes Films
Checklist of non-Sherlockian Conan Doyle Films and Television Programs This listing consists of film and television depictions of Arthur Conan Doyle or presentations of his non-Sherlockian stories. Production Co. Information Title Date Country Doyle or TV Channel Story basis / misc. notes TV/Film Release/Air date Source(s) Page # From the play of the same name which was based on Film BFI, Ross The House of Temperley 1913 UK --- London Film Company 'Rodney Stone' Universal Animated Weekly No. 117 1914* USA Arthur Conan Doyle Universal Pictures Doyle's arrival in America was captured for a newsreel Film June 3, 1914 Pointer 166 Our Mutual Girl 1914* USA Arthur Conan Doyle Mutual Film Corp. Doyle had a cameo appearance in reel 22 and possibly reel Film 23. There were a total of 52 weekly reels. The $5,000,000 Counterfeiting Plot 1914* USA Arthur Conan Doyle Dramascope Co. Doyle performed a short cameo appearance for William J. Film Burns, a former Pinkerton detective and star of the movie. The Firm of Girdlestone 1915 UK --- London Film Company Film BFI, Ross [Film newsreel of ACD setting a cornerstone] ? UK Arthur Conan Doyle ? Film Brigadier Gerard 1915 UK --- Barker Films. Ltd. Lewis Waller as Gerard Film UK: Sept. 1915 BFI, Ross US: April 10, 1916 Rodney Stone 1920 UK --- Screen Plays Film BFI, Ross Un drame sous Napoléon 1921 France --- Éclair Based on 'Uncle Bernac' Film [Film newsreel of ACD and family in the USA] 1922 USA Arthur Conan Doyle Fox-Case Movietone Film Paton The Fires of Fate 1923 UK --- Gaumont/Westminster Based on 'The Tragedy of the Korosko' Film IMDB The Lost World 1925 USA Arthur Conan Doyle First National Pictures Wallace Berry as Challenger. -

Between the Panels
Between the Panels How the interactions between commerce and art shape superhero comic book film adaptations (2000-13) Tim Stafford Between The Panels: How the interactions between commerce and art shape superhero comic book film adaptations (2000-13) Tim Stafford Submitted to the University of Hertfordshire in partial fulfilment of the requirements of the degree of PhD January 2018 Acknowledgments I would like to thank my Principal Supervisor, Professor Keith Randle and my Second Supervisors, Visiting Professor Richard Miller and Dr Mariana Dodourova for their support and guidance during this project. I would also like to thank Greg Pan at Marvel for granting permission to reproduce the three selected comic book panels and Roni Lubliner at Universal for granting permission to use the still from Hulk. This thesis is dedicated in its entirety to my parents, Terry and Sheila Stafford, to Derek Watson, my best friend and guide in the world of comic books and to Hugh Jackman, who started the whole thing off. Between the Panels Contents List of figures 1 Abstract 3 Introduction 5 Research questions 8 Introduction to the conceptual framework and methodology 9 Thesis structure 12 Chapter One: Up, up and away: superheroes and their adaptations 14 Origin story: A brief history of superhero adaptations 14 The superhero film renaissance: 2000 to the present 20 Why are superhero films so popular? 26 i) The studio perspective 26 ii) The audience perspective 29 iii) The role of comic book readers 31 The theory of adaptation 34 The role of the director -

Daniel Arrias
Daniel Arrias Gender: Male Mobile: 818-606-3338 cel Height: 5 ft. 10 in. E-mail: [email protected] Weight: 175 pounds Web Site: http://www.imdb.com/... Eyes: Brown Hair Length: Regular Waist: 33 Inseam: 32 Shoe Size: 11 Physique: Athletic Coat/Dress Size: 42 R Ethnicity: Caribbean, Latin/Hispanic, Middle Eastern, Mixed Unique Traits: TATTOOS (Got Them) Photos Film Credits Bourne 5 Sunt Player Gary Powell American Ultra Fight Trainer Robert Alonzo The Equalizer Fight Keith Woulard Argo Iranian Police J J Perry Jack Reacher utility Paul Jennings Oblivion utility Robert Alonzo The 5th Wave Fight Trainer Joe Box Tomorrowland George Clooney DBL Robert Alonzo Battle Los Angeles Dbl Michael Pena Joey Box Abduction CIA Agent Brad Martin The Fighter Boxing Ben Bray The Green Lantern Utility Gary Powell Generated on 10/05/2021 09:16:34 am Page 1 of 5 Kenny Bates The Green Hornet Drug Dealer Jeff Amada / Andy Armstrong The Last Airbender Fights Jeff Habberstad The Expendables Utility Chad Stahelski Transformers 2 Dbl. Ramon Rodriquez Kenny Bates Angles and Demons Cop Brad Martin Star Trek Dbl.Zack Quinto Joey Box Zohan Dbl. Adam Sandler [his legs} Scott Rogers Race To Witch Mountain Lab Tec. Scott Rogers The Good Life Dbl. Demian Bichir Trampas Thompson The Good Doctor Dbl. Michael Pena Steve Davison Tropic Thunder U.S. Infantry Brad Martin Iron Man Insurgent Tom Harper Die Hard 4 Dbl. Yancy Arias Brad Martin The Kingdom Iraqi Special Forces Phil Neilson Next Henchman R A Rondell Smokin Aces Dbl. Nestor Carbonel Ben Bray The Legend of Zorro U S Infantry Gary Powell Southland Tales ND Tim Trella Charlie Wilson's War Pakistan Military Rick Avery Days Of Wrath Gang member Manny Perry Crash And Burn Gang Member David Rowden Cursed ND Charlie Croughwell Spider Man Business man Dan Bradley League of Extraordinary Bad Guy Eddie Perez Gentleman Seabiscuit Boxer Dan Bradley Hidalgo Arab Gunman Pat Romano The Rundown Bad guy Andy Cheng A line in the Sand Gang Member Bob Brown / Jon Epstein No Rules MMA Fighter Will Leon Jia Chianjeeva Dbl. -

Newsletter 07/10 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 07/10 DIGITAL EDITION Nr. 270 - Mai 2010 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 07/10 (Nr. 270) Mai 2010 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, len Master das wir von den Produ- der stetig zurückgehenden Anzahl liebe Filmfreunde! zenten erhalten haben. Ich vermute, von Pressevorführungen in Stutt- Wir haben es geschafft! Planmäßig dass für die 35mm Kopien eine an- gart. Fast scheint es, als ob sich haben wir am 26. April 2010 unsere dere Mischung angefertigt wur- viele Verleiher mit ihren Produkten neuen Büroräume bezogen. Man- de...” Die Vermutung ist richtig. nicht mehr in die schwäbische Me- che würden behaupten, dass es fast Nur fragt man sich zurecht, warum tropole trauen, da die leichte Ge- schon an ein Wunder grenzt, dass es die Produzenten jenes Kurzfilms fahr besteht, dass ein Film durch der Umzug derart reibungslos ver- nicht für notwendig erachteten, für die anwesenden Journalisten objek- lief und praktisch nichts zu Bruch die DVD ein heimkinotaugliches tiv beurteilt werden könnte. Und ging und auch unsere Kommunikat- 5.1-Master zu liefern. So etwas mit objektiv meinen wir, dass die ions- und EDV-Technik quasi auf wurmt natürlich nicht nur uns Film- Stuttgarter Filmkritiker den Film- Anhieb funktionierte. Doch wir sammler und Heimkinofans, son- verleihern keinen Honig um den wissen es natürlich besser. Es war dern dürfte auch den Machern von Mund schmieren, sondern unver- kein Wunder, was uns hier geholfen ARBEIT FÜR ALLE nicht son- blümt ihre Meinung zum Film kund- hat, sondern die exzellente Um- derlich gefallen.