Die Münchner Hofmusik Bis 1800
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
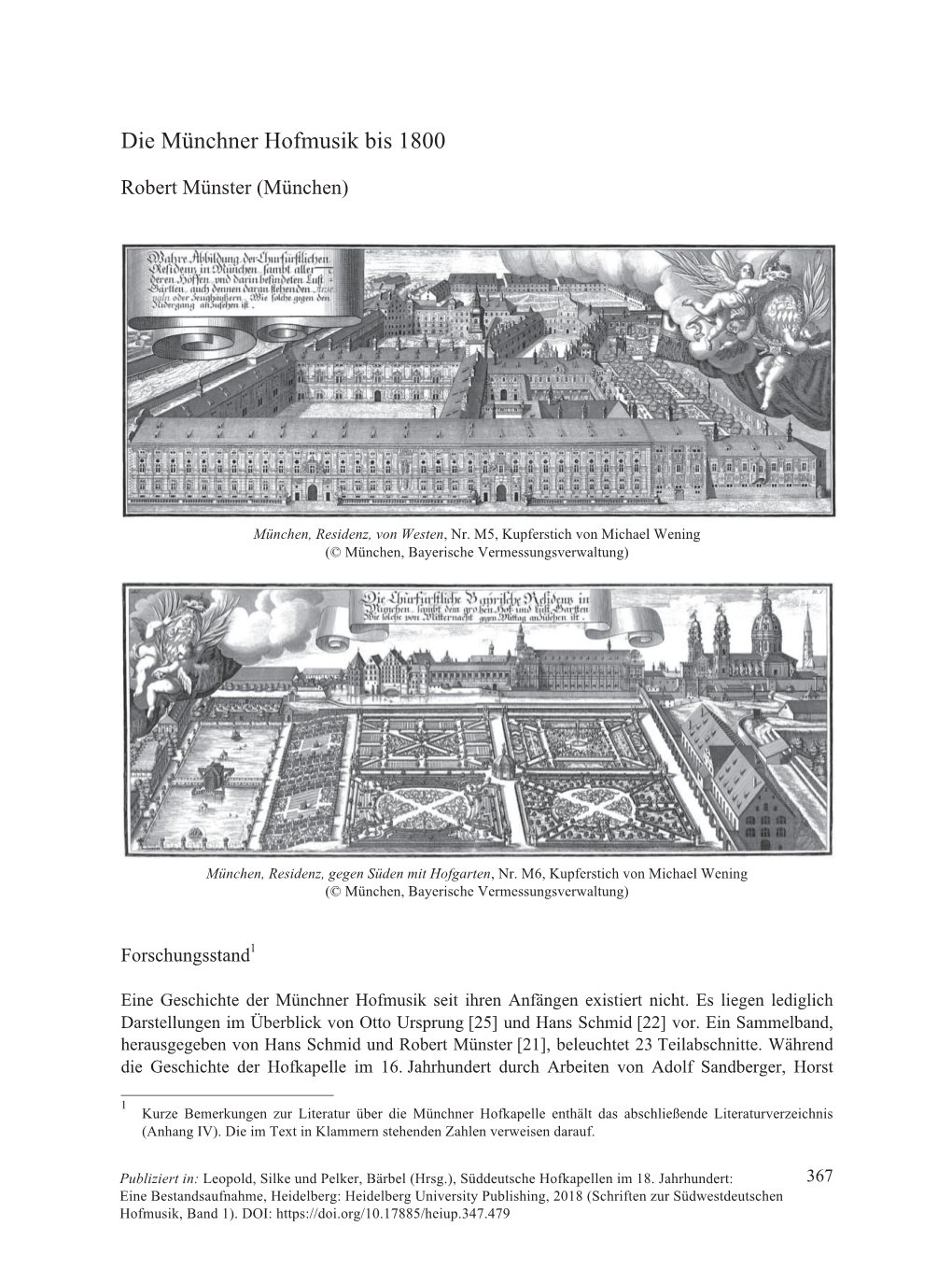
Load more
Recommended publications
-

Mozart-Rezeption in Franz Danzis Der Berggeist1 Adrian Kuhl
»Feingefühlte Charakteristik« Mozart-Rezeption in Franz Danzis Der Berggeist1 Adrian Kuhl I In der Allgemeinen musikalischen Zeitung erschien am 25. März 1804 ein Artikel über Wolfgang Amadeus Mozarts Opern, in dem der anonyme Autor über Charakteristika von dessen Musiktheater reflektiert: Was aber den meisten Menschen entgeht, ist die feingefühlte Charakteristik, nicht allein der einzelnen Personen, sondern der ganzen Handlung einer jeden Oper. Im Don Juan die Mischung von Erhabenheit und Leichtsinn; im Figaro die joviale Haltung des Ganzen; in der Zauberflöte Munterkeit gepaart mit Würde und feyerlichem Ernste; in Così fan tutte die sanften Halbtinten der feinern Welt- verhältnisse, diese süsse Schwärmerey, die von der Ouvertüre bis zum letzten Ak- kord des Schlusschors das schönste, in allen Theilen harmonischste Ganze ausma- chen, das irgend ein Künstler je hervorzubringen vermochte, in der Entführung aus dem Serail diese Nationalcharakteristik in der erhabensten Darstellung – was überhaupt ein Vorzug Mozart’s, und nur bey ihm in der Grösse anzutreffen ist: diese Einheit des Charakters – wer hat das je gefühlt, bemerkt, bewundert? Wenn aber ein jedes seiner theatralischen Werke das grosse, seltene Verdienst der Einheit und Charakteristik, das Gepräge des feinsten Menschenkenners an der Stirne trägt: welchem soll ich den Vorzug geben?2 1 Der folgende Beitrag basiert auf Teilen meines Vortrags bei der Tagung Mozartvariationen. Franz Danzi und die Mozartverehrung im ausgehenden 18. Jahrhundert, die am 15. Juni 2013 anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten von der Forschungsstelle »Geschichte der Südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert« der Heidelberger Akademie der Wissen- schaften in Schwetzingen ausgerichtet wurde. 2 [Franz Danzi]: »An meinen Freund«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 6 (1804), No. -

Schiller and Music COLLEGE of ARTS and SCIENCES Imunci Germanic and Slavic Languages and Literatures
Schiller and Music COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ImUNCI Germanic and Slavic Languages and Literatures From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Schiller and Music r.m. longyear UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 54 Copyright © 1966 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Longyear, R. M. Schiller and Music. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1966. doi: https://doi.org/ 10.5149/9781469657820_Longyear Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Longyear, R. M. Title: Schiller and music / by R. M. Longyear. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 54. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1966] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. | Includes bibliographical references. Identifiers: lccn 66064498 | isbn 978-1-4696-5781-3 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5782-0 (ebook) Subjects: Schiller, Friedrich, 1759-1805 — Criticism and interpretation. -

Was Schön, Was Herrlich Heißen Kann ...«
»... alles, was schön, was herrlich heißen kann ...« Kammermusikkonzert »Kleine Serenade« Im Rahmen des Themenjahres 2020 »Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit« Schlossgarten Schwetzingen am Minervatempel 19 Uhr, 26. August 2020 PROGRAMM CARLO GIUSEPPE TOESCHI (1731–1788) Flötenquartett in C-Dur aus: Six simphonies ou quatuors dialogués, Paris [ca. 1764] Allegro grazioso – Menuetto FERDINAND FRÄNZL (1767–1833) Flötenquartett in D-Dur aus: Deux Quatuors [...] op. 10, Augsburg [ca. 1810] Allegro – Andante – Allegretto FRANZ DANZI (1763-1826) Flötenquartett in d-Moll aus: Trois Quatuors […] op. 56, Offenbach (1819) Allegretto – Andantino – Allegretto Menuetto – Allegretto Manches schöne Bauwerk überdauert seine Zeit und wird von der Nachwelt immer noch bewundert. Carl Theodor von der Pfalz hat sich nicht nur mithilfe der Bau- oder Kunstwerke Denkmäler errichten lassen, sondern ging als Begründer der berühmten kurpfälzischen Hofkapelle in die Musikgeschichte ein. Die Virtuosen und Komponisten seiner Hofmusik waren europaweit bekannt und leisteten gewichtige Beiträge vornehmlich auf dem Gebiet der Instrumentalmusik. Ihre Sinfonien und Konzerte hätte man mit einem antiken Minerva- oder Apollo-Tempel vergleichen können. Selbst in kleineren Dimensionen wie in den Werken für kammermusikalische Besetzungen waren sie mitunter federführend. Als die Quartettbesetzung mit einer Flöte, genannt Flötenquartett, ab den 1760er Jahren immer populärer wurde, erfreute sich diese Modeerscheinung auch in Mannheim großer Beliebtheit. Der Konzertmeister und ab 1773 der Kabinettmusikdirektor Carlo Giuseppe Toeschi komponierte – höchstwahrscheinlich ursprünglich für die Musizierstunden seines Dienstherren Carl Theodor – ca. 30 Flötenquartette, die vornehmlich in Paris publiziert wurden. Toeschi wurde zum Vorreiter auf diesem Gebiet, obwohl noch andere Musikerkollegen wie Christian Cannabich, Ignaz Fränzl oder Jean Baptist Wendling Flötenquartette schrieben. Selbst als die Hofkapelle nach München umsiedelte, wurde diese Tradition fortgeführt. -

MR 2292 DANZI Concert Piece.Qxp 19.02.2008 15:53 Seite 4
MR 2292 DANZI Concert Piece.qxp 19.02.2008 15:53 Seite 4 Preface Franz Danzi was baptised in Schwetzingen on 15 June 1763. His father was a cellist in the famous Mannheim orchestra, and Franz also joined the orchestra as cellist at the age of 15. After a spell as Kapellmeister in Stuttgart (where he became friends with Weber), Danzi moved to Karlsruhe in 1812. He died there on 13 April 1826. Danzi’s compositions covered the whole spectrum from opera, church music, orchestral works to chamber music. His works for clarinet include three solo pieces for clarinet and or- chestra, a concertante for clarinet and flute, a sonata for clarinet & piano, a sonata for bas- sethorn and piano and eight wind quintets (the works for which he is principally known today). The present work was published by Breitkopf & Härtel around 1813 and this arrangement for clarinet and piano is based on a copy of the original edition in the Deutsche Staatsbib- liothek in Berlin. The title page reads: “Pot-pourri pour la Clarinette avec accompagnement de deux Violons, Viola et Basse, Flûte, 2 Hautbois, 2 Bassons et 2 Cors ad libitum par F. Danzi, op. 45.” The wind parts do not add anything of melodic interest, but feature more or less entirely in the tuttis. The title of the work has here been changed to “Concert Piece No. 1” as Danzi’s later two “Pot-pourris” have already been published as “Concert Pieces Nos. 2 and 3.” There are very few dynamic markings in the original edition. In fact, the clarinet solo part contains only three (in mm. -

Reconsidering the Nineteenth-Century Potpourri: Johann Nepomuk Hummel’S Op
Reconsidering the Nineteenth-Century Potpourri: Johann Nepomuk Hummel’s Op. 94 for Viola and Orchestra A document submitted to The Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in the Performance Studies Division of the College-Conservatory of Music 2018 by Fan Yang B. M., Hong Kong Academy for Performing Arts, 2008 M. M., Hong Kong Academy for Performing Arts, 2010 D. M. A. Candidacy, University of Cincinnati, 2013 Abstract The Potpourri for Viola and Orchestra, Op. 94 by Johann Nepomuk Hummel is available in a heavily abridged edition, entitled Fantasy, which causes confusions and problems. To clarify this misperception and help performers choose between the two versions, this document identifies the timeline and sources that exist for Hummel’s Op. 94 and compares the two versions of this work, focusing on material from the Potpourri missing in the Fantasy, to determine in what ways it contributes to the original work. In addition, by examining historical definitions and composed examples of the genre as well as philosophical ideas about the faithfulness to a work—namely, idea of the early nineteenth-century work concept, Werktreue—as well as counter arguments, this research aims to rationalize the choice to perform the Fantasy or Potpourri according to varied situations and purposes, or even to suggest adopting or adapting the Potpourri into a new version. Consequently, a final goal is to spur a reconsideration of the potpourri genre, and encourage performers and audiences alike to include it in their learning and programming. -

Jan 25 to 31.Txt
CLASSIC CHOICES PLAYLIST January 25 - 31, 2021 PLAY DATE: Mon, 01/25/2021 6:02 AM Antonio Vivaldi Violin Concerto No. 10 "La Caccia" 6:11 AM Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 6:30 AM Claudio Monteverdi Madrigals Book 6: Qui rise, o Tirso 6:39 AM Henry Purcell Sonata No. 9 6:48 AM Franz Ignaz Beck Sinfonia 7:02 AM Francois Francoeur Cello Sonata 7:13 AM Wolfgang Amadeus Mozart Twelve Variations on a Minuet by Fischer 7:33 AM Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 2 7:41 AM Franz Danzi Horn Concerto 8:02 AM Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1 8:17 AM William Boyce Concerto Grosso 8:30 AM Ludwig Van Beethoven Symphony No. 8 9:05 AM Lowell Liebermann Piano Concerto No. 2 9:34 AM Walter Piston Divertimento 9:49 AM Frank E. Churchill/Ann Ronell Medley From Snow White & the 7 Dwarfs 10:00 AM Wolfgang Amadeus Mozart Eight Variations on "Laat ons Juichen, 10:07 AM Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 10:18 AM Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata No. 17 10:35 AM Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 10:50 AM Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for piano & orch 11:01 AM Louise Farrenc Quintet for piano, violin, viola, cello 11:31 AM John Alan Rose Piano Concerto, "Tolkien Tale" 12:00 PM Edward MacDowell Hamlet and Ophelia (1885) 12:15 PM Josef Strauss Music of the Spheres Waltz 12:26 PM Sir Paul McCartney A Leaf 12:39 PM Frank Bridge An Irish Melody, "The Londonderry Air" 12:49 PM Howard Shore The Return of the King: The Return of 1:01 PM Johannes Brahms Clarinet Quintet 1:41 PM Benjamin Britten Young Person's Guide to the Orchestra 2:00 PM Ferry Muhr Csardas No. -

Nov 30 to Dec 6.Txt
CLASSIC CHOICES PLAYLIST Nov. 30 - Dec. 6, 2020 PLAY DATE: Sun, 12/06/2020 6:02 AM Antonio Vivaldi Violin Concerto No. 11 6:14 AM Franz Joseph Haydn Baryton Trio No. 50 6:30 AM Georg Philipp Telemann Paris Sonata No. 1 6:43 AM (Johann) Michael Haydn Symphony No. 11 7:02 AM Arcangelo Corelli Concerto Grosso No. 2 7:14 AM John Field Piano Sonata 7:30 AM Johann Joachim Quantz Trio Sonata for 2 Transverse Flutes & BC 7:45 AM Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata No. 1 8:02 AM Jean-Philippe Rameau Concert No. 5 8:16 AM Johan Wilms Flute Concertino 8:34 AM Jules Massenet Suite No. 7: Scènes Alsaciennes 9:05 AM Joan Tower Concerto for Orchestra 9:35 AM Franz Schubert String Quartet No. 1 (in various keys) 9:53 AM Howard Shore The Two Towers: The King of the Golden 10:00 AM Wolfgang Amadeus Mozart Gallimathias musicum 10:06 AM Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata No. 21, K 304/300c 10:21 AM Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 4 10:32 AM Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 22 10:57 AM Wolfgang Amadeus Mozart Ave Verum Corpus 11:01 AM Franz Schubert Symphony No. 5 11:32 AM Ralph Vaughan Williams Concerto for two pianos and orchestra 12:00 PM Tomaso Albinoni Albinoni's Adagio 12:14 PM Aleksandr Glazunov The Seasons: Winter, Spring, Summer, 12:51 PM John Williams (Comp./Cond.) Seven Years in Tibet: Heinrich's Odyssey 1:01 PM Sir Edward Elgar In The South (Alassio) Overture 1:23 PM Johann Sebastian Bach Cello Suite No. -

Raphael Wallfisch
ALSO AVAILABLE BY RAPHAEL WALLFISCH ON NIMBUS Raphael Wallfisch NI 5763 Edward Elgar, Cello Concerto; Frank Bridge, Oration; Gustav Holst, Invocation Northern Chamber Orchestra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Richard Dickins conductor NI 5764/5 Dmitri Shostakovich, Complete works for cello BBC Symphony Orchestra, Martyn Brabbins conductor. John York piano NI 5471 Nicholas Maw, Sonata Notturna English String Orchestra, William Boughton conductor NI 5746 John Metcalf, Cello Symphony English Symphony Orchestra, William Boughton conductor NI 5741/2 Ludwig van Beethoven, Complete Sonatas and Variations for cello and piano John York piano NI 5806 Zemlinsky, Cello Sonata (1894); Sonatas by Korngold & Goldmark John York piano NI 5815 20th Century works for Cello and Strings Lutoslawski, Maconchy, Hindemith, Patterson, Kopytman Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, William Boughton conductor NI 5816 Serge Prokofiev, Concertino & Cinq Mélodies; Rodion Shchedrin, Parabola Concertante Southbank Sinfonia, Simon Over conductor Weber NI 5831 Rodion Shchedrin, Music for Cello and Piano Grand pot-pourri Rodion Shchedrin piano NI 5848 C.P.E Bach, Concertos for violoncello strings and basso continuo Spohr Scottish Ensemble, Jonathan Morton artistic director Concerto in A minor NI 5862 Frédéric Chopin, Cello Sonata; Sonatas by Simon Laks & Karol Szymanowski John York piano Reicha Concerto in A major 8 NI 5868 NI 5868 1 Raphael Wallfisch, cello Northern Chamber Orchestra Artistic Director and Leader, Nicholas Ward Louis Spohr (1784-1859) Violin Concerto no.8, in A minor Op.47 (1816) 22.40 ‘in modo di scena cantante’ arranged for cello by Friedrich Grützmacher Northern Chamber Orchestra 1 Allegro molto (recit.) 4.07 Artistic Director and Leader, Nicholas Ward 2 - Adagio—Andante 8.21 3 Allegro moderato 10.12 Formed in 1967, the Northern Chamber Orchestra, based in Manchester, has established itself as one of England’s finest chamber orchestras giving concerts and appearing throughout the British Franz Danzi (1763-1826) Isles. -

Aurora Wind Ensemble
TRURO 3 ARTS TRURO 3 ARTS Classical Music Society is pleased to continue in association Classical Music Society with Truro College to promote professional music in the region. Truro Three Arts is affiliated to the National Federation of Music Societies In association with COLLEGE and is a registered charity, Number 283130. President Ellen Winser MBE DL Mylor Theatre – Truro College Vice-President Juliet Lingham th Vice-President Tim German Friday 16 January 2015 Chairman David Fryer 01872 278350 Secretary Julie Bennett 07599 257833 Treasurer Hilary Dormon 01326 211821 Aurora Wind Proprietor Alex Taylor welcomes you to the Cutting Edge Salon, Falmouth. Ensemble "We offer a fantastic hairdressing experience in the glorious setting of Falmouth Marina, and we welcome both ladies and gents. "We pride ourselves on a dedicated customer base, with clients that return time and time again. Whether you’re looking for a quick trim or a complete transformation, our professional staff and relaxed environment makes the Cutting Edge an ideal place to unwind and simply enjoy the whole experience". The Marina 01326 212988 North Parade www.cuttingedgefalmouth.co.uk Falmouth [email protected] Sponsorship Truro 3 Arts is keen to encourage local organisations and businesses to become sponsors of the Society. With John Reid, piano An attractive benefits package includes complimentary tickets and publicity via our web site, brochure and concert programmes. www.truro3arts.co.uk Interested organisations requiring further details should contact Diana www.facebook.com/truro3arts Wharton in the first instance at [email protected] or on 01726 [email protected] 72570. Aurora Wind Ensemble Friday 6th February 2015 Established in 1996, the Aurora Ensemble is a traditional wind quintet which Gould Piano Trio also expands to work with piano, strings or to explore the repertoire for wind octet. -

Mon Trés Cher Pére! Munic Ce 24 Nov:Bre 1780.1
0542. MOZART TO HIS FATHER, SALZBURG Mon trés cher Pére! Munic ce 24 Nov:bre 1780.1 I received the packet and your last letter of the 20th in perfect order – Herr Schachtner2 shall receive 10 ducats for his trouble – I hope you will meanwhile have received the aria3 for Herr Schickaneder4 as well. – [5] I ask that my most submissive respects be conveyed to Mad:selle Catherine Gilofsky de Urazowa5 – and wish her on her name-day everything that is beautiful in my name; in particular I wish her that this may be the last time that one congratulates her as Mad:selle – – What you wrote to me regarding Count <Seinsheim6> has already been done a long time ago – [10] all of this hangs, of course, on the same chain. – I have already eaten with him once at midday; twice with <Baumgarten7> and once with <Lerchenfeld8> – of whom the <Baum etc. spouse> is a daughter. – Not a day passes without at least one of these people calling on Cannabich;9 – regarding <my opera10>, harbour no worries, my dearest father – I hope that everything will go entirely well. [15] – <a small cabal> will probably have it taken off – but they will probably make a very comical impression – for – among the <nobility> I have the <most respected> and <wealthiest families> – and the <leading court musicians> are all on my side – I cannot tell you what a great <friend Cannabich is to me>. – how <active> – <effective> – [20] in a word, he is <constantly alert> – when it comes down to doing <good 1 = “My very dear father. -

Margarethe Danzi Wolfgang Amadeus Mozart ANTOINETTE LOHMANN VAUGHAN SCHLEPP
FL72405-booklet+.indd, Spread 1 van 14 - Pagina’s (28, 1) 08-03-2007 09:28 Sonatas & Variations for Fortepiano and Violin Margarethe Danzi Wolfgang Amadeus Mozart ANTOINETTE LOHMANN VAUGHAN SCHLEPP FL A&R Challenge Records International: Anne de Jong Producer: Jean van Vugt Recording engineer: Onno Scholtze Recording date: March 2005, Dorpskerk, Bunnik (NL) Notes: Antoinette Lohmann Translations: Felicity Goodwin, Vaughan Schlepp, Tilman Skowroneck, Antoinette Lohmann Sleeve design & Cover photo: Marcel van den Broek Special thanks to: ThuisKopie Fonds FL72405-booklet+ ins.indd 1 08-03-2007 09:56:20 FL72405-booklet+.indd, Spread 2 van 14 - Pagina’s (2, 27) 08-03-2007 09:28 ALSO AVAILABLE: Joseph Martin Kraus: Sonatas & Trio Vaughan Schlepp, Antoinette Lohmann, Frank Wakelkamp FL72404 (2CD) “Antoinette Lohmann, who plays on an historical violin, is accompanied by Vaughan Schlepp on fortepiano. The dialogue between the two of them could almost be called symbiotic. The balance of their expressive phrasing is simply perfect”. “Antoinette Lohmann and Vaughan Schlepp explore the entire range of expressive possibilities with the utmost sensitivity and a keen sense for subtle nuance”. “What makes this recording so attractive right from the start is the directness of the sound quality. Listening to this outstanding reading with headphones reveals to an even greater extent the fine nuances, use of changes of colour and dynamic accents. The austere and yet unusually flexible sound of the historic instruments has been splendidly captured”. (www.klassik.com/magazin/review, april 2006) “This extensive project is performed with admirable competence by three well-matched musicians. Violinist Antoinette Lohmann in particular achieves an expressive spectrum and suggestive narrative power that lead the listener naturally through the works. -

The Offertories of Peter Von Winter: Critical Editions and Studies of Selected Works
THE OFFERTORIES OF PETER VON WINTER: CRITICAL EDITIONS AND STUDIES OF SELECTED WORKS BY JENNY ELIZABETH BENT DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in Music with a concentration in Choral Music in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2010 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Fred A. Stoltzfus, Chair Professor Charlotte Mattax Moersch, Director of Research Associate Professor Erik R. Lund Professor Emeritus Tom R. Ward ABSTRACT This is a comprehensive study of two offertories by Peter von Winter: Excelsus Super Omnes Gentes and Non Mortui Laudabunt Te. The critical editions included in this study were created through the transcription of manuscripts discovered at St. Vincent Archabbey in Latrobe, Pennsylvania and those found in the Noseda Collection at the Biblioteca Conservatorio Di Musica Giuseppe Verdi in Milan. ii To my mother, Joanne Carrigan iii ACKNOWLEDGMENTS This project was made possible with the help and support of many people. Special thanks to my committee at the University of Illinois at Urbana-Champaign (in alphabetical order): Erik Lund, Charlotte Mattax Moersch, Fred Stoltzfus, and Tom Ward. In particular, I wish to acknowledge my research adviser, Charlotte Mattax Moersch for her guidance and scholarship. Thank you to Father Jerome J. Purta, O.S.B., whose catalogued Wimmer Collection made this project possible. Thanks to John Wagstaff of the University of Illinois library, for lending his handwriting expertise and to Licia Sirch and the Biblioteca Conservatorio Di Musica Giuseppe Verdi in Milan for providing the MCS. Thanks to my dearest friend, Richard Robert Rossi, whose love, encouragement, and help cannot be measured.