Strategiespiele Und Das Medium-Werden Des Computers
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

DVD Program Notes
DVD Program Notes Part One: Thor Magnusson, Alex Click Nilson is a Swedish avant McLean, Nick Collins, Curators garde codisician and code-jockey. He has explored the live coding of human performers since such Curators’ Note early self-modifiying algorithmic text pieces as An Instructional Game [Editor’s note: The curators attempted for One to Many Musicians (1975). to write their Note in a collaborative, He is now actively involved with improvisatory fashion reminiscent Testing the Oxymoronic Potency of of live coding, and have left the Language Articulation Programmes document open for further interaction (TOPLAP), after being in the right from readers. See the following URL: bar (in Hamburg) at the right time (2 https://docs.google.com/document/d/ AM, 15 February 2004). He previously 1ESzQyd9vdBuKgzdukFNhfAAnGEg curated for Leonardo Music Journal LPgLlCe Mw8zf1Uw/edit?hl=en GB and the Swedish Journal of Berlin Hot &authkey=CM7zg90L&pli=1.] Drink Outlets. Alex McLean is a researcher in the area of programming languages for Figure 1. Sam Aaron. the arts, writing his PhD within the 1. Overtone—Sam Aaron Intelligent Sound and Music Systems more effectively and efficiently. He group at Goldsmiths College, and also In this video Sam gives a fast-paced has successfully applied these ideas working within the OAK group, Uni- introduction to a number of key and techniques in both industry versity of Sheffield. He is one-third of live-programming techniques such and academia. Currently, Sam the live-coding ambient-gabba-skiffle as triggering instruments, scheduling leads Improcess, a collaborative band Slub, who have been making future events, and synthesizer design. -

Weaponization of Artificial Intelligence (AI)
Disarmament and International Security Committee (DISEC) MUNUC 33 ONLINE 1 Disarmament and International Security Committee | MUNUC 33 Online TABLE OF CONTENTS ______________________________________________________ CHAIR LETTER…………………………….….………………………….….....…3 OVERVIEW OF DISEC……………..……………………..……………………..5 TOPIC A: BIOSECURITY…….…………...……..……………………………….6 Statement of the Problem……………….……………..…………...…6 History of the Problem………………………………………………….15 Past Actions…………………………………………………………….. 19 Possible Solutions………………………………………………………. 22 Bloc Positions……………………………………………………….……25 Glossary…………………………………………………………………..27 Bibliography……………………………………………………………..29 TOPIC B: WEAPONIZATION OF ARTIFICAL INTELLIGENCE…….………...32 Statement of the Problem……………….………...………………....32 History of the Problem………………………………………………….42 Past Actions…………………………………………………………….. 46 Possible Solutions………………………………………………………. 50 Bloc Positions……………………………………………………….……52 Glossary…………………………………………………………………..54 Bibliography…………………………………………………………..... 55 2 Disarmament and International Security Committee | MUNUC 33 Online CHAIR LETTER ____________________________________________________ Dear Delegates, Welcome to MUNUC 33 and the Disarmament and International Security Committee! My name is Joanna Zhuang, and I will be your chair for this committee this year. Before you start reading this background guide, I would like to introduce myself and talk about my expectations/advice for you and this committee. I was born in Shanghai, but I grew up in Vancouver, Canada. I am a second year at the College, -

Alan Turing's Automatic Computing Engine
5 Turing and the computer B. Jack Copeland and Diane Proudfoot The Turing machine In his first major publication, ‘On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem’ (1936), Turing introduced his abstract Turing machines.1 (Turing referred to these simply as ‘computing machines’— the American logician Alonzo Church dubbed them ‘Turing machines’.2) ‘On Computable Numbers’ pioneered the idea essential to the modern computer—the concept of controlling a computing machine’s operations by means of a program of coded instructions stored in the machine’s memory. This work had a profound influence on the development in the 1940s of the electronic stored-program digital computer—an influence often neglected or denied by historians of the computer. A Turing machine is an abstract conceptual model. It consists of a scanner and a limitless memory-tape. The tape is divided into squares, each of which may be blank or may bear a single symbol (‘0’or‘1’, for example, or some other symbol taken from a finite alphabet). The scanner moves back and forth through the memory, examining one square at a time (the ‘scanned square’). It reads the symbols on the tape and writes further symbols. The tape is both the memory and the vehicle for input and output. The tape may also contain a program of instructions. (Although the tape itself is limitless—Turing’s aim was to show that there are tasks that Turing machines cannot perform, even given unlimited working memory and unlimited time—any input inscribed on the tape must consist of a finite number of symbols.) A Turing machine has a small repertoire of basic operations: move left one square, move right one square, print, and change state. -

Feb. 12Th Typical Programs Involved the Kurzweil Calculation of Differential Equations in Small Steps, but This Born: Feb
with the ENIAC engineers, such as Arthur Burks [Oct 13]. Raymond C. Feb. 12th Typical programs involved the Kurzweil calculation of differential equations in small steps, but this Born: Feb. 12, 1948; Jacques Herbrand was complicated by the ENIAC’s Queens, New York Born: Feb. 12, 1908; ability to perform multiple Kurzweil is a well-known operations simultaneously, and Paris, France advocate for the futurist and the need for each piece of data Died: July 27, 1931 trans-humanist movements and instruction to reach the [March 30], and also a prolific Although Herbrand died when correct location in the circuitry inventor. He developed the first he was only 23 years old (in a inside a time interval of 1/5000 CCD flatbed scanner, the first mountain climbing accident), he omni-font optical character was already considered one of recognition software (1974), the the greatest mathematicians of first print-to-speech reading his generation. He worked machine for the blind (1976), primarily in the areas of the first commercial text-to- mathematical logic, but also had speech synthesizer (1996), and a significant influential on the the first commercially marketed development of recursive large-vocabulary speech functions. recognition system (1987). In 1934 when Kurt Gödel [April In 1965, he appeared on the CBS 28] introduced the notion of TV show “I’ve Got a Secret”, general recursive functions, he where he performed a piano noted that this idea had been piece that had been written by a suggested to him in the letter Kay McNulty (1938). Her high relay-based computer he had from Herbrand dated April 7, school graduation picture. -
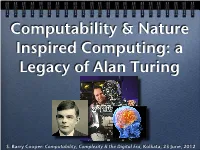
Computability and Nature Inspired Computing
Computability & Nature Inspired Computing: a Legacy of Alan Turing S. Barry Cooper: Computability, Complexity & the Digital Era, Kolkata, 23 June, 2012 In Pursuit of the Computable Newton - mathematics rules science - we look for computable natural laws ... - theories which computably predict ... When we say that we understand a group of natural phenomena, we mean that we have found a constructive theory which embraces them Albert Einstein: P.54, `Out of My Later Years’, 1950 2 Computation A familiar picture: Disembodied King’s College, Cambridge reading head which is 1936 - Turing’s machines in internal state q and obeys Turing program P Hardware trivial Actions simple ... 0011000... But compute ‘anything’ computable All the computing power lies tape, infinitely extendable in the program ... in each direction 3 A familiar picture: Computation reading head which is in internal state q and Disembodied obeys Turing program P ... 0011000... tape, infinitely extendable in each direction 4 Universality, and Programs as Data Turing, 1936: Build a UNIVERSAL TURING MACHINE, which can simulate ANY other machine An anticipation of the stored program computer A concept immediately understood by John von Neumann - as in his 1945 EDVAC report And ‘program as data’ key to the first computer ... 5 Universality, and Programs as Data First Draft of a Report on the EDVAC, 1945 The General and Logical Theory of Automata, based on talk at the Hixon Symposium, Pasadena, September 1948 John von Neumann A New Computing Paradigm ... The omnipotent computer - I am building a brain Functionalism and AI - stress what a computer does as something realisable in different hardware - Hilary Putnam: “Minds and Machines”, 1960 Virtual Machine (IBM, 1965)- software implementation of a programmable machine - JAVA, Unix Hilary Putnam 7 8 “What Is Computation?” - ACM UBIQUITY SYMPOSIUM: Computation Is Process by Dennis J Frailey: The concept of computation is the most dramatic advance in mathematical thinking of past century Church, Gödel, and Turing defined it in terms of mathematical functions .. -

PSCSF 25Th May 2017 Potential of AI and Future Local Government
PSCSF 25th May 2017 Potential of AI and future Local Government applications © Netcall 2017 Agenda • What is AI? • How has it been used in the Private Sector? • Where is it being used in the Public Sector? • Potential of AI and future Local Government Applications • Next steps © Netcall 2017 What is Artificial Intelligence? The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages. The AI term has evolved over the years, along with the underlying technologies. Examples of current, more-advanced forms of AI include deep learning (deep neural networks) and the allied area of Natural Language Processing. Many valuable and useful technologies that were once known as AI are now taken for granted. © Netcall 2017 State of the Art in 2017 Deep Learning (Deep Neural Networks): • Programming with models and data instead of code • Develop a many layered analytical model • Force feed it lots of data • Certify performance with a test dataset to rule out anticipatable error Natural Language Processing Gartner definition of Smart Machines: Smart machine technologies adapt their behaviour based on experience, are not totally dependent on instructions from people (they learn on their own) and are able to come up with unanticipated results. © Netcall 2017 Expectation Reset Machines: • Do not think, have common sense, understand, or set their own goals • Do not learn; they’re force-fed data • Are not self-aware, not conscious Consistently Mis-Setting Expectations for over 50 years © Netcall 2017 AI in the 1950s 1951 The first working AI programs were written in 1951 to run on the Ferranti Mark 1 machine of the University of Manchester: a checkers-playing program written by Christopher Strachey and a chess-playing program written by Dietrich Prinz. -

Thesis Roberto Musa
Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Psicología MYTHS, TESTS AND GAMES: CULTURAL ROOTS AND CURRENT ROUTES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE By Roberto Musa Giuliano Thesis submitted to the Office of Research and Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Psychology. Advisor: Carlos Cornejo Alarcón Thesis Committee: Francisco Ceric Garrido Ricardo Rosas Díaz September, 2019 Santiago, Chile © 2019, Roberto Musa Giuliano To my parents, Tulia Giuliano Burrows and Roberto Musa Cavallé 1 Words of Thanks What pleasant news to learn that the health benefits of gratitude are legion, or so wellness gurus assure us, since the struggling writer, having at last ceased in his toil, is bound by a sacred moral duty to attempt the issuance of thanks where they are due, no matter how little faith he might place in his ability to be either fair or exhaustive. (This would certainly account for the prefatory remerciement slowly inching its way into becoming a full-fledged literary genre in its own right.) A beneficial side-effect of trying to be comprehensive in acknowledging our incurred debts, is that all those readers not mentioned therein, but who nevertheless move through things page by page and from start to finish, shall arrive at the actual flesh of the text and find it delightfully entertaining by contrast to the dilatory list of names entirely unfamiliar. For their role (which I hope they don’t end up coming to abhor) in the course of my intellectual meanderings I must mention the following formative figures: I thank Enrique Vega for instilling in me an early love of philosophical thinking, and illustrating the subtle nuances that distinguish peripatetic discussions from vagabonding. -

PSPACE CPS534, Spring 2021 Wednesday, February 17
Recitation 2: PSPACE CPS534, Spring 2021 Wednesday, February 17 Slides by Dan Fu Outline • 2/24 Exam info • Quick review • PSPACE • PSPACE-Completeness • QBF and TQBF • Chess AI Exam Details • February 24 • Time TBA? • 60 minutes + 15 minutes scanning time • Handwritten, then upload to Gradescope • Will cover • Finite state automata • Context free languages • Diagonalization • Undecideability Finite State Automata • From and to TM tape, language a b • States and state transitions • What FSM accepts 푎푛푏푛 ? q0 b → b, L a → a,R → ,L q1 Prof. Busch - LSU Context Free Languages • Is or isn’t • Pumping lemma • Pushdown automata • Context free grammar • Production rules • e.g. 푆 → 푎푆 • Remember to start empty e.g. 푆 → 휀 Diagonalization & Undecideability • Countable and uncountable sets • Halting problem • How is diagonlization used with undecideability? • Undecideability – no TM accepts this language From Complexity Lectures by Busch PSPACE • Languages that can be solved with a Turing Machine that uses space (total # cells) that is polynomial to the size of the input (# cells in the input string) • Time complexity: P and NP • Space complexity: PSPACE and NPSPACE • NPSPACE = PSPACE • Savitch’s Theorem, a deterministic machine will only use at most the space of a nondeterministic machine, squared. • NSPACE(S (n)) ⊆ SPACE(S n 2) PSPACE • w.r.t the other classes we’ve seen, it should look like this PSPACE-Complete • A PSPACE-Complete problem is PSPACE and every other PSPACE problem can be transformed to it in polynomial time. • Hardest problems of PSPACE Poll: What makes PSPACE problems difficult? A. Its circle is bigger than the one for NP problems B. -
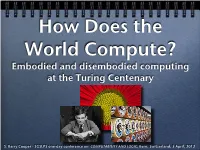
Alan Turing 1912-1954
How Does the World Compute? Embodied and disembodied computing at the Turing Centenary S. Barry Cooper - SGSLPS one-day conference on COMPUTABILITY AND LOGIC, Bern, Switzerland, 5 April, 2012 Alan Turing 1912-1954 By sculptor Glyn Hughes,unveiled June23, 2001 Former home of Turing, Holly Mead, Adlington Road,Wilmslow Holly Mead, Turing, Former home of 2 Pushing Back the Incomputable - Ten Big Ideas The Turing Machine Exploring Incomputability Programs as Data Computing with Oracles Embodied Computing Modelling the Brain Cryptography & Enigma The Turing Test & AI Unsolvable Problems Morphogenesis 3 In Pursuit of the Computable Newton onwards - mathematics rules science - we look for computable natural laws ... - theories which computably predict ... - try to capture truth via proofs ... When we say that we understand a group of natural phenomena, we mean that we have found a constructive theory which embraces them Albert Einstein: P.54, `Out of My Later Years’, 1950 4 1. Computation DisembodiedA familiar picture: reading head which is 1936 - Turing’s machines in internal state q and obeys Turing program P Hardware trivial Actions simple ... 0011000... But compute ‘anything’ computable All the computing power lies tape, infinitely extendable in the program ... in each direction 5 6 What does this Turing machine compute? 7 8 What does this Turing machine compute? 9 1. Computation DisembodiedA familiar picture: reading head which is in internal state q and obeys Turing program P ... 0011000... tape, infinitely extendable in each direction 10 A familiar picture: reading head which is in internal state q and 1. Computation obeys Turing program P Disembodied ... 0011000... tape, infinitely extendable in each direction 11 2. -
Breakdown When Our Efforts Fail and Our Systems Collapse
Dartmouth Undergraduate Journal of Science DUJS WINTER 2014 | VOL. XVI | NO. 2 BREAKDOWN When our efforts fail and our systems collapse Global Climate Superluminal Game of Change Neutrinos Chess Featuring Erich Osterberg, Ph.D. Mistakes from the 21st Century The Revenge of Deep Blue p. 3 p. 9 p. 43 Photo credit: m00osfoto/Shutterstock The Dartmouth Undergraduate Journal of Science aims to increase scientific awareness within the Note from the Editorial Board Dartmouth community by providing an interdisciplinary forum for sharing undergraduate research and enriching scientific knowledge. Dear Reader, EDITORIAL BOARD President: Derek Racine ‘14 We have always celebrated humanity’s accomplishments. And, indeed, there is much to praise; Editor-in-Chief: Rui Shu ‘15 within just the past century, we have uncovered the secrets of relativity, designed vaccinations Managing Editors: Steven Chen ‘15, Scott that protect us from innumerable diseases, and created a global system of computer networks that Gladstone ‘15, Barry Chen ‘16, Shinri Kamei ‘16 connects the entire human race. We celebrated these achievements in earnest and elevated the Assistant Editors: Tessa Streeter ‘14, Yi (Annie) innovators behind these discoveries and inventions to the statuses of champions. But in glorifying Sun ‘16, Na Oh ‘16, Stephanie Alden ‘16 Design Editors: Jocelyn Shyong ‘16, these moments of triumph, we often obscure the mountain of failures that served as stepping Rebecca Xu ‘15 stones toward each success and misrepresent the road to success as one that is simple and smooth Web Development Team: Steven Chen ‘15, in its progression. In reality, the road to success is winding, difficult—often with no clear end in Shawn (Yifei) Xie ‘16 Director of Publicity: Carrie Wolf ‘15 sight and very little sense of progress. -

Structure and Interpretation of Alan Turing's Imitation Game / Bernardo Nunes Gonçalves ; Orientador Edelcio G
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA Bernardo Gonçalves Machines will think: structure and interpretation of Alan Turing’s imitation game São Paulo 2020 Bernardo Gonçalves Machines will think: structure and interpretation of Alan Turing’s imitation game Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Filosofia do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu- manas da Universidade de São Paulo. Supervisor: Prof. Dr. Edelcio de Souza São Paulo 2020 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo Gonçalves, Bernardo Nunes Gm Machines will think: structure and interpretation of Alan Turing's imitation game / Bernardo Nunes Gonçalves ; orientador Edelcio G. de Souza. - São Paulo, 2020. 289 f. Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Departamento de Filosofia. Área de concentração: Filosofia. 1. Alan Turing. 2. Can machines think?. 3. The imitation game. 4. Thought experiment. 5. Artificial intelligence. I. de Souza, Edelcio G., orient. II. Título. Bernardo Gonçalves Machines will think: structure and interpretation of Alan Turing’s imitation game Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Filosofia do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu- manas da Universidade de São Paulo. Trabalho depositado. São Paulo, 10 de dezembro de 2020: Prof. -

Alan Turing (1912-1954)
Alan Turing (1912-1954) El día 23 de Junio de 2012, se celebró el centenario del nacimiento de Alan Turing, por eso en Gran Bretaña 2012 ha sido denominado como AÑO TURING, apareciendo en la prensa de tanto nacional como internacional multitud de reseñas biográficas de este increíble sabio, uno de los padres de la Ciencia de la computación, precursor de la informática moderna,. Nacido en Londres 23 el 1912 de junio se educo en Sherborne School en Dorset y en el King College de Cambridge, graduándose en 1934 con el grado en Matemáticas. Al final del milenio, 45 años después de su muerte, el Magazine del Times lo incluyo entre las 100 más importantes mentes del siglo XX, junto a los hermanos Wright, Albert Einstein, los investigadores sobre el ADN Crick y Watson, y el descubridor de penicilina Sir Alexander Fleming. Los logros de Turing durante su corta vida fueron legión. El más conocido en general fue su participación en la des-encriptación de la maquina Enigma alemana durante la guerra de 1939-45 pero Turing también fue el padre de la computadora moderna. Hoy, todos los que usan computadoras y derivados están familiarizados con el impacto de sus ideas. A él nosotros debemos la innovación inteligente de guardar las aplicaciones, y los programas necesarios para que las computadoras cumplan nuestras órdenes, dentro de su memoria, dispuestos para ser abiertos y utilizados. Cuando el término 'computar' solo significaba un ser humano sentado en un escritorio haciendo cálculos a mano, Turing encaro 'la máquina de la informática universal' cuya función podría transformarse fácilmente del procesador de texto a la calculadora del escritorio, o al antagonista del ajedrez -dándonos la posibilidad para el uso de un programa-.