Berliner Umland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
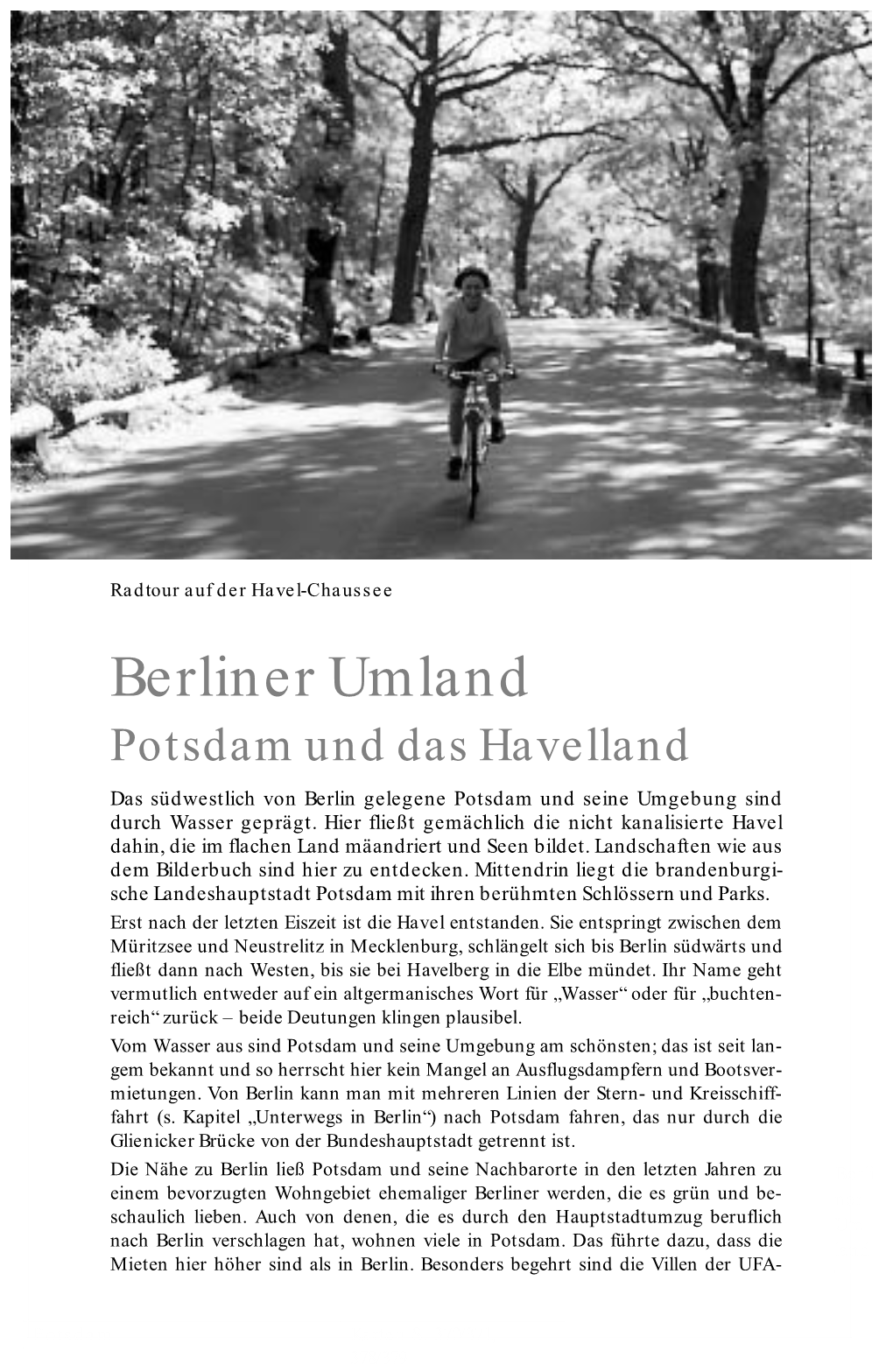
Load more
Recommended publications
-

GROUP TRAVEL Discover Cities Enjoy Nature Experience Culture Active Relaxation a Warm-Hearted Wl E Come
BAD REICHENHALL MUNICH LEONBERG/STUTTGART ALKEN/MOSEL HILDEN/DÜssELDORF BERLIN CHEMNITZ HOLIDAY DESTINATION GERMANY GROUP TRAVEL Discover cities Enjoy nature Experience culture Active relaxation A warm-hearted WL E COME D ear travel partner, Dear guests, Countryside or culture? City or landscapes? Culinary delights or active holidays? Different travel groups have different needs. It doesn’t matter for which season you are planning a trip, Germany offers a wide range of interesting places and entertainment for all ages all year round. All sights and destinations shown on the next pages are easily accessible with your own vehicle from the AMBER HOTELS and partner hotels. Your travellers will also feel thoroughly pampered in the 3 and 4 star hotels. As well as friendly staff all hotels offer great comfort and tasty choices in the restaurants. You can be sure to have the same quality even if you travel from hotel to hotel on your tours. Email me the cornerstones of you trip and you will receive an offer asap. With kind regards AMBER HOTELS Christian Röder Sales Manager Leisure [email protected] Direct contact: mobile +49 1520 6289001 Contact address: AMBER HOTELS Leisure, Schwanenstraße 27, 40721 Hilden, Germany +49 2103 503-100, -444, [email protected] Stay informed! Sign up for the AMBER newsletter for group travel (in German)! 4x to 6x a year you will receive news of the hotels and regions. Interesting basics for your tours! www.amber-hotels.de/gruppen/newsletter-gruppe/ Important notice: The tips and destina- AMBER TIP: tions on the following pages are a choice of F UN AND DANCE IN CHEMNITZ suggestions. -

Inhaltsverzeichnis Table of Contents
Inhaltsverzeichnis Table of Contents Schlösser, Parks und Gärten in Berlin und Brandenburg Palaces, Parks and Gardens in Berlin and Brandenburg 6 Königliche Schlösser der Hohenzollern Hohenzollern Royal Palaces 8 Der preußische Landadel Prussian Landed Gentry 24 Klosteranlagen in Brandenburg Monasteries in Brandenburg 40 Zeitgenössische und moderne Gartenanlagen Contemporary and Modern Parks and Gardens 44 Gartenrouten durch Brandenburg Garden Routes through Brandenburg 48 Wo der Urlaub regiert … Schlosshotels in Brandenburg Holiday like a King … Hotels in Palaces in Brandenburg 58 Impressum/Imprint Herausgeber/Publisher Übersetzung/Translation Wolfgang Pfauder; Stiftung Schloss Neuhar- TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH TITELBILD, Subtitling and Translation GmbH denberg/Toma Babovic; TMB-Fotoarchiv/Bach, Am Neuen Markt 1 – Kabinetthaus Boettcher, Boldt, Broneske, Ehn, Hannemann, Fotos/Photos D–14467 Potsdam Hirsch, Korall, Werk; Weiße Flotte Potsdam; Bischofsresidenz Burg Ziesar; Brandenburgische www.cap-pr.de Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums Schlösser GmbH; Gerd Foth; Sandra Frese; Katja für Wirtschaft des Landes Brandenburg. Gragert; Havelländische Musikfestspiele; Michael Karten/Maps With the friendly support of the Ministry Helbig; Jürgen Hohmuth/zeitort.de; Kavalier- kontur GbR, Berlin of Economics of the State of Brandenburg. Häuser Schloss Königs Wusterhausen; Kloster Druck/Printing Lehnin; Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf; Konzeption/Conception Brandenburgische Universitätsdruckerei TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Land Berlin/Thie; Museumsdorf Glashütte e. V.; und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Golm Jürgen Rochell/FACE; Rochow-Museum Reckahn; Redaktion, Realisierung, Gestaltung Schloss Kleßen/Zimmermann; Schloss Meyen- Alle Angaben ohne Gewähr. Editing, realisation, layout burg; Schloss und Gut Liebenberg; Schlossgut No responsibility for the correctness of this Runze & Casper Werbeagentur GmbH, Alt Madlitz GmbH & Co. KG; Stadt Forst (Lau- information. -

Berlin Travel Guide
BERLIN TRAVEL GUIDE Made by Dorling Kindersley 29. March 2010 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Highlights Berlin Travel Guide Highlights Brandenburger Tor & Pariser Platz The best known of Berlin’s symbols, the Brandenburg Gate stands proudly in the middle of Pariser Platz, asserting itself against the hyper-modern embassy buildings that now surround it. Crowned by its triumphant Quadriga sculpture, the famous Gate has long been a focal point in Berlin’s history: rulers and statesmen, military parades and demonstrations – all have felt compelled to march through the Brandenburger Tor. www.berlin.de/tourismus/sehenswuerdigkeiten.en/00022.html For more on historical architecture in Berlin (see Historic Buildings) restaurant and a souvenir shop around a pleasantly Top 10 Sights shaded courtyard. Brandenburger Tor Eugen-Gutmann-Haus 1 Since its restoration in 2002, Berlin’s symbol is now 8 With its clean lines, the Dresdner Bank, built in the lit up more brightly than ever before. Built by Carl G round by the Hamburg architects’ team gmp in 1996–7, Langhans in 1789–91 and modelled on the temple recalls the style of the New Sobriety movement of the porticos of ancient Athens, the Gate has, since the 19th 1920s. In front of the building, which serves as the Berlin century, been the backdrop for many events in the city’s headquarters of the Dresdner Bank, stands the famous turbulent history. original street sign for the Pariser Platz. Quadriga Haus Liebermann 2 The sculpture, 6 m (20 ft) high above the Gate, was 9 Josef Paul Kleihues erected this building at the north created in 1794 by Johann Gottfried Schadow as a end of the Brandenburger Tor in 1996–8, faithfully symbol of peace. -

[email protected]
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 26.10.2015 Bibliothek / Sabine Hahn, Kristin Laue Tel. 0331 / 9694 636 Email: [email protected] Liste der von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg herausgegebenen Publikationen 2015 Frauensache : wie Brandenburg Preußen wurde ; Ausstellung im Theaterbau von Schloß Charlottenburg, Berlin, 22. August bis 22. November 2015. Dresden : Sandstein, 2015. - 312 S. ISBN 978-3-95498-142-7 Jagdschloss Grunewald Berlin [u.a.] : Dt. Kunstverlag, 2015. - 46 S. ISBN 978-3-422-04033-5 Das Marmorpalais im Neuen Garten. Berlin [u.a.]: Dt. Kunstverl., 2015. - 45 S. ISBN 978-3-422-04034-2 Park Sanssouci für Kinder. Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2015. - 24 S. ISBN 978-3-422-04039-7 2014 Friedrich Wilhelm IV von Preußen ; hrsg. von Jörg Meiner und Jan Werquet. Berlin : Lukas Verlag, 2014. - 166 S. ISBN - 978-3-86732-176-1 Königliche Gartenlust im Park Sanssouci : Inszenierung, Ernte und Genuss. Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2014. - 128 S. ISBN - 978-3-422-07249-7 Sanssouci : Park. Schlösser. Bauten / Michael Zajonz. München : Prestel, 2014. - 64 S. ISBN 978-3-7913-5372-2 Schloss Cecilienhof. Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2014. - 48 S. : Ill. ISBN - 978-3-422-02388-8 Historische Gärten im Klimawandel : Empfehlungen zur Bewahrung ; zur Internationalen Fachtagung "Historische Gärten im Klimawandel" vom 4. bis 6. September 2014 in Potsdam-Sanssouci und dem Nikolaisaal Potsdam. Leipzig : Ed. Leipzig, 2014. - 367 S. 1 ISBN - 978-3-361-00700-0 Seiden in den preußischen Schlössern : Ausstattungstextilien und Posamente unter Friedrich II. (1740-1786) / Susanne Evers, mit Beitr. Von von Petra Raschkewitz und Friederike Wappenschmidt… Berlin : Akad.-Verl., 2014. -

V Orpommern Mecklenburg- Saxo N Y-A N H a Lt S a X O Ny Saxony Lower S Axony
ö Schloßsee r Dr k See ewitzer a See n W Torgelower a l a rn See Randow ow Neubrandenburg Tiefwaren- see Strasburg Pasewalk Fleesensee Kölpinsee Waren Penzlin Tollensesee Malchower See Burg Stargard Plauer Randow Wasserstraße See Malchow Rederang- Woldegk Lübz see Jezioro Dabie Plau Lieps Lemmersdorf Haus- Szczecin (Dammscher See) see Müritz- Eide- Specker RE3 Löcknitz Parchim See Trebenow (Stettin) Hofsee Jagow Müritz Priesterhäker See Käbelick- Göritz Brüssow see Damm- see Schönfeld Großer Fürstenwerder Carmzow Rödiner See 20 Neustadt- Zotzen- See see Dedelow Woterfitz- RB66 Glewe see Treptowsee Neustrelitz Großer Zierker See Breiter Parmensee Luzinsee Quillow Großer Schapow Ludwigsburg KrotzowerM Haussee Parmen See Useriner Ludwigslust See Massower N ü See r Feldberg a i Schönermark t t 11 Granzower i z - k Fürstenseer Weggun Prenzlau Meyenburg Möschen o n p a r See Gollmitz a l Randow 24 - Großer Carwitzer Eickstedt Labussee See Freyenstein M Woblitz- üri M tz see elle Odra Grabow G- nse H a e Schmölln ve Mirower R l- Strom K Unter- an See U al uckersee Nebel Thomsdorf Stepenitz B Wesenberg M E N Hardenbeck m a r Mescherin Gryfino E L Drewensee Tantow Gerdshagen Halenbeck C k K Mirow r Petershagen Putlitz N Rätzsee k Boitzenburg Haussee (Greifenhagen) Berge Wulfersdorf r R Zotzensee Großer e Wartin Groß E Retzow a Lützlow Piepertsee Luckow Gartz Rohlsdorf Groß rinsee Warnow Pirow M Wurlsee er Küst p k Potzlow Schwarzer Gr. Blankenburg RB74 Berlinchen See (Oder) Dosse M Thymen- V Gr. 2 RE5 r Warthesee O see n Dallmin O Radrouten Pröttlin P Baalsee R Historische Stadtkerne Kuhzer See Viltzsee c Hohenselchow 19 Labussee Lychen u Haßleben Dranse Großmenow e Großer Garlin t Potzlowsee Gramzow Dranser Labussee Ravensbrück Gr. -

Model Capital Region Berlin-Brandenburg Legal Notice
Model Capital Region Berlin-Brandenburg Legal Notice Editor: Joint Berlin-Brandenburg Planning Department Lindenstraße 34 a 14467 Potsdam Referat GL 9 www.metropolregion-berlin-brandenburg.de Editorial Office: Planungsgruppe 4 GmbH Joachim-Friedrich-Straße 37 10711 Berlin Layout: UVA Kommunikation und Medien GmbH Karl-Marx-Straße 66 14482 Potsdam Printing: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH Karl-Liebknecht-Straße 24–25 14476 Potsdam This brochure has been published by the Joint Berlin- Brandenburg Planning Department. It may not be used by parties or candidates for the purpose of election campaigning. Forwarding its contents to third parties for the purpose of campaigning is also prohibited. Potsdam, August 2006 3 Foreword 5 Berlin and Brandenburg Issue a Model 6 We Complement Each Other 8 In the Midst of Europe 10 We Are Cosmopolitan 12 A Strong Capital for the Region 14 Knowledge is Our Raw Material 16 Our Economy is Innovative and Flexible 18 We Live Culture 20 Quality of Life is Our Strength 22 We Take Responsibility 24 Developing the Model The Capital Region Berlin-Brandenburg has already become reality in many of the sectors that hold great potential for the future. Both states are already reaping the benefits of networking in science and advanced technologies, in the film and media industries and in the health-care sector. They have strong international appeal and are perceived as one unified region. Berlin and Brandenburg have been working together for some time, not only in business development, but also in many other administrative areas. Together we are a high-growth knowledge and science region with a high quality of life for all its residents. -

Group Travel 2019
GROUP TRAVEL 2019 Holiday Destination Germany DISCOVER CITIES ENJOY NATURE EXPERIENCE CULTURE ACTIVE RELAXATION BERLIN MUNICH BAD REICHENHALL LEONBERG/STUTTGART CHEMNITZ HILDEN/DÜSSELDORF Dear travel partners, The charming mix of bustling cities, lively customs, tourist attractions, historic and cultural sites, vast parks and unspoilt landscapes makes Germany the leading travel destination in all of Europe. The six 3* Superior AMBER ECONTELS and 4* AMBER HOTELS are located in Germany‘s most beautiful regions. Using these venues as a base you can make trips to the country‘s most popular travel destinations all year round. The comfortable convenience in the hotels, delicious regional dishes and our attentive service ensure that you and your attendees feel completely at home in the hotels. Do you already have dates in mind? Let‘s discuss and arrange the details! We look forward to you contacting us. Your AMBER HOTELS groups department Please call us! 053 +49 30 34681- [email protected] +49 30 34681-0 (-053), +49 30 34681-063 AMBER HOTELS Gruppenabteilung, ECONTEL HOTEL Berlin Charlottenburg, Sömmeringstr. 24-26, 10589 Berlin, Germany MUNICH BAD REICHENHALL Index page Highlight 2019 Price information/GTC ..........................2 Legend ...............................................2 Photo credits cover front .......................2 Highlights 2019 ...............................2-3 In the footsteps of the Fairytale King, Ludwig II Bad Reichenhall ..................................4 Munich ...............................................5 Berlin .................................................6 Chemnitz ............................................7 Ludwig II wasn‘t just the »Fairytale Leonberg/Stuttgart ..............................8 King« who is said to have lived in Hilden/Düsseldorf ...............................9 his own little dream world - he was Experience culture, Enjoy nature also a man with a wide range of Discover cities, Aktive relaxation ....10-13 interests. -

SPSG-Jahresbericht 2011
JAHRESBERICHT 2011 STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG JAHRESBERICHT 2011 Seite 2 INHALT I. AUS DER ARBEIT DER STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG IM JAHR 2011 . 3 1 Allgemeine und wirtschaftliche Rahmenbedingungen . 3 1.1 Einnahmen und Spenden . 3 1.2 Personal . 5 1.3 Liegenschaften . 7 1.4 Justitiariat . 7 2 Investitions- und Restaurierungsmaßnahmen . 8 2.1 Baudenkmalpflege . 8 2.2 Gartendenkmalpflege . 10 2.3 Restaurierungen . 11 3 Neuerwerbungen . 14 4 Ausstellungen und wissenschaftliche Projekte . 17 4.1 Ausstellungen . 17 4.2 Ausblick 2012: Jubiläumsausstellung FRIEDERISIKO . 20 4.3 Forschung und Stiftungskolloquien . 21 4.4 Provenienzforschung . 22 4.4.1 Restitution Kriegsverluste . 23 5 Besucherentwicklung und Marketing . 24 5.1 Besucherentwicklung . 24 5.2 Marketing . 24 5.2.1 Veranstaltungshöhepunkte . 25 5.2.2 Kampagnen und Projekte . 28 5.2.3 Neue Angebote Bereich Kulturelle Bildung . 30 6 Fridericus – Servicegesellschaft . 31 II. CHRONIK . 32 1 Neuerwerbungen . 32 2 Neueinrichtungen . 37 3 Ausstellungen . 37 4 Tagungen . 38 5 Veranstaltungen . 39 6 Publikationen der SPSG . 45 7 Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SPSG . 47 8 Organe und Gremien . 51 IMPRESSUM Herausgeber und ©: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Redaktion und Bildauswahl: Ortrun Egelkraut, Text Neuerwerbungen: Dr. Samuel Wittwer Gestaltung: Grit Schmiedl Titelbild: Neues Palais (Foto: Hans Bach) www.spsg.de STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG ALLGEMEINE UND WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 2011 Seite 3 I. AUS DER ARBEIT DER STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG IM JAHR 2011 Der Rechenschaftsbericht der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) für das Jahr 2011 vermittelt einen Überblick über allgemeine Stiftungsentwicklungen, wirtschaftliche Aspekte, Bau- und Restaurierungsarbeiten, Ausstellungen, Veranstaltungen und Neuerwerbungen sowie über die Besucherentwicklung und das Stiftungsmarketing. -

SPSG Jahresbericht 2017
STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG 1 JAHRESBERICHT 2017 JAHRESBERICHT 2017 VORWORT Wer das „sogenannte Unmögliche“ möglich machen wolle, brauche zweierlei, schrieb Hermann Fürst von Pückler-Muskau in seinen 1834 erschienenen „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei“: Geduld und einen festen Willen. Ihm selbst hat es an beidem offen sichtlich nicht gemangelt. Sonst wäre der Park Babelsberg in Potsdam nicht gewor- den, was er heute ist: Denn es war Pückler, der hier 1843 Peter Joseph Lenné als Garten- architekt abgelöst und in königlichem Auftrag bis in die 1860er Jahre hinein jede Weg- biegung, jede Bodenwelle, jede Baumpflanzung, jeden Blick sorgfältig inszeniert und auf diese Weise ein einzigartiges Gesamtkunstwerk komponiert hat. An diese Gestaltungs- leistung erinnerte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) 2017 mit ihrer im Schloss und im Park Babelsberg ausgerichteten Ausstellung „Pückler. Babelsberg – Der grüne Fürst und die Kaiserin“ – und konnte sich über 72.392 Besucherinnen und Besucher freuen. Das war, was die Besuchszahlen betrifft, ein in dieser Höhe unerwarteter und deshalb umso schönerer Erfolg. Ein Erfolg, der jedoch ohne das Sonderinvestitionsprogramm für die preußischen Schlösser und Gärten (Masterplan), das der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg für die Jahre 2008 bis 2017 zur Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Schlösserlandschaft aufgelegt haben, nicht denkbar gewesen wäre. Dank dieser Mittel konnten 2015 die Hüllensanierung des Schlosses Babelsberg abgeschlossen und 2016 die Brunnen und Wasserspiele im Park wieder in Betrieb ge- nommen werden. Insgesamt hat die SPSG seit 2008 für rund 165 Millionen Euro dringend not wendige Sanierungsmaßnahmen beginnen, fortsetzen und beenden können. Mithin stand auch das Arbeitsjahr 2017 ganz im Zeichen der Fortführung dieses Master- plans, wurden 19,9 Millionen Euro in Wiederherstellungs- oder Neubauprojekte inves- tiert. -

Und Öffentlichkeitsarbeit Heinr
PUBLISHING INFORMATION Published by: Staatskanzlei des Landes Brandenburg Abteilung 3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Heinrich-Mann-Allee 107 | D-14473 Potsdam Telefon: +49 (0) 331 866-0 | [email protected] www.brandenburg.de | facebook: unser brandenburg Legally responsible for content as per German Press Law: Government Spokesman Florian Engels Texts: Tobias Dürr, Florian Engels, Gerlinde Krahnert A red eagle on a white and red Layout: Schuetz Brandcom GmbH, Berlin background: The flag of the federal Print: Koch Druck, Am Sülzegraben 28, state of Brandenburg D-38820 Halberstadt Translation for the English and Polish issues: Alpha Translation Service GmbH, Berlin Editing: Tobias Dürr (english); Markus Mildenberger (polish) 1st Edition, September 2017 PICTURE CREDITS Yorck Maecke/U. Gatz/TMB-Fotoarchiv Schloss Babelsberg (Potsdam) with Havel p 1 + 48 | Shutterstock p 1 top (t.), 5 t., 8 + 9, 10 bottom (b.), 14, 15 bottom left (b. l.), 18. + 19., 25 top left (t. l.), 34 + 35 t. l. + top right (t. r.), 47 r. | Die Hoffotografen p 3 | Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH p 4 + 5 | Paul Hahn/TMB-Fotoarchiv p 5 b. | Stephanie Hochberg p 5 centre (c.),16, 21 b. l., 25 t. r., 31 bottom right (b. r.), 42 + 43, 45 t. r. | Bernd Geller p 6 | brandenburg.de p 6 Portrait (po.), 8 po., 12 po., 43 po., 47 po., 21 b. l. | Frank Lieb- ke/TMB-Fotoarchiv p 7 l., 22 + 23 | Ulf Böttcher/TMB-Fotoarchiv p 7 r. | Schütz Brandcom p 9 r., 11 b. l., 46 | Jan Wischnewski Photography p. 10 b. | Gabriele Boiselle p 11 bottom centre (b. -

6 Königsgärten in Berlin Und Brandenburg 12 Jagdschloss
6 Königsgärten in Berlin und Brandenburg 95 Im Paradiesgarten 97 Das Drachenhaus 12 Jagdschloss Grunewald 97 Schloss Lindstedt 101 Verlorene Gärten am Neuen Palais 16 Schloss Oranienburg 106 Der Freundschaftstempel 106 Ein Denkmal fur Lenné und für die Gartenkunst 18 Schloss Caputh 108 Die Gärtnerei am Kuhtor 113 Die Römischen Bäder und Charlottenhof 20 Schloss Charlottenburg 113 Römische Bäder 28 Das Mausoleum in Charlottenburg 119 Schloss Charlottenhof 32 Schloss Königs Wusterhausen 130 Der Neue Garten 134 Das Marmorpalais 34 Schloss Rheinsberg 144 Schloss Cecilienhof 48 Schloss Sanssouci 146 Die Pfaueninsel 50 Am Obeliskportal 54 Der Holländische Garten vor der Bildergalerie 158 Schloss Paretz 54 Die Friedenskirche 58 Im Marlygarten 160 Schloss Glienicke 66 Das Weinbergschloss 74 Das Chinesische Haus 174 Schloss Babelsberg 76 Das Orangerierondell 80 Im Sizilianischen und Nordischen Garten 186 Das Belvedere auf dem Pfinosthara 82 Via triumphalis - die Triumphstraße 88 Die Jubiläumsfontäne 188 Schloss Sacrow Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/999283987 oiïterïts 6 Royal Parks in Berlin and Brandenburg 95 The Paradise Garden 97 The Dragons' House 12 Grunewald Hunting Lodge 97 Lindstedt Palace 101 Lost Gardens beside the New Palace 16 Oranienburg Palace 106 The Temple of Friendship 106 A Monument to Lenné and the Art of Gardening 18 Caputh Palace 108 Kuhtor Nursery 113 The Roman Baths and Charlottenhof Palace 20 Charlottenburg Palace 113 The Roman Baths 28 The Mausoleum in Charlottenburg Park 119 Charlottenhof -

Prussian Palaces and Gardens in Berlin
English Version PALACES AND GARDENS IN BRANDENBURG HOW TO GET THERE Rheinsberg Palace Roman Baths 26 RHEINSBERG PALACE AND PARK A Disabled access Berlin-Brandenburg COMBINED TICKETS VOLUNTARY PARK ADMISSION PotsdamPotsdam PALACES AND GARDENS Frederick the Great spent his youth at Rheins- Templin Krampnitzer Str. C Some disabled access 26 Schloss Rheinsberg berg. Rebuilt by Georg Wenzeslaus von sanssouci+ * 19/14 € We need your assistance to protect & Park N Pedestrian route from Sanssouci Kladower Str. Knobelsdorff from 1734 – 40, the palace is one Valid for one day at all palaces in and preserve the UNESCO World A limited number of wheelchairs Palace to the New Palace Sacrower See Pfaueninsel of the most beautiful buildings of its times. Potsdam which are open, incl. a set Heritage sites of the Potsdam-Berlin are available for loan, free of charge Zehdenick via the Hauptallee, In addition to the palace interiors, the Kurt admission time for Sanssouci cultural landscape! You can support Neuruppin approx. 25 to 30 minutes Information for persons with Sacrower 8 Tucholsky Museum of Literature may also be Palace. the preservation of the unique Lanke disabilities: [email protected] 2 Ferry visited. Open year-round, Tues. – Sun. C gardens by purchasing a voluntary charlottenburg+ 17/13 € © terra press Berlin · 2017 admission ticket (available at ticket Eberswalde Bertinistr. Valid for one day at all palaces in Schloss Sacrow machines or from visitor assistants 0 500 1000 m Charlottenburg Palace Garden, Visitor’s Center 27 ORANIENBURG PALACE MUSEUM in the park). 27 Schloss Sacrower Nikolskoe including a set admission time for at the Historic Windmill Oranienburg Heilandskirche As the oldest Baroque palace complex in Charlottenburg Palace.