Das Forum Fridericianum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Japanese Palace in Dresden: a Highlight of European 18Th-Century
都市と伝統的文化 The ‘Japanese Palace’ in Dresden: A Highlight of European 18th-century Craze for East-Asia. Cordula BISCHOFF Dresden, seat of government and capital of present-day federal state Saxony, now benefits more than any other German city from its past as a royal residence. Despite war-related destructions is the cityscape today shaped by art and architecture with a history of 500 years. There is possibly no other place in Germany where to find so many exceptional artworks concentrated in such a small area. This accumulation is a result of the continuosly increasing significance of the Dresden court and a gain in power of the Saxon Wettin dynasty. The Holy Roman Empire of the German Nation was a conglomeration of more than 350 large and tiny territories. The 50 to 100 leading imperial princes struggled in a constant competition to maintain their positions. 1) In 1547 the Saxon Duke Moritz(1521-1553)was declared elector. Thus Saxony gained enormous political significance, as the seven, in 18th century nine electors, were the highest-ranking princes. They elected the Roman-German emperor and served as his innermost councils. The electors of Saxony and of the Palatinate were authorised to represent the emperor in times of vacancy. At the same time in 16th century Saxony rose due to its silver mining industry to one of the richest German territorial states. 2) In the second half of the 17th century the Saxon court even counted among the most important European courts. A peak of political power was reached under Frederick August(us)I. -

Neue Wache (1818-1993) Since 1993 in the Federal Republic of Germany the Berlin Neue Wache Has Served As a Central Memorial Comm
PRZEGLĄD ZACHODNI 2011, No 1 ZbIGNIEw MAZuR Poznań NEUE WACHE (1818-1993) Since 1993 in the Federal Republic of Germany the berlin Neue wache has served as a central memorial commemorating the victims of war and tyranny, that is to say it represents in a synthetic gist the binding German canon of collective memo- ry in the most sensitive area concerning the infamous history of the Third Reich. The interior decor of Neue wache, the sculpture placed inside and the commemorative plaques speak a lot about the official historical policy of the German government. Also the symbolism of the place itself is of significance, and a plaque positioned to the left of the entrance contains information about its history. Indeed, the history of Neue wache was extraordinary, starting as a utility building, though equipped with readable symbolic features, and ending up as a place for a national memorial which has been redesigned three times. Consequently, the process itself created a symbolic palimpsest with some layers completely obliterated and others remaining visible to the eye, and with new layers added which still retain a scent of freshness. The first layer is very strongly connected with the victorious war of “liberation” against Na- poleonic France, which played the role of a myth that laid the foundations for the great power of Prussia and then of the later German Empire. The second layer was a reflection of the glorifying worship of the fallen soldiers which developed after world war I in European countries and also in Germany. The third one was an ex- pression of the historical policy of the communist-run German Democratic Republic which emphasized the victims of class struggle with “militarism” and “fascism”. -

SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace Restaurant with Gourmet Kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR in NEW GLORY
Savor with all your senses Our family-led four star hotel offers culinary richness and attractive arrangements for your discovery tour along Sa- xony’s Wine Route. Only a few minutes walking distance away from the hotel you can find the vineyard of Saxon master vintner Klaus Zimmerling – his expertise and our GLORY. NEW IN SPLENDOR OLD SACHSEN. SCHLOESSERLAND cuisine merge in one of Saxony’s most beautiful castle Dresden-Pillnitz Castle Hotel complexes into a unique experience. Schloss Hotel Dresden-Pillnitz August-Böckstiegel-Straße 10 SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace restaurant with gourmet kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR IN NEW GLORY. Bistro with regional specialties Phone +49(0)351 2614-0 Hotel-owned confectioner’s shop [email protected] Bus service – Elbe River Steamboat jetty www.schlosshotel-pillnitz.de Old Splendor in New Glory. Herzberg Żary Saxony-Anhalt Finsterwalde Hartenfels Castle Spremberg Fascination Semperoper Delitzsch Torgau Brandenburg Senftenberg Baroque Castle Delitzsch 87 2 Halle 184 Elsterwerda A 9 115 CHRISTIAN THIELEMANN (Saale) 182 156 96 Poland 6 PRINCIPAL CONDUCTOR OF STAATSKAPELLE DRESDEN 107 Saxony 97 101 A13 6 Riesa 87 Leipzig 2 A38 A14 Moritzburg Castle, Moritzburg Little Buch A 4 Pheasant Castle Rammenau Görlitz A72 Monastery Meissen Baroque Castle Bautzen Ortenburg Colditz Albrechtsburg Castle Castle Castle Mildenstein Radebeul 6 6 Castle Meissen Radeberg 98 Naumburg 101 175 Döbeln Wackerbarth Dresden Castle (Saale) 95 178 Altzella Monastery Park A 4 Stolpen Gnandstein Nossen Castle -

List of Contents
List of Contents Foreword 7 The Architectural History of Berlin 9 The Buildings 25 Gothic St. Nikolaikirche (St. Nicholas Church, Mitte) 16 • St. Marienkirche (St. Mary's Church) 18 • St. Nikolaikirche (St. Nicholas Church, Spandau) 20 • Dorfkirche Dahlem (Dahlem Village Church) 22 Renaissance Jagdschloss Grunewald (Grunewald Hunting Palace) 24 • Zitadelle Spandau (Spandau Citadel) 26 • Ribbeckhaus (Ribbeck House) 28 Baroque Palais Schwerin (Schwerin Palace) 30 • Schloss Köpenick (Köpenick Palace) 32 • Schloss Friedrichsfelde (Friedrichsfelde Palace) 34 • Schloss Charlottenburg (Charlottenburg Palace) 36 • Zeughaus (Armoury) 38 • Parochialkirche (Parochial Church) 40 • Sophienkirche (Queen Sophie Church) 42 • Staatsoper (State Opera) Unter den Linden and Hedwigskathedrale (St. Hedwig's Cathedral) 44 • Humboldt- Universität (Humboldt University) and Alte Bibliothek (Old Library) 46 • Ephraim-Palais (Ephraim Palace) 48 • Deutscher Dom (German Dome Church) and Französischer Dom (French Dome Church) 50 • Die Stadt- palais (Town Palaces) Unter den Linden 52 Classicism Schloss Bellevue (Bellevue Palace) 54 • Brandenburger Tor (Branden- burg Gate) 56 • Pfaueninsel (Peacock Island) 58 • Neue Wache (New Guardhouse) 60 • Schauspielhaus / Konzerthaus (Playhouse/ Concert Hall) 62 • Friedrichswerdersche Kirche (Friedrichswerder Church) 64 • Altes Museum (Old Museum) 66 • Schloss Klein-Glienicke List of Contents 13 Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/1008901288 (Klein-Glienicke Palace) 68- Blockhaus Nikolskoe and St. -

GROUP TRAVEL Discover Cities Enjoy Nature Experience Culture Active Relaxation a Warm-Hearted Wl E Come
BAD REICHENHALL MUNICH LEONBERG/STUTTGART ALKEN/MOSEL HILDEN/DÜssELDORF BERLIN CHEMNITZ HOLIDAY DESTINATION GERMANY GROUP TRAVEL Discover cities Enjoy nature Experience culture Active relaxation A warm-hearted WL E COME D ear travel partner, Dear guests, Countryside or culture? City or landscapes? Culinary delights or active holidays? Different travel groups have different needs. It doesn’t matter for which season you are planning a trip, Germany offers a wide range of interesting places and entertainment for all ages all year round. All sights and destinations shown on the next pages are easily accessible with your own vehicle from the AMBER HOTELS and partner hotels. Your travellers will also feel thoroughly pampered in the 3 and 4 star hotels. As well as friendly staff all hotels offer great comfort and tasty choices in the restaurants. You can be sure to have the same quality even if you travel from hotel to hotel on your tours. Email me the cornerstones of you trip and you will receive an offer asap. With kind regards AMBER HOTELS Christian Röder Sales Manager Leisure [email protected] Direct contact: mobile +49 1520 6289001 Contact address: AMBER HOTELS Leisure, Schwanenstraße 27, 40721 Hilden, Germany +49 2103 503-100, -444, [email protected] Stay informed! Sign up for the AMBER newsletter for group travel (in German)! 4x to 6x a year you will receive news of the hotels and regions. Interesting basics for your tours! www.amber-hotels.de/gruppen/newsletter-gruppe/ Important notice: The tips and destina- AMBER TIP: tions on the following pages are a choice of F UN AND DANCE IN CHEMNITZ suggestions. -

Copyright by Sebastian Heiduschke 2006
Copyright by Sebastian Heiduschke 2006 The Dissertation Committee for Sebastian Heiduschke Certifies that this is the approved version of the following dissertation: The Afterlife of DEFA in Post-Unification Germany: Characteristics, Traditions and Cultural Legacy Committee: Kirsten Belgum, Supervisor Hans-Bernhard Moeller, Co-Supervisor Pascale Bos David Crew Janet Swaffar The Afterlife of DEFA in Post-Unification Germany: Characteristics, Traditions and Cultural Legacy by Sebastian Heiduschke, M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December, 2006 Dedication Für meine Familie Acknowledgements First and foremost it is more than justified to thank my two dissertation advisers, Kit Belgum and Bernd Moeller, who did an outstanding job providing me with the right balance of feedback and room to breathe. Their encouragement, critical reading, and honest talks in the inevitable times of doubt helped me to complete this project. I would like to thank my committee, Pascale Bos, Janet Swaffar, and David Crew, for serving as readers of the dissertation. All three have been tremendous inspirations with their own outstanding scholarship and their kind words. My thanks also go to Zsuzsanna Abrams and Nina Warnke who always had an open ear and an open door. The time of my research in Berlin would not have been as efficient without Wolfgang Mackiewicz at the Freie Universität who freed up many hours by allowing me to work for the Sprachenzentrum at home. An invaluable help was the library staff at the Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Babelsberg . -

Berlin's New Cultural Heart
I Research Text Berlin’s new cultural heart Cultural stronghold and historical centre Berlin, September 2017 – Today, Berlin belongs to one of Europe’s leading centres of culture – and its heart beats strongest directly in the old historical city. For centuries, Berlin’s city centre has been home to a unique concentration of outstanding cultural institutions constructed on the ground where the medieval city of Berlin was founded. The modern Mitte district does not just boast the UNESCO World Heritage Site of the Museum Island, but also two opera houses and six major theatres, as well as museums, innumerable galleries and arts venues. Now, this cultural ensemble is gaining a new dimension with many new major cultural projects located here, just a few minutes’ walk apart. You can find an overview of the main on-going and planned landmark projects below. Pierre Boulez Saal Opened in March 2017, the new Pierre Boulez Saal is a major international concert hall. Initiated by Daniel Barenboim, General Music Director of the Staatsoper Unter den Linden, the hall was developed by American architect Frank Gehry and with globally acclaimed acoustician Yasuhisa Toyota creating the impeccable acoustics. Lined with light Canadian cedarwood, the Pierre-Boulez-Saal offers a flexible design allowing the auditorium’s seating as well as the stage to be arranged in various constellations for a wide spectrum of events. The concert hall is also the public face of the Barenboim-Said Akademie, not only serving as its home venue but also a space where young musicians from conflict zones in the Middle East can practice under the guidance of their mentors. -
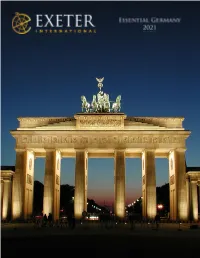
Here to Expertly Guide You Through the New Normal in Travel
esse Our Experience At Exeter International we have been creating memories and crafting custom-designed journeys for 27 years. We are a team of specialists committed to providing the best travel experiences in our destinations. Each of our experts has either travelled extensively on reconnaissance trips, or has lived in their area of expertise, giving us unparalleled first-hand knowledge. Because we focus on specific parts of the globe, we return to the same destinations many times, honing our experience over the years. Knowledgeable Up-to-the-Minute Local Information We are best placed to give you advice about traveling to Europe and beyond; from logistics and new protocols in museums, hotels and restaurants in each country. We are here to expertly guide you through the new normal in travel. Original Custom Programs, Meticulously Planned Our experts speak your language both literally and culturally. Our advice and recommendations are impartial, honest, and always have the individual in mind. We save valuable time in pre-trip research and focus on developing experiences that enrich and enhance your experience. Once on your journey you will have complete peace of mind with our local 24-hour contact person who is on hand to coordinate any changes in your program or help you in the case of any emergency. Hand-Selected Guides We know that guides are one of the most important components of any travel experience. That is why we only use local experts who have a history of working with our guests and whom we know personally. We are extremely particular in selecting our guides and are confident that they will be one of the most memorable aspects of any of our trips. -

Circling Opera in Berlin by Paul Martin Chaikin B.A., Grinnell College
Circling Opera in Berlin By Paul Martin Chaikin B.A., Grinnell College, 2001 A.M., Brown University, 2004 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Program in the Department of Music at Brown University Providence, Rhode Island May 2010 This dissertation by Paul Martin Chaikin is accepted in its present form by the Department of Music as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date_______________ _________________________________ Rose Rosengard Subotnik, Advisor Recommended to the Graduate Council Date_______________ _________________________________ Jeff Todd Titon, Reader Date_______________ __________________________________ Philip Rosen, Reader Date_______________ __________________________________ Dana Gooley, Reader Approved by the Graduate Council Date_______________ _________________________________ Sheila Bonde, Dean of the Graduate School ii Acknowledgements I would like to thank the Deutsche Akademische Austauch Dienst (DAAD) for funding my fieldwork in Berlin. I am also grateful to the Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft at Humboldt-Universität zu Berlin for providing me with an academic affiliation in Germany, and to Prof. Dr. Christian Kaden for sponsoring my research proposal. I am deeply indebted to the Deutsche Staatsoper Unter den Linden for welcoming me into the administrative thicket that sustains operatic culture in Berlin. I am especially grateful to Francis Hüsers, the company’s director of artistic affairs and chief dramaturg, and to Ilse Ungeheuer, the former coordinator of the dramaturgy department. I would also like to thank Ronny Unganz and Sabine Turner for leading me to secret caches of quantitative data. Throughout this entire ordeal, Rose Rosengard Subotnik has been a superlative academic advisor and a thoughtful mentor; my gratitude to her is beyond measure. -

Ernst Thälmann – Führer Seiner Klasse (1955) Propaganda Für Arbeiterklasse, Partei Und Heroismus
Ernst thälmann – FührEr sEinEr KlassE (1955) Propaganda für Arbeiterklasse, Partei und Heroismus 1 FilmographischE angabEn . 3 2 Filminhalt . 3 3 HistorischE KontExtualisiErung . 5 4 DiDaKtischE übErlEgungEn . 8 5 ArbEitsanrEgungEn . 11. 6 MatErial . 13 Material 1: Was ist Propaganda? . 13 Material 2: Ernst Thälmann – historische Figur und Mythos . 14 Material 3: Historische Traditionen der SED . 17 Material 4: Umgang der SED mit der nationalsozialistischen Vergangenheit . 20 Material 5: Produktionsbedingungen des Films . 21 Material 6: Propaganda oder Wirklichkeit? . 24 Material 7: Filmische Mittel des Propaganda-Films und ihre Wirkung . 25 Material 8: Zeitgenössische Kritiken des Films . 28 7 LitEratur . 29 2 Unterrichtsmaterial Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse www.ddr-im-film.de 1 FilmographischE angabEn Regie Kurt Maetzig Drehbuch Willi Bredel, Michael Tschesno-Hell, Kurt Maetzig Kamera Karl Plint- zner, Horst E. Brandt schnitt Lena Neumann Musik Wilhelm Neef bauten Otto Erdmann, Willy Schiller, Alfred Hirschmeier Kostüme Gerhard Kaddatz produktion DEFA-Studio für Spielfilme (Potsdam-Babelsberg) uraufführung 07.10.1955, Ost-Berlin/Volksbühne Länge 140 Minuten FsK ab 12 Auszeichnungen Karlovy-Vary-Filmfestival 1956: Preis für den be- sten Schauspieler an Günther Simon Darstellerinnen | Darsteller Günther Simon (Ernst Thälmann), Hans-Peter Minetti (Fiete Jansen), Karla Runkehl (Änne Jansen), Paul R. Henker (Robert Dirhagen), Hans Wehrl (Wilhelm Pieck), Karl Brenk (Walter Ulbricht), Michel Piccoli (Maurice Rouger) Gerd Wehr (Wilhelm Florin), Walter Mar- tin (Hermann Matern), Georges Stanescu (Georgi Dimitroff), Carla Hoffmann (Rosa Thälmann), Erich Franz (Arthur Vierbreiter), Raimund Schelcher (Krischan Daik), Fritz Diez (Hitler), Hans Stuhr- mann (Goebbels) u.a. 2 Filminhalt Der Film behandelt das Leben des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, in den Jahren von 1930 bis zu seinem Tode 1944. -

804,5 Jahre Dresden
TU Dresden, Fakultät Architektur Prof. Dr. Hans-Georg Lippert Vorlesung Baugeschichte (Hauptstudium) Winter 2010/11 804,5 Jahre Dresden Vorlesungsprogramm Vorlesung Datum Vortragender Thema 1 12.10.2010 H.-G. Lippert Die Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 2 19.10.2010 Walter May Das barocke Dresden I 3 26.10.2010 Walter May Das barocke Dresden II 4 02.11.2010 Henrik Karge Die Stadt des 19. Jhs. I (Gottfried Semper) 5 09.11.2010 H.-G. Lippert Die Stadt des 19. Jhs. II (Industrialisierung) 6 16.11.2010 H.-G. Lippert Die Stadt der Lebensreform 7 23.11.2010 Tanja Scheffler Expressionismus und Neue Sachlichkeit 8 30.11.2010 H.-G. Lippert Gauhauptstadt Dresden 9 07.12.2010 Thomas Will Nach 1945 I: Wiederaufbau der Monumente 10 14.12.2010 H.-G. Lippert Nach 1945 II: Nationale Traditionen 21.12.2010 Keine Vorlesung Weihnachtspause 11 11.01.2011 Kerstin Zaschke Hochschulstadt Dresden 12 18.01.2011 Susann Buttolo Die sozialistische Großstadt 13 25.01.2011 Die „europäische Stadt“ Filmreihe: (jeweils Mittwoch, 18:30 Uhr, HSZ 0004. Unkostenbeitrag: 2,00 €): 20.10.2010: Frühlingssinfonie (R.: Peter Schamoni, D 1983) 15.12.2010: Wenn du groß bist, lieber Adam (R.: Egon Günther, DDR 1965) 19.01.2011: Fünf Tage – fünf Nächte (R.: Lew Arnstam, DDR/UdSSR 1960) 02.02.2011: Der Rote Kakadu (R.: Dominik Graf, D 2004) TU Dresden, Fakultät Architektur Prof. Dr. Hans-Georg Lippert Vorlesung Baugeschichte (Hauptstudium) Winter 2010/11 804,5 Jahre Dresden 1. Vorlesung Die Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit Daten: Geschichte (I) • um 1100 v. -

Information Infos About Rental
In the best of company Deutsche Bank’s forum for art, culture and sports – your next event venue Welcome Go from the past to the PalaisPopulaire, Deutsche Bank’s forum for art, culture and sports in the heart of Berlin. to the present by taking just a few steps through the entrance Choose this premium location and thrill your Situated in the tradition-steeped Prinzessinnenpalais, doors of the Palais, which was built in 1733. It guests. The representative building with its on Unter den Linden boulevard, the PalaisPopulaire was expanded in the nineteenth century and vibrant history full of spectacular moments, offers you a unique space for encounters with your reconstructed in the 1960s after being damaged coupled with the contemporary interior design, guests. in the war, whereupon it housed the Opera Café, offers you a stage for unforgettable events. a popular meeting place. Behind the historic You will be in the best of company, in the immediate façade, bright, modern rooms now encourage vicinity of the State Opera, the German Historical encounters. Museum, Humboldt University, the Museum Island, Humboldt Forum in the Berlin Palace, and the Brandenburg Gate. Left: Wilhelm Brücke, The PalaisPopulaire is as vibrant, cosmopolitan, diverse, Parade in front of the Royal Palace, 1839, and changeable as the metropolis itself, offering you Oil on canvas, an inspiring framework for your individual event. Märkisches Museum, Berlin (the Prinzessinnenpalais is in the background on the right) In a central location and distinctive spaces, you can also Right: PalaisPopulaire in enjoy exhibitions from the Deutsche Bank Collection the Prinzessinnenpalais, and international partner institutions, as well as concerts, Unter den Linden 5, Bebelplatz readings, expert panel discussions, and sports work- shops.