All Your Ideas Are Belong to Us Internet- MEME
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
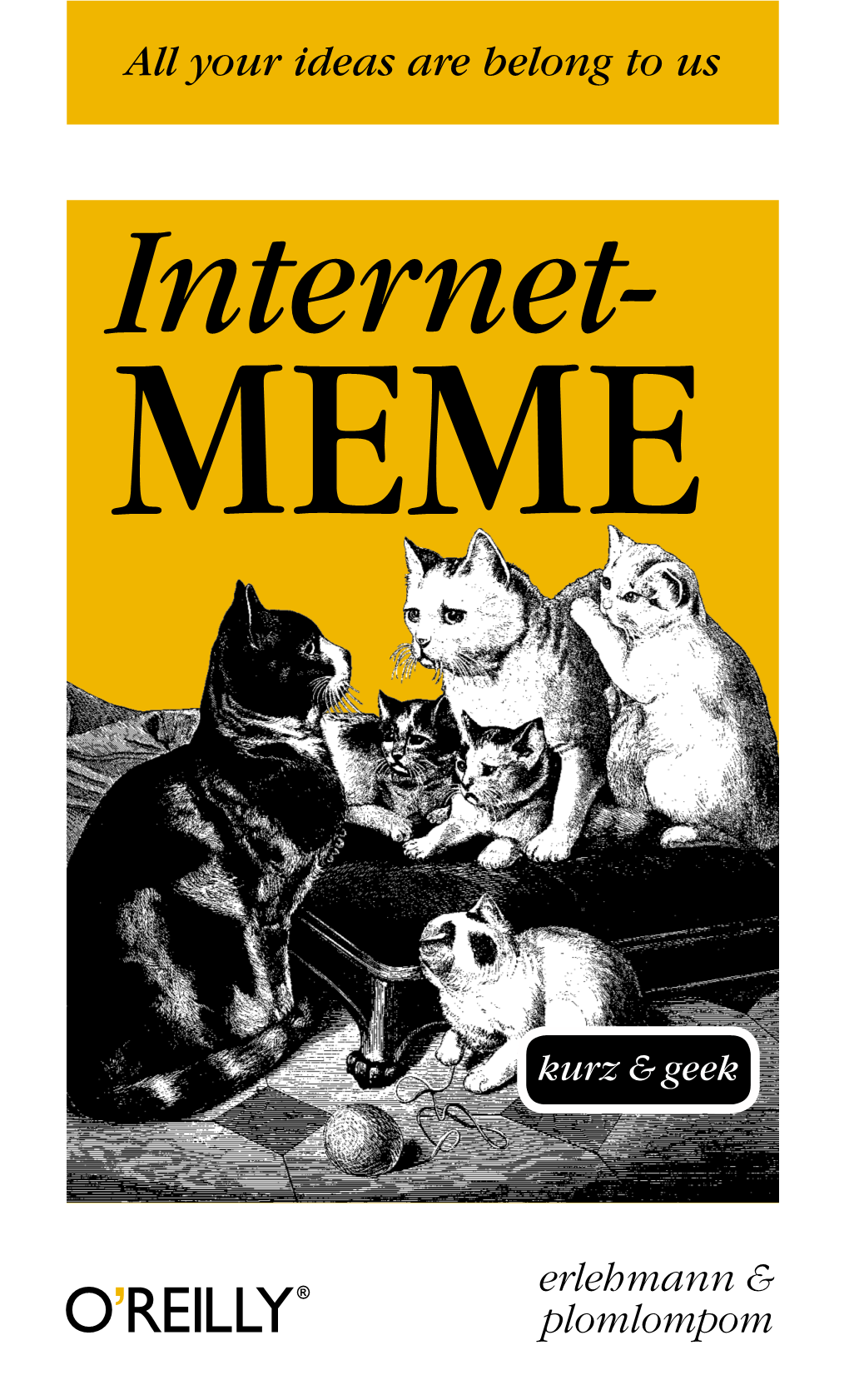
Load more
Recommended publications
-

Oneorganism Ecosystem Discovered in African Gold Mine
3/19/14 One-Organism Ecosystem Discovered in African Gold Mine - Wired Science Science News for Your Neurons Share on Facebook 85 shares Tweet 7 0 Share 2 OneOrganism Ecosystem Discovered in African Gold Mine By Alexis Madrigal 10.09.08 11:19 AM Edit In the hot, dark water of a South African mine, scientists have found the world’s loneliest species. Everywhere else biologists have studied life on our planet, they’ve found communities of life, but today, biologists announced they have discovered an ecosystem that contains just a single species of bacteria. www.wired.com/wiredscience/2008/10/one-organism-ec/ 1/32 3/19/14 One-Organism Ecosystem Discovered in African Gold Mine - Wired Science In all other known ecosystems, the key functions of life — harvesting energy and elements like carbon and nitrogen from the environment — have been shared among different species. But in the water of the Mponeng gold mine, two miles under the earth’s surface, Desulforudis audaxviator carries out all of those functions by itself. In short, it’s the tidiest package of life found yet. "It is possible to pack everything necessary for maintaining life into one genome," said Dylan Chivian of Lawrence Berkeley National Laboratory. All known life forms need carbon, hydrogen, nitrogen and an energy source to live. Plants need nitrogen, but can’t just pull it from the atmosphere and start using it to make amino acids. Instead, they rely on archaea for that task. Interconnections like these form the basis of an ecosystem, often cheesily called the ‘web of life’. -

An Analysis of Factors Influencing Transmission of Internet Memes of English-Speaking Origin in Chinese Online Communities
ISSN 1798-4769 Journal of Language Teaching and Research, Vol. 8, No. 5, pp. 969-977, September 2017 DOI: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0805.19 An Analysis of Factors Influencing Transmission of Internet Memes of English-speaking Origin in Chinese Online Communities Siyue Yang Shanxi Normal University, Linfen, China Abstract—Meme, as defined in Dawkins' 1976 book 'The Selfish Gene', is "an idea, behaviour or style that spreads from person to person within a culture". Internet meme is an extension of meme, with the defining characteristic being its spread via Internet. While online communities of all cultures generate their own memes, owing to the colossal amount of content in English and the long & widespread adoption of Internet across all strata of society in English-speaking countries, the vast majority of high-impact and well-documented memes have their origin in English-speaking communities. In addition to their spread in the original culture sphere, some of these prominent memes have also crossed the cultural boundaries and entered the parlance of Chinese Internet communities. This paper seeks to give a brief introduction to Internet memes in general, and explore the factors that control and/or facilitate a meme’s ability to enter Chinese communities. Index Terms—Internet meme, cross-cultural communication, Chinese Internet I. INTRODUCTION Internet meme, an extension of the term "meme" first coined by Richard Dawkins (1976) in his work The Selfish Gene (p. 192), refers to the unique form of meme that spreads through the Internet. Internet memes in their various forms currently enjoy substantial popularity among Internet users all around the globe, and are flourishing and becoming increasingly entrenched in the mainstream culture of all the disparate societies in this connected world. -

Internet Meme Come Strumento Di Legittimazione Nel Marketing E Nella
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Corso di Laurea Magistrale in Strategie di Comunicazione Classe LM-92 Tesi di Laurea Internet meme come strumento di legittimazione nel marketing e nella politica Relatore Laureando Prof. Vittorio Montieri Marco Michieletto n° matr.1185493 / LMSGC Anno Accademico 2019 / 2020 1 2 INDICE Introduzione ................................................................................................... 5 1. Meme: cosa, come e perché ...................................................................... 9 1.1 Meme e virale ....................................................................................... 9 1.2 Cosa è un meme? .............................................................................. 11 1.3 Come ci fa ridere un meme? .............................................................. 17 1.4 Perché un meme ha successo? ......................................................... 25 2. Meme e Brand .......................................................................................... 31 2.1 Memevertising .................................................................................... 35 2.2 Memescaping ..................................................................................... 36 2.3 Memejacking ...................................................................................... 37 3. Legittimazione: il modello di Van Leeuwen .............................................. 43 3.1 Autorizzazione ................................................................................... -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

Great Meme War:” the Alt-Right and Its Multifarious Enemies
Angles New Perspectives on the Anglophone World 10 | 2020 Creating the Enemy The “Great Meme War:” the Alt-Right and its Multifarious Enemies Maxime Dafaure Electronic version URL: http://journals.openedition.org/angles/369 ISSN: 2274-2042 Publisher Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur Electronic reference Maxime Dafaure, « The “Great Meme War:” the Alt-Right and its Multifarious Enemies », Angles [Online], 10 | 2020, Online since 01 April 2020, connection on 28 July 2020. URL : http:// journals.openedition.org/angles/369 This text was automatically generated on 28 July 2020. Angles. New Perspectives on the Anglophone World is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. The “Great Meme War:” the Alt-Right and its Multifarious Enemies 1 The “Great Meme War:” the Alt- Right and its Multifarious Enemies Maxime Dafaure Memes and the metapolitics of the alt-right 1 The alt-right has been a major actor of the online culture wars of the past few years. Since it came to prominence during the 2014 Gamergate controversy,1 this loosely- defined, puzzling movement has achieved mainstream recognition and has been the subject of discussion by journalists and scholars alike. Although the movement is notoriously difficult to define, a few overarching themes can be delineated: unequivocal rejections of immigration and multiculturalism among most, if not all, alt- right subgroups; an intense criticism of feminism, in particular within the manosphere community, which itself is divided into several clans with different goals and subcultures (men’s rights activists, Men Going Their Own Way, pick-up artists, incels).2 Demographically speaking, an overwhelming majority of alt-righters are white heterosexual males, one of the major social categories who feel dispossessed and resentful, as pointed out as early as in the mid-20th century by Daniel Bell, and more recently by Michael Kimmel (Angry White Men 2013) and Dick Howard (Les Ombres de l’Amérique 2017). -

History of Rage Faces
History Of Rage Faces 1 / 6 History Of Rage Faces 2 / 6 3 / 6 A rage comic I made about a funeral. This is not a true story, and this is kind of a sensitive topic, so I apologize if any of you were offended. 1. history of rage faces How to fail at history, forever, Rage Comics, History Class, Social Studies ... Memes faces troll boss ideas for 2019 Rage Comics, Derp Comics, Funny Comics,.. Data on SMS Rage Faces and other apps by Robert Lemoine. ... SMS Rage Faces - 3000+ Faces and Memes. Robert Lemoine ... Category Ranking History.. All internet meme rage faces list in high quality! ... Don't Worry, Be Happy [High Quality] Smiley Faces ... history of rage faces history of rage faces, why rage face I’m back! On Ars Technica, Tom Connor does a great job producing a taxonomy and history of rage-faces, showing how they evolved from a set of .... History. The first rage comic was posted to the 4chan /b/random board in 2008. It was a simple 4-panel strip showing the author's anger about getting ... VirtualHostX 8.7.0 Crack Mac Osx 4 / 6 ConceptDraw Office 6.0.0.0 + Crack CalendarPro for Google 3.2 Owen or Blade I can see this as a story of sorts. Teh Meme Wiki. … Jan 29 ... Rage Faces Kissen und Face Meme online 5 / 6 kaufen. People write Me Gusta off as a .... Of these, rage comics are the easiest way to demonstrate Internet Ugly ... drawn faces, cut-and-paste characters that anyone can slap a story .. -

American Behavioral Scientist
American Behavioral Scientist http://abs.sagepub.com/ ''LOIC Will Tear Us Apart'': The Impact of Tool Design and Media Portrayals in the Success of Activist DDOS Attacks Molly Sauter American Behavioral Scientist published online 15 March 2013 DOI: 10.1177/0002764213479370 The online version of this article can be found at: http://abs.sagepub.com/content/early/2013/03/15/0002764213479370 Published by: http://www.sagepublications.com Additional services and information for American Behavioral Scientist can be found at: Email Alerts: http://abs.sagepub.com/cgi/alerts Subscriptions: http://abs.sagepub.com/subscriptions Reprints: http://www.sagepub.com/journalsReprints.nav Permissions: http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav >> OnlineFirst Version of Record - Mar 15, 2013 What is This? Downloaded from abs.sagepub.com at MASSACHUSETTS INST OF TECH on March 17, 2013 ABSXXX10.1177/0002764213479370American Behavioral ScientistSauter 479370research-article2013 Article American Behavioral Scientist XX(X) 1 –25 “LOIC Will Tear Us Apart”: © 2013 SAGE Publications Reprints and permissions: The Impact of Tool Design sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0002764213479370 and Media Portrayals in the abs.sagepub.com Success of Activist DDOS Attacks Molly Sauter1 Abstract This article explores the role of tool design and media coverage in the relative success of Operation Payback and earlier activist distributed denial-of-service (DDOS) actions. Through a close reading of changes in the tool’s interface and functionality across several iterations, the article considers the evolution of the Low Orbit Ion Cannon (LOIC) DDOS tool, from one that appealed to a small, inwardly focused community to one that engaged with a larger population. -

Internet Memes and Their Significance for Myth Studies
PALACKÝ UNIVERSITY, OLOMOUC FACULTY OF ARTS DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES INTERNET MEMES AND THEIR SIGNIFICANCE FOR MYTH STUDIES DOCTORAL DISSERTATION Author: Mgr. Pavel Gončarov Supervisor: Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. 2016 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY INTERNETOVÉ MEMY A JEJICH VÝZNAM PRO VÝZKUM MYTOLOGIÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE Autor práce: Mgr. Pavel Gončarov Vedoucí práce: Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. 2016 ANNOTATION Pavel Gončarov Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc Title: Internet Memes and their Significance for Myth Studies Supervisor: Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. Language: English Character count: 347, 052 Number of appendices: 65 Entries in bibliography: 134 KEY WORDS myth, mythology, archaic revival, poetry, concrete poetry, semiotics, participatory media, digital culture, meme, memetics, internet memes, rage comics, Chinese rage comics, baozou manhua, baoman ABSTRACT This dissertation posits that the heart of myth rests with the novelizing and complexifying ritual of post-totemic sacrifice. As it makes an example of its delivery through poetry it tries to show the changing nature of poetry and art through history towards a designated act of whichever content. Transhumanism is seen as a tendency and so the dissertation imagines a poet whose practical exercise in the workings of typewriter produced concrete poetry are then tied to the coded ASCII table, emoticons and polychromatic glyphs which are subject to default visual modifications by manufacturers of technology. The dissertation then offers a view at memetic information transmission which is worked into a model that draws on Jacque Derrida’s différance. From a construction of a tree of hypothetical changes in the evolution of a state of culture of the primitive Waorani tribe, the dissertation moves to a logical exercise about hypernyms and hyponyms. -
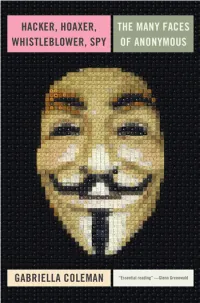
Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: the Story of Anonymous
hacker, hoaxer, whistleblower, spy hacker, hoaxer, whistleblower, spy the many faces of anonymous Gabriella Coleman London • New York First published by Verso 2014 © Gabriella Coleman 2014 The partial or total reproduction of this publication, in electronic form or otherwise, is consented to for noncommercial purposes, provided that the original copyright notice and this notice are included and the publisher and the source are clearly acknowledged. Any reproduction or use of all or a portion of this publication in exchange for financial consideration of any kind is prohibited without permission in writing from the publisher. The moral rights of the author have been asserted 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 Verso UK: 6 Meard Street, London W1F 0EG US: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY 11201 www.versobooks.com Verso is the imprint of New Left Books ISBN-13: 978-1-78168-583-9 eISBN-13: 978-1-78168-584-6 (US) eISBN-13: 978-1-78168-689-8 (UK) British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record for this book is available from the library of congress Typeset in Sabon by MJ & N Gavan, Truro, Cornwall Printed in the US by Maple Press Printed and bound in the UK by CPI Group Ltd, Croydon, CR0 4YY I dedicate this book to the legions behind Anonymous— those who have donned the mask in the past, those who still dare to take a stand today, and those who will surely rise again in the future. -

Memes : the Funniest Memes 2016 Pdf, Epub, Ebook
MEMES : THE FUNNIEST MEMES 2016 PDF, EPUB, EBOOK Sarah Collins | 102 pages | 01 Jul 2016 | Createspace Independent Publishing Platform | 9781535026437 | English | United States Memes : The Funniest Memes 2016 PDF Book The head raise. A star-studded music video. Imgur is another popular website when it comes to memes. Be Yourself Quotes. The profession of love for his wife Katie Holmes raised the scrutiny over the Church of Scientology and, well, the rest is history. Top 50 Funniest Memes Collection meme. Most work memes make some type of statement about the user's job. The answer is always Darude's "Sandstorm," the internet's anthem. You laugh, you lose, simple. A meme for all political leanings, "Thanks, Obama" has defied constitutionally mandated term limits and continues to govern the meme-verse. Green and was popular on 4chan, YouTube, Reddit, and other places that you might assume would find Dick Butt hilarious. NFL 2hr ago Mike Pereira, Dean Blandino break down what it's like being a TV rules analyst Mike Pereira was the first of many football rules analysts to be on television and featured in a broadcast. The screengrab of that moment is now, and forever, your best-worst source of advice. Ryan George theryangeorge. By: Staff Apr 26, Cute animals are always a great go-to when you are tapped out of ideas, but if you really want to push the envelope, choose a public figure you can easily imitate. January: Bernie or Hillary. Easy dance moves? It's not totally clear who thought that stock photography and cliches would inspire people to live their best lives, but as always, the power of memes pretty quickly rendered the originals obsolete. -

Obywatel W Internecie Obywatel W Internecie
OBYWATEL W INTERNECIE OBYWATEL W INTERNECIE R EDAKCJA NAUKOWA dr Magdalena Butkiewicz dr Paweł Piotr Płatek Warszawa 2017 Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Recenzenci ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ks. dr hab. Jarosław P. Woźniak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Projekt okł adki Agnieszka Miłaszewicz Korekta Paweł Płatek © Copyright by Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW and Dom Wydawniczy ELIPSA Warszawa 2017 ISBN 978-83-8017-158-9 Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Infl ancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85 e-mail: [email protected], www.elipsa.pl Spis treści Wstęp . 7 Część I. Obywatel i cyberwojna . 9 mgr Mateusz Kofi n Atak cybernetyczny i awaria systemów informatycznych – paraliż państwa i życia obywateli na przykładzie Estonii, Gruzji, Litwy oraz Polski . 11 dr Piotr Łuczuk Internet jako nowoczesne pole bitwy. Cyberwojna i jej obszary – rys historyczny konfl iktów w cyberprzestrzeni . 24 Część II. Obywatel i cyberreligia . 43 mgr Sergiusz Anoszko Nowe ruchy religijne w przestrzeni on-line: Kościół Scjentologiczny a Internet . 45 dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW Obywatel w nauczaniu Kościoła o środkach społecznego przekazu . 63 Część III. Obywatel i cybermanipulacja . 83 lic. Katarzyna Berta Reklama internetowa w świadomości społeczeństwa na podstawie badania ilościowego . 85 dr Magdalena Butkiewicz Manipulacja i propaganda w Internecie a wolność obywateli . 97 Część IV. Obywatel i cybertwórczość . 117 lic. Magda Pasińska Blog jako przestrzeń twórczej działalności internautów . 119 lic. Mateusz Łysiak Analiza aktywności w mediach społecznościowych Martyny Wojciechowskiej i Marka Kamińskiego . -
![Towards Understanding the Information Ecosystem Through the Lens of Multiple Web Communities Arxiv:1911.10517V1 [Cs.SI] 24](https://docslib.b-cdn.net/cover/0426/towards-understanding-the-information-ecosystem-through-the-lens-of-multiple-web-communities-arxiv-1911-10517v1-cs-si-24-5150426.webp)
Towards Understanding the Information Ecosystem Through the Lens of Multiple Web Communities Arxiv:1911.10517V1 [Cs.SI] 24
Towards Understanding the Information Ecosystem Through the Lens of Multiple Web Communities Savvas Zannettou A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of Cyprus University of Technology. arXiv:1911.10517v1 [cs.SI] 24 Nov 2019 Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics Cyprus University of Technology November 26, 2019 Abstract The Web consists of numerous Web communities, news sources, and services, which are often ex- ploited by various entities for the dissemination of false or otherwise malevolent information. Yet, we lack tools and techniques to effectively track the propagation of information across the multiple diverse communities, and to capture and model the interplay and influence between them. Further- more, we lack a basic understanding of what the role and impact of some emerging communities and services on the Web information ecosystem are, and how such communities are exploited by bad actors (e.g., state-sponsored trolls) that spread false and weaponized information. In this thesis, we shed some light on the complexity and diversity of the information ecosystem on the Web by presenting a typology that includes the various types of false information, the involved actors as well as their possible motives. Then, we follow a data-driven cross-platform quantitative approach to analyze billions of posts from Twitter, Reddit, 4chan’s Politically Incorrect board (/pol/), and Gab, to shed light on: 1) how news and image-based memes travel from one Web community to another and how we can model and quantify the influence between the various Web communities; 2) characterizing the role of emerging Web communities and services on the information ecosystem, by studying Gab and two popular Web archiving services, namely the Wayback Machine and archive.is; and 3) how popular Web communities are exploited by state-sponsored actors for the purpose of spreading disinformation and sowing public discord.