2 Die Geschichte Der Goten Bei Cassiodorus Und Jordanes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Black Sea-Caspian Steppe: Natural Conditions 20 1.1 the Great Steppe
The Pechenegs: Nomads in the Political and Cultural Landscape of Medieval Europe East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450 General Editors Florin Curta and Dušan Zupka volume 74 The titles published in this series are listed at brill.com/ecee The Pechenegs: Nomads in the Political and Cultural Landscape of Medieval Europe By Aleksander Paroń Translated by Thomas Anessi LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Further information and the complete license text can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ The terms of the CC license apply only to the original material. The use of material from other sources (indicated by a reference) such as diagrams, illustrations, photos and text samples may require further permission from the respective copyright holder. Publication of the presented monograph has been subsidized by the Polish Ministry of Science and Higher Education within the National Programme for the Development of Humanities, Modul Universalia 2.1. Research grant no. 0046/NPRH/H21/84/2017. National Programme for the Development of Humanities Cover illustration: Pechenegs slaughter prince Sviatoslav Igorevich and his “Scythians”. The Madrid manuscript of the Synopsis of Histories by John Skylitzes. Miniature 445, 175r, top. From Wikimedia Commons, the free media repository. Proofreading by Philip E. Steele The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://catalog.loc.gov/2021015848 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. -

Gothic Introduction – Part 1: Linguistic Affiliations and External History Roadmap
RYAN P. SANDELL Gothic Introduction – Part 1: Linguistic Affiliations and External History Roadmap . What is Gothic? . Linguistic History of Gothic . Linguistic Relationships: Genetic and External . External History of the Goths Gothic – Introduction, Part 1 2 What is Gothic? . Gothic is the oldest attested language (mostly 4th c. CE) of the Germanic branch of the Indo-European family. It is the only substantially attested East Germanic language. Corpus consists largely of a translation (Greek-to-Gothic) of the biblical New Testament, attributed to the bishop Wulfila. Primary manuscript, the Codex Argenteus, accessible in published form since 1655. Grammatical Typology: broadly similar to other old Germanic languages (Old High German, Old English, Old Norse). External History: extensive contact with the Roman Empire from the 3rd c. CE (Romania, Ukraine); leading role in 4th / 5th c. wars; Gothic kingdoms in Italy, Iberia in 6th-8th c. Gothic – Introduction, Part 1 3 What Gothic is not... Gothic – Introduction, Part 1 4 Linguistic History of Gothic . Earliest substantively attested Germanic language. • Only well-attested East Germanic language. The language is a “snapshot” from the middle of the 4th c. CE. • Biblical translation was produced in the 4th c. CE. • Some shorter and fragmentary texts date to the 5th and 6th c. CE. Gothic was extinct in Western and Central Europe by the 8th c. CE, at latest. In the Ukraine, communities of Gothic speakers may have existed into the 17th or 18th century. • Vita of St. Cyril (9th c.) mentions Gothic as a liturgical language in the Crimea. • Wordlist of “Crimean Gothic” collected in the 16th c. -
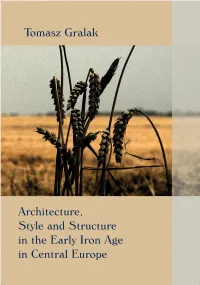
Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe
TOMASZ GRALAK ARCHITECTURE, STYLE AND STRUCTURE IN THE EARLY IRON AGE IN CENTRAL EUROPE Wrocław 2017 Reviewers: prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski Technical preparation and computer layout: Natalia Sawicka Cover design: Tomasz Gralak, Nicole Lenkow Translated by Tomasz Borkowski Proofreading Agnes Kerrigan ISBN 978-83-61416-61-6 DOI 10.23734/22.17.001 Uniwersytet Wrocławski Instytut Archeologii © Copyright by Uniwersytet Wrocławski and author Wrocław 2017 Print run: 150 copies Printing and binding: "I-BIS" Usługi Komputerowe, Wydawnictwo S.C. Andrzej Bieroński, Przemysław Bieroński 50-984 Wrocław, ul. Sztabowa 32 Contents INTRODUCTION ....................................................................................................... 9 CHAPTER I. THE HALLSTATT PERIOD 1. Construction and metrology in the Hallstatt period in Silesia .......................... 13 2. The koine of geometric ornaments ......................................................................... 49 3. Apollo’s journey to the land of the Hyperboreans ............................................... 61 4. The culture of the Hallstatt period or the great loom and scales ....................... 66 CHAPTER II. THE LA TÈNE PERIOD 1. Paradigms of the La Tène style ................................................................................ 71 2. Antigone and the Tyrannicides – the essence of ideological change ................. 101 3. The widespread nature of La Tène style ................................................................ -

„…Ut Strenui Viri…” a Gepidák Kárpát-Medencei Története
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Medievisztika alprogram Kiss Attila „…ut strenui viri…” A gepidák Kárpát-medencei története Doktori értekezés Témavezet ı: Dr. Prof. Olajos Terézia professor emerita Szeged, 2014 Tartalom KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ............................................................................................................... 2 I. BEVEZETÉS ...................................................................................................................................... 3 I. 1. A GERMÁN KÉP VÁLTOZÁSAI A TÖRTÉNETI FORRÁSOKBAN ÉS A KUTATÁSBAN ........................ 3 I. 2. A NEMZET NÉLKÜLI „SZEGÉNY ” GERMÁNOK , A GEPIDÁK MEGÍTÉLÉSE A KUTATÁSBAN ....... 15 II. A GEPIDA CSOPORTOK KÁRPÁT-MEDENCEI BEKÖLTÖZÉSE .................................... 20 II. 1. KIS GEPIDA İSTÖRTÉNET ........................................................................................................... 20 II. 2. A GEPIDÁK MEGJELENÉSE A KÁRPÁT -MEDENCÉBEN – ISMERKEDÉS A RÓMAI HATÁROKKAL ? ............................................................................................................................................................... 28 II. 3. GEPIDÁK A 3–4. SZÁZADI KÁRPÁT -MEDENCÉBEN ? ETNIKAI INTERPRETÁCIÓK A RÉGÉSZETI KUTATÁSBAN ........................................................................................................................................ 36 III. GEPIDÁK A HUN KORSZAKBAN.......................................................................................... -

Integrating Magna Dacia. a N Arrative Reappraisal Of
INTEGRATING MAGNA DACIA. A NARRATIVE REAPPRAISAL OF JORDANES OTÁVIO LUIZ VIEIRA PINTO SUBMITTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF LEEDS SCHOOL OF HISTORY SEPTEMBER 2016 ii iii The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The right of Otávio Luiz Vieira Pinto to be identified as Author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. © 2016 The University of Leeds and Otávio Luiz Vieira Pinto iv Al contrario, rispondo, chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d'esperienze, d'informazioni, di letture, d'immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Italo Calvino, Lezioni Americane. […] his own proper person was a riddle to unfold; a wondrous work in one volume; but whose mysteries not even himself could read, though his own live heart beat against them; and these mysteries were therefore destined in the end to moulder away with the living parchment whereon they were inscribed, and so be unsolved to the last. Herman Melville, Moby Dick. v ACKNOWLEDGMENTS When I crossed the Atlantic to start my doctoral research, I had no real dimension of how much certain people in my life would be fundamental to the completion of this thesis – and to go through, with head held high, the 4-year long process that it entailed. -

Appendix Epsilon
Appendix Epsilon: The Pavia Intellectual Line Connecting brothers of Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University, tracing their fraternal Big Brother/Little Brother line to tri-Founder John Andrew Rea (1869) John Andrew Rea, tri-founder of Phi Kappa Psi at Cornell . . was advised by Andrew Dickson White, . Olybrius was nephew to Flavius President of Cornell . Maximus . who was lectured by, and referred Jack . Flavius Maximus was grandson to Sextus Rea to, Washington Irving . Probus . and then through the Halle line, Appendix . Sextus Probus was son-in-law and first Delta, to the University of Pavia . cousin to Quintus Olybrius . . Pavia was elevated by the Carolingian . Quintus Olybrius was the son of to Clodius Emperor Lothair . Celsinus Adelphus spouse to Faltonia Betitia Proba . whose grandfather deposed the last . all of the above were Neo-Platonists in the Lombardic king Desiderius . tradition of Plotinus . who ruled in succession to the founder of . Plotimus was a student of Ammonius, he of his dynasty, Alboin . Numenius, he of Pythagoras, he of Pherecydes . Alboin forcefully married Rosamund, . Pythagoras also studied under princess of the Gepids . Anaximenes, he under Anaximander, he under Thales . Rosamund was daugther to Cunimund, last . king of the Gepids. Thales studied in the school of Egyption priest Petiese, who was invested by king Psamtik . the story of Cunimund’s court was . who served under Assyria king preserved by Cassiodorus . Esarhaddon, successor to Sennencherib . . Cassiodorus succeeded Boethius as first . successor to the two Sargons . Minister to the Ostrogoths . Boethius was grandson of Emperor Olybrius . Below we present short biographies of the Pavia intellectual line of the Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University. -
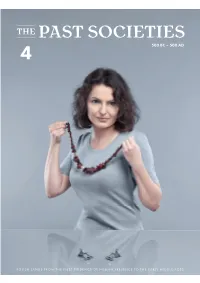
PS T4 Druk A4 — Kopia
THE PAST SOCIETIES 500 BC – 500 AD THE THE 4 PAST SOCIETIES Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences POLISH LANDS FROM THE FIRST EVIDENCE OF HUMAN PRESE NCE TO THE EARLY MIDDLE AGES THE PAST SOCIETIES POLISH LANDS FROM THE FIRST EVIDENCE OF HUMAN PRESE NCE TO THE EARLY MIDDLE AGES Przemysław Urbańczyk, editor 500 BC – 500 AD Aleksandra 4 Rzeszotarska-Nowakiewicz, editor Warszawa 2016 Published by the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences www.iaepan.edu.pl This volume has been edited with respect for Polish-language geographical terms and other no- menclature. Thus, the regions otherwise known as Greater Poland, Lesser Poland, Pomerania, and Silesia are here given as Wielkopolska, Małopolska, Pomorze, and Śląsk. The same goes for rivers (e.g., the Oder is found here as the Odra), personal names (not Boleslaus, but Bolesław), and so on. English translation Anna Kinecka Language editor Philip Earl Steele Typesetting and layout Bartosz Dobrowolski Cover design and photo Albert Salamon Wawrzyniec Skoczylas Artefacts on the cover photo, thanks to the State Archaeological Museum in Warsaw Printed and bound by Sowa Sp. z o.o. ISBN: 978-83-63760-91-5 Work financed by the National Program for Development of the Humanities – 2012-2017 © Copyright by the authors and the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences Contents 9 Preface 111 C 4 14 Bibliography 111 Pomorze in the final centuries BC 112 Introduction 113 Tough beginnings 15 C 1 115 Stability and growth 15 Societies of the younger segment of the early Iron Age in 118 Their way of life – cemeteries Poland (500–250 BC) 121 The feminine model 16 Introduction 123 Fierce warriors 18 The change. -

Viktor Rydberg's TEUTONIC MYTHOLOGY
Teutonic Mythology TO HIS MAJESTY KING OSCAR II., THE RULER OF THE ARYAN PEOPLE OF THE SCANDINAVIAN PENINSULA, THE PROMOTER OF THE SCIENCES, THE CROWNED POET, THIS WORK IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED BY THE AUTHOR, AND TRANSLATOR, VIKTOR RYDBERG. RASMUS B. ANDERSON. STOCKHOLM, November 20, 1887. HON. RASMUS B. ANDERSON, United States Minister, Copenhagen, Denmark. DEAR SIR, It gives me pleasure to authorise you to translate into English my work entitled "Researches in Teutonic Mythology," being convinced that no one could be found better qualified for this task than yourself. Certainly no one has taken a deeper interest than you in spreading among our Anglo-Saxon kinsmen, not only a knowledge of our common antiquity, but also of what modern Scandinavia is contributing to the advancement of culture—a work in which England and the United States of America are taking so large a share. Yours faithfully, VIKTOR RYDBERG. INTRODUCTION. A. THE ANCIENT ARYANS. 1. THE WORDS GERMAN AND GERMANIC. ALREADY at the beginning of the Christian era the name Germans was applied by the Romans and Gauls to the many clans of people whose main habitation was the extensive territory east of the Rhine, and north of the forest-clad Hercynian Mountains. That these clans constituted one race was evident to the Romans, for they all had a striking similarity in type of body; moreover, a closer acquaintance revealed that their numerous dialects were all variations of the same parent language, and finally, they resembled each other in customs, traditions, and religion. The characteristic features of the physical type of the Germans were light hair, blue eyes, light complexion, and tallness of stature as compared with the Romans. -

Gotların Anayurdu Ve Kökeni Origin of the Goths and Their Homeland
Gotların Anayurdu ve Kökeni Origin of the Goths and Their Homeland Mert KOZAN* Öz Gotlar, Güney İskandinavya'nın Gotland bölgesinde ortaya çıkmış bir kavimdir. II. yüzyıldan itibaren Scythia, Dacia ve Pannonia'da yaşamışlar, III. ve IV. yüzyıllarda Doğu Roma İmparatorluğu’nun topraklarını yağmalamışlar ve Aryanizmi benimsemişlerdir. İki Got kralından biri Roma İmparatoru’nun tahtına oturmuş, diğeri ise İspanya ve Galya’nın önemli bir bölümünü denetimi altında tutmuştur. 15. yüzyılda son Gotların ikamet ettiği Kırım’ın 1475’te Osmanlılar tarafından fethi ile bu büyük ulusun siyasi varlığı sona ermiştir. Artık Got adı sonsuza kadar Avrupa siyasi tarihinden silinmiştir. Ancak Avrupalıların hafızasında ve folklorlarında izleri halen devam etmektedir. Gotların köken tartışmaları, tarih boyunca pek çok yazarı düşündürmüş ve bu konuda araştırmalar ve incelemeler yapmaya itmiştir. Bununla birlikte bu tartışmalar yalnızca kişi bazında kalmamış aynı zamanda toplumlar ve toplumların ötesinde devletler bazında da tartışılmıştır. Köken konusu hakkında yazılmış eserlerin dışında ya konsillerde bu konular hararetli bir şekilde tartışılmış ya da bizzat bu konunun görüşüldüğü konsiller toplanmıştır. Tartışmalar günümüzde de halen devam etmektedir. Makalemizdeki temel amaç tarihi kaynakların ışığında Gotların kökeni ve ana yurtlarını incelemektir. Yöntem olarak ilk önce tarihi kaynaklar incelenmiş ve kaynaklara Gotların nasıl yansıdığının üzerinde durulmuştur. İkinci olarak günümüze kadar halen güncelliğini korumuş tartışmalara yer verilmiş ve detaylı bir şekilde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Gotlar, Köken, Anayurt, İskandinavya, Mit Abstract The Gothic tribes emerged in the Gotland region of Southern Scandinavia. They lived in Scytia, Dacia and Pannonia since the II. Century. In the III and IVth century, they plundered Byzantine Empire’s lands and adopted Arianism. One of the two Goth Kings ascended the throne of Caesar and the other one governed an important * Arş. -

Queen Christina of Sweden's Development of a Classical
The Pennsylvania State University The Graduate School College of Arts and Architecture REGINA CHRISTINA, ANTIQUARIO: QUEEN CHRISTINA OF SWEDEN’S DEVELOPMENT OF A CLASSICAL PERSONA THROUGH ALLEGORY AND ANTIQUARIAN COLLECTING A Dissertation in Art History by Theresa A. Kutasz Christensen © 2018 Theresa A. Kutasz Christensen Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy December 2018 This dissertation of Theresa A. Kutasz Christensen was reviewed and approved* by the following: Robin L. Thomas Associate Professor of Art History Dissertation Adviser Chair of Committee Andrew Schulz Professor of Art History Associate Dean of Research, College of Arts and Architecture Elizabeth Smith Professor of Art History Sherry Roush Professor of Italian Elizabeth Mansfield Professor of Art History Head of the Department of Art History *Signatures are on file in the Graduate School. Abstract By examining how Queen Christina of Sweden collected, what she collected, and where she displayed objects, we can better understand her motives for amassing what became the Early Modern period’s largest collection of antiquities owned by a woman. This dissertation argues that personal and political reasons motivated her to develop what could be considered a borderless, genderless, classical persona, that is represented in her display of antique objects. When her collecting habits are assessed alongside her sponsorship of classical scholarship, it becomes clear that Christina’s development of antiquities collections was inextricably tied to the large body of allegorical imagery associated with the queen. I claim that she sought a hybrid historical identity as both Swedish and European, and that the necessity to maintain political authority in both political contexts gave shape to the queen’s self-fashioning through the antique. -

The Gothic History of Jordanes in English Version
ii^« ^A^-^ °ww • • • ,v'' ^^. O <> o V ^°-v ^0 o_ ,^'%. ^v^ '"' ""^^ ..^^'^ ^ -p '^. -^MiMs ^^ "V. V ^^^ -^ '^:^^^^^-: x\ / .\o. * .0 "^^. ->^i^^^^/ ^y' o ^^^^^-'^,* .0 THE GOTHIC HISTORY OF JORDANES IN ENGLISH VERSION WITH AN INTRODUCTION AND A COMMENTARY BY CHARLES CHRISTOPHER MIEROW, Ph.D. Instructor in Classics in Princeton University PRINCETON UNIVERSITY PRESS PRINCETON LONDON: HUMPHREY MILFORD OXFORD UNIVERSITY PRESS 1915 Copyright, 1915, by Charles Christopher Mierow Published, February, 1915 FEB 27 1915 ©CIA391911 PREFACE This edition of the Getica of Jordanes is based upon the authoritative text and critical apparatus of Mommsen as found in the Monumenta Germaniae Historical Auc- fores Antiquissimi 5 (BerHn 1882), with other material added. I have adhered closely to his spelling of proper pames, especially Gothic names, except in a few words which are of common use in another form. I have care- fully reviewed all the existing evidence on controverted points, dissenting in several instances from the conclu- sions of Mommsen, particularly in regard to the sup- posedly Gothic writer Ahlahius, the ecclesiastical status of Jordanes, and the place of composition of the Getica. For the Latinity of Jordanes the studies of E. Wolfflin (Arch. f. lat. Lex. 11, 361), J. Bergmiiller (Augsburg 1903), and Fritz Werner (Halle 1908) have been con- sulted, and for ready convenience of illustration in his- torical matters frequent reference is made in the com- mentary to Hodgkin's "Italy and Her Invaders" (2nd. edition, Clarendon Press, 1892), Gibbon's "DecHne and Fall of the Roman Empire" (edited by J. B. Bury, London 1896), Bury's "History of the Later Roman Empire" (MacMillan & Co., 1889), and "The Cambridge ^Medieval History" (The MacMillan Co., New York 1911). -

Black Sea-Caspian Steppe: Outline of Ethnic and Political Relations to the End of the Ninth Century
chapter 2 Black Sea-Caspian Steppe: Outline of Ethnic and Political Relations to the End of the Ninth Century 2.1 Era of the Dominance of Iranian Nomads The accounts described in the previous chapter, despite having been written in various epochs by authors from different cultures, display a high degree of uni- formity in their descriptions of the natural environment of the Black Sea and Caspian steppe. In these accounts we find explicit and implicit expressions of the belief that this region constituted an ideal natural habitat for nomadic peoples. According to available sources, pastoral communities have domi- nated the steppe since the dawn of history. It was on the Pontic steppe, for example, that the ancients placed the home of the Galaktophagoi (milk eaters) and the Hippemolgoi (mare milkers),1 whom they identified as Cimmerians,2 a people mentioned in the Odyssey. It is difficult to say whether this identifica- tion is correct. If the Cimmerians had indeed established settlements on the Black Sea steppe at that time, they would be the first nomadic group known (i.e., identified by name) to have inhabited this region.3 At present, however, there is controversy surrounding the group’s link to archaeological remains of the Chernogorivka and Novocherkassk cultures (10th–7th centuries BCE), whose people inhabited vast stretches of the Black Sea-Caspian steppe. Some scholars associate these cultures with a separate group of Iranian nomads, said to have been forerunners of the Agathyrsi, who are mentioned by Herodotus.4 Others believe that the Cimmerians may have never settled as far west as the Black Sea steppe,5 and question the credibility of claims, most often based on Herodotus’ account in Histories, that they inhabited this region.6 1 Hom.Il.