Margarete Knittel (1906-1991)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
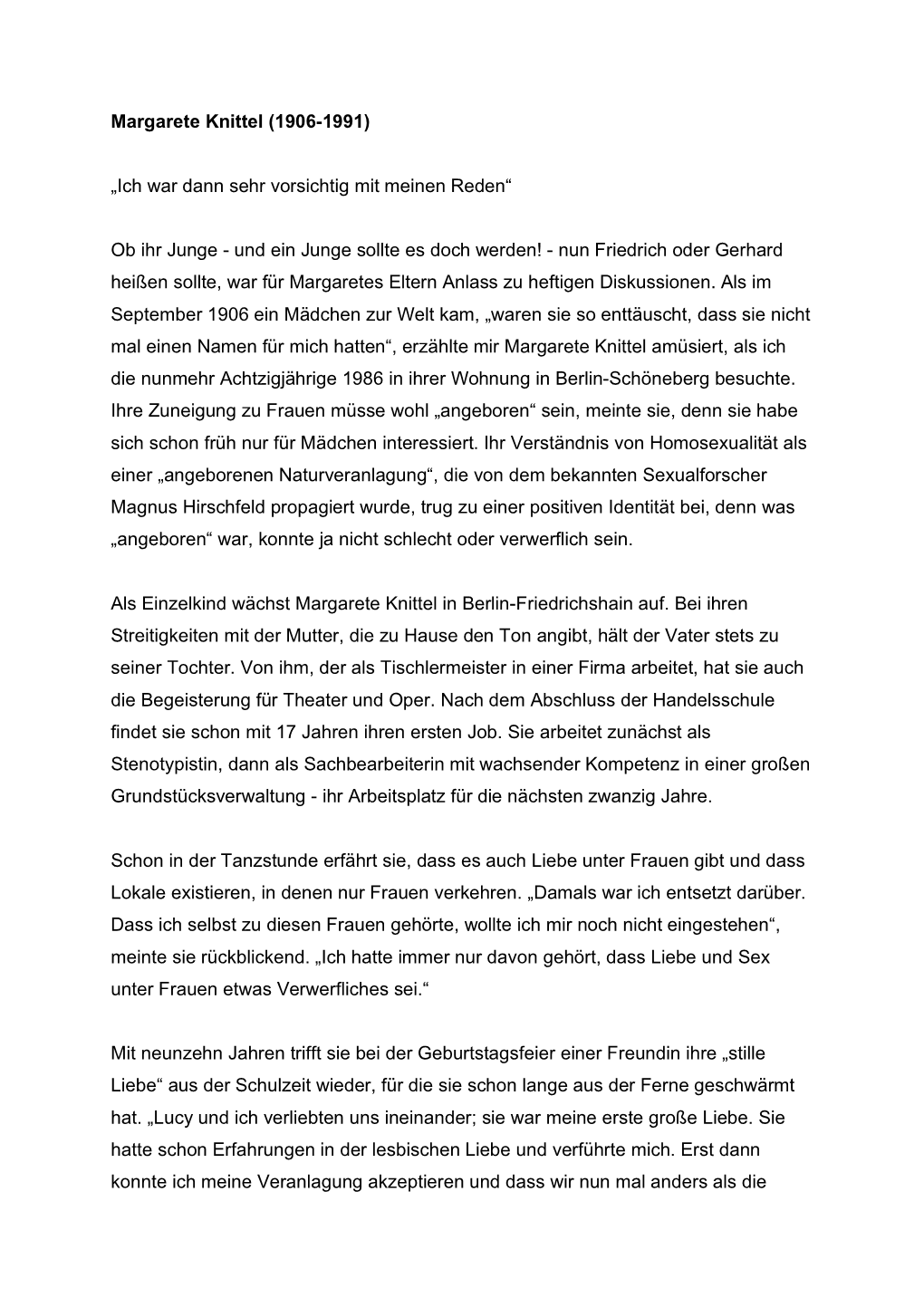
Load more
Recommended publications
-

Love Between Women in the Narrative of the Holocaust
University of South Carolina Scholar Commons Theses and Dissertations 2015 Unacknowledged Victims: Love between Women in the Narrative of the Holocaust. An Analysis of Memoirs, Novels, Film and Public Memorials Isabel Meusen University of South Carolina - Columbia Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/etd Part of the Comparative Literature Commons Recommended Citation Meusen, I.(2015). Unacknowledged Victims: Love between Women in the Narrative of the Holocaust. An Analysis of Memoirs, Novels, Film and Public Memorials. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/3082 This Open Access Dissertation is brought to you by Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Unacknowledged Victims: Love between Women in the Narrative of the Holocaust. An Analysis of Memoirs, Novels, Film and Public Memorials by Isabel Meusen Bachelor of Arts Ruhr-Universität Bochum, 2007 Master of Arts Ruhr-Universität Bochum, 2011 Master of Arts University of South Carolina, 2011 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy in Comparative Literature College of Arts and Sciences University of South Carolina 2015 Accepted by: Agnes Mueller, Major Professor Yvonne Ivory, Committee Member Federica Clementi, Committee Member Laura Woliver, Committee Member Lacy Ford, Vice Provost and Dean of Graduate Studies © Copyright by Isabel Meusen, 2015 All Rights reserved. ii Dedication Without Megan M. Howard this dissertation wouldn’t have made it out of the petri dish. Words will never be enough to express how I feel. -

Lesbian Identities in Weimar Germany
“I feel that I belong to you”: Subculture, Die Freundin and Lesbian Identities in Weimar Germany ANGELES ESPINACO-VIRSEDA Before World War I, Berlin was known for its large male homosexual subculture. After the war, however, the sudden emergence of a visible lesbian subculture was unprecedented and remarkable because, previously, lesbianism had been thought to be rare. The development of modern mass culture coincided with the rise of homosexual subculture, facilitating the formation of lesbian identities. However, as will be suggested first, these identities also had their roots in medical discourse and the homosexual emancipation movement, which looked to medical research to support its demands for homosexual rights. Also, lesbian clubs and nightclubs, as well as lesbian magazines, were closely linked to the homosexual emancipation movement, and they were the sites which brought women together and which facilitated lesbian identification. Therefore, this paper will explore the production of these identities by examining the subcultural network and, in particular, the lesbian magazine Die Freundin, as a mass cultural publication in which science, mass culture, and subculture intersected. This will highlight the constructed, unstable and ambiguous nature of Weimar lesbian identities, which were varied and overlapping. Scholars of sexual cultures and gender relations in Germany have tended to overlook Weimar lesbian identities, confining their interest to the subculture itself, rather than to the role it played in the development and elaboration -

Leitfaden Für Archive Und Bibliotheken Zur
LSBTI-Geschichte entdecken! Leitfaden für Archive und Bibliotheken zur Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen Veröffentlichungen des Fachbereichs für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlecht- lichen Menschen (LSBTI) 36 LSBTI-Geschichte entdecken! Leitfaden für Archive und Bibliotheken zur Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen Wege zur Identifizierung und Nutzung von relevanten Quellenbeständen Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 1970er-Jahre Dr. Christiane Leidinger Erstellt im Auftrag der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Berlin, Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle – LADS), Fachbereich für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) Leitfaden für Archive und Bibliotheken Anmerkung zur Schreibweise in dieser Publikation In dieser Veröffentlichung wird zur Anwendung einer geschlechtergerechten Sprache der Unterstrich, der so- genannte Gender Gap, verwendet (z. B.: Nutzer_in). Der Unterstrich weist darauf hin, dass es neben der männ- lichen und der weiblichen Geschlechtsidentität viele weitere mögliche Geschlechtsidentitäten gibt. Die Abbil- dung dieser Vielfalt in der Schriftsprache ist Bestandteil der heutigen wissenschaftlichen Fach diskussion. Siehe auch Kapitel „Gut zu wissen“, S. 10. Anmerkung zu den Abbildungen in dieser Pub- likation Die auf den Seiten -

Und Bildungsprozessen Bei Homosexuellen Im Internet Inaugur
Bildung in Medienwelten? - Eine biografieanalytische Studie zu Lern- und Bildungsprozessen bei Homosexuellen im Internet Inauguraldissertation zur Erlangung des Akademischen Grades eines Dr. phil., vorgelegt dem Fachbereich 02: Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz von Claus Bender aus Frankfurt am Main Mainz 2010 Referentin: Korreferent: Tag des Prüfungskolloquiums: 10. Februar 2010 Gefördert durch Mittel der Mehr Informationen unter: www.agpro.at Inhalt Einleitung ...............................................................................................9 TEIL 1 HOMOSEXUALITÄT, NEUE MEDIEN UND MEDIENBILDUNG. DISKUSSIONEN ZU THEORIE UND FORSCHUNGSSTAND 1. Die soziale Konstruktion von heteronormativer Sexualität als Kontext von Homosexualität ....................................................14 1.1. Die allgemeine Bedeutung von Sexualität, Identität und Begehren im Kontext kultureller Zweigeschlechtlichkeit................. 15 1.1.1. Sexualität als soziales Konstrukt............................................. 16 1.1.2. Sexualität als Identitäts- und Differenzierungsmerkmal.......... 18 1.1.3. Die Geschlechtsidentität (Gender) als Determinante bei der Verortung in einer Geschlechtergruppierung .............. 20 1.1.4. Sexualität als Vergesellschaftungsform................................... 23 1.2. Homosexualität als eine mögliche sexuelle Präferenz, sexuelle Orientierung und Partnerwahl............................................. 24 1.2.1. Die soziale Konstruktion von Homosexualität im -

Des Lieux Ou Les Lesbiennes Se Reconaissent
DIAMOND SPLINTERS This is a demo for lesbian visibility! Here and now we’re in the streets with all our herstories, our desires, our political demands, and with the full awareness that our “We” remains fluid. It is my pleasure to welcome at this rally Erika Felden, Gerda Hellinger, Ruth Margarete Roellig and the activists from Lyon, such as Francoise d’Eaubonne. Our comrades from Poland, U, A, X and D have also arrived, especially for the occasion! Thank you! Our front lines are exclusively for FLTI*1, women*, lesbians* trans* and intersex* persons, then off goes the CSD Emancipation Block from Leipzig, welcome! The route will take us from Lyon of the 1970s to Kraków, and through the Nollendorfplatz in Berlin of the 20s right back to the future, with the final rally in Leipzig. I wish us all a loud and powerful, resolute and feisty demo! These are the tales of women* who love women*. Of girlfriends, the daughters of Sappho, lesbian-alikes and lesbians. This is a homage to text and image, to magazine publications, to the writing of lesbian herstory as it unfolds. To the woman authors of the lesbian novels of the Weimar republic, to the publishers of lesbian magazines such as the “Quand les femmes s’aiment”, “LESBIA” or the “Freundin”. The threads woven into this tapestry were picked up in archives, clubs, parks and the journeys in between. These are flags and banners, chats and dances, slogans and words of love. How loud will this ensemble be, composed of so many diverse elements? Will we need to use the flags for batons2? Will there be singing? Is it about a stroll, or a revolt? How many are there to carry the front banner? Are we standing up, uprising, strolling on, stopping off? It’s a journey in many an episode. -

2. Das 3. Geschlecht
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository University of Calgary Press University of Calgary Press Open Access Books 2020-10 OTHERS OF MY KIND: Transatlantic Transgender Histories Bakker, Alex; Herrn, Rainer; Taylor, Michael Thomas; Timm, Annette F. University of Calgary Press Bakker, A., Herrn, R., Taylor, M. T., & Timm, A. F. (2020). OTHERS OF MY KIND: Transatlantic Transgender Histories. University of Calgary Press, Calgary, AB. http://hdl.handle.net/1880/112845 book https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca The print and ebook versions of this book feature full-color, high-resolution images. This Open Access version of the book includes low-resolution images in black and white only. press.ucalgary.ca OTHERS OF MY KIND: Transatlantic Transgender Histories by Alex Bakker, Rainer Herrn, Michael Thomas Taylor, and Annette F. Timm ISBN 978-1-77385-122-8 THIS BOOK IS AN OPEN ACCESS E-BOOK. It is an electronic version of a book that can be purchased in physical form through any bookseller or on-line retailer, or from our distributors. Please support this open access publication by requesting that your university purchase a print copy of this book, or by purchasing a copy yourself. If you have any questions, please contact us at [email protected] Cover Art: The artwork on the cover of this book is not open access and falls under traditional copyright provisions; it cannot be reproduced in any way without written permission of the artists and their agents. The cover can be displayed as a complete cover image for the purposes of publicizing this work, but the artwork cannot be extracted from the context of the cover of this specific work without breaching the artist’s copyright. -

Verzeichnis Nachlass Dieter Berner
Nachlass Dr. Dieter Berner im Bestand der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. 1 von 27 Buch (Sammelwerk) BIF - Blätter idealer Frauenfreundschaften. Abstract: [rd] Nr. 1 (Jahr und Jahrgang unklar} Nr. 2, 2. Jg. [1927?] Buch (Sammelwerk) Der Merkur. [Anzeigenbeilage der "Freundschaft"]. Abstract: vorhanden: 2.1923, Nr. 4 Buch (Sammelwerk) Die Insel: Radszuweit Verlag. Abstract: [rd] 1.-3. Jg. nichts 4. Jg. 1929: 1-12 5. Jg. 1930: 1-12 6. Jg. 1931: 1-12 7. Jg. ?? Buch (Sammelwerk) Ehe- und Sexualprobleme [Rückentitel] [privater Sammelband, enthält: Jansen, Kawerau, Marcuse, Blätter für Menschenrecht, Theilhaber, Feldegg]. Abstract: [rd] erfaßt unter den Einzeltiteln Buch (Sammelwerk) Frauen, Liebe und Leben. Abstract: [rd] 1928, Nr. 1, 2, 3 Buch (Sammelwerk) Geschlecht, Gesetz und Gesellschaft [Beilage in den Radszuweit-Zeitschriften]. Abstract: [rd] 1.1924, 1-13 Buch (Sammelwerk) Ledige Frauen. Die Freundin. Abstract: [rd] Nachlass Dr. Dieter Berner im Bestand der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. 2 von 27 wird anfangs als 4. Jg. (1927) gezählt, dann als Jahrgang 1928, 1927: 1,2, 5, 11 1928: 1, 2, 3 4, 5 14 Buch (Sammelwerk) Monte Verità. Berg der Wahrheit. Lokale Anthropologie als Beitrag zur Wiederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen Topographie. Ausstelluungskatalog (o.J.). Mailand: Electa Editrice. Abstract: [rd] Beilagen Zeitungsausschnitte und Notizzettel von Dieter Berner Buch (Sammelwerk) Die Freundschaft (1919). Berlin: Friedrich Radszuweit. Abstract: [rd] 1.1919, Nr. 1, 3 2.1920, Nr. 15,17 3.1921, Nr. 1 4.1922, Nr. 1-10, 12-51/52 5.1923, Nr. 1, 2, 4, 7, 8, 13 6.1924, Nr. 1-9 (Dezember); und Einzelseiten 7.1925, Nr. 1-8, 11, 12 (monatlich) 8.1926, Nr. -

Women and Art in Weimar Germany 1918-1933
ENVISIONING THE NEW WOMAN Women and Art in Weimar Germany 1918-1933 Jordana Lennox Bachelor ofSocial Science History 1.11.2004 Submitted in part fulfilment of the degree of Bachelor of Arts (Honours) History 2004 *CONTENTS* Abbreviations ll • List of Figures ll Acknowledgements v Introduction 1 Chapter 1: The Weimar Woman: Between Image and Reality 9 Chapter 2: Hannah Hoch: Allegories of Weimar Femininity 30 Chapter 3: The Boring Dollies of Jeanne Mammen 52 Afterword 72 Bibliography 75 Abbreviations BIZ Berliner Illustrirte Zeitung AIZ Arbeiter Illustrirte Zeitung BDF Bund Deutscher Frauenvereine GDJ Grossdeutscher Jugendbund List of Figures Title Page Jupp Wiertz 1. 'Modernity and Male Anxiety' 3 (Berliner Illustrirte Zeitung, 1923) 2. 'The Modern Woman' 11 (Die Dame, 1927) 3. 'Ford Takes over the Production of the Tiller Girls' 14 Paul Simmel (Berliner Illustrirte Zeitung, 1926) 4. A Machine that Measures Beauty 15 (Berliner Illustrirte Zeitung, 1932) 5. Dancers in a Hall 18 Elsa Haensgen-Dingkuhn (1929) 6. Shop Window 19 Lea Grun dig ( 1936) 7. Mother and Daughter at the Hairdresser 21 Gerta Overbeck (1924) 8. The Labour Exchange 25 ii Grethe Jiirgens (1929) 9. German Girl 30 Hannah Hoch (1930) 10. Cut With the Kitchen Knife Dada Through the last Weimar Beer 36 Belly Cultural Epoch Hannah Hoch (1919-1920) 11. Dada Ernst 41 Hannah Hoch ( 1920-1921) 12. 'Working Women!' (advertisement for Creme Mouson) 42 (Berliner Illustrirte Zeitung 1930) 13. The Beautiful Girl 44 Hannah Hoch (1919-1920) 14. Hannah Hoch and Raoul Hausmann in front of their works at the First 47 International Dada Fair Berlinische Galerie (1920) 15. -

Women's & Gender Studies | Subject Catalog (PDF)
Women’s & Gender Studies Catalog of Microform (Research Collections, Serials, and Dissertations) www.proquest.com/en-US/catalogs/collections/rc-search.shtml [email protected] 800.521.0600 ext. 2793 or 734.761.4700 ext. 2793 USC008 -03 updated May 2010 Table of Contents About This Catalog ............................................................................................... 2 The Advantages of Microform ........................................................................... 3 Research Collections............................................................................................. 4 Association Papers ............................................................................................................................................5 Literature .......................................................................................................................................................... 10 Personal Papers ............................................................................................................................................... 13 Serial & Monograph Collections ................................................................................................................... 17 Women‘s Lives ................................................................................................................................................ 28 Women‘s Movement/Civil Rights ............................................................................................................... -

Beziehungsweise(N) - Liebe Und Partnerschaft Im Wandel Haring, Sabine; Höllinger, Franz
www.ssoar.info Beziehungsweise(n) - Liebe und Partnerschaft im Wandel Haring, Sabine; Höllinger, Franz Veröffentlichungsversion / Published Version Forschungsbericht / research report Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: SSG Sozialwissenschaften, USB Köln Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Haring, S., & Höllinger, F. (2009). Beziehungsweise(n) - Liebe und Partnerschaft im Wandel. Graz: Universität Graz, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-235323 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. anderweitig nutzen. -

The Complications of Vergangenheitsbewältigung in Post-Nazi Germany
„Die Aufarbeitung der Vergangenheit“: The Complications of Vergangenheitsbewältigung in Post-Nazi Germany Emily E. Wendel Senior Honors Thesis Department of German Wittenberg University Director: Dr. Timothy Bennett 11 April 2008 Wendel 2 CONTENTS Introduction ………………………………………………………………...……………………. 3 Understanding the Culture of the Third Reich ……………………………..……………………. 4 Examining the Perpetrators …………………………………………………………………….. 15 Moving Forward ……………………………………………………………………………….. 25 Educating the Next Generation ………………………………………………………………… 35 Conclusion ……………………………………………………………………………………... 49 Notes …………………………………………………………………………………………… 50 Works Cited ……………………………………………………………………………………. 52 Wendel 3 Introduction Essentially since 1945, Germans have struggled with issues both of national and personal responsibility for the events of the Holocaust and the Second World War. In an effort to alleviate the pain of the past, many, especially in the beginning, simply kept silent on the matter. But as writers and thinkers have begun to break this silence, a complex set of questions emerges. To what extent are the ordinary Germans who collaborated with the Nazis to be held accountable for their actions? What does it mean when we still love these perpetrators? And what shall we tell our children about their heritage and their stake in their nation’s legacy? Through an analysis of works that grapple with these issues, I will attempt to understand the cultural phenomena that led to the Holocaust, as well as some of the philosophies that modern writer and theorists have submitted in response to such questions. Wendel 4 Understanding the Culture of the Third Reich In retrospect, it is often easy to make the Germans who collaborated with the Nazis into uncomplicated monsters. We find their actions reprehensible, and we feel that had we been placed in such a situation, we would have chosen to resist the Nazi regime. -

'Anders Dan De Anderen'
‘Anders dan de anderen’ Articulating female homosexual desire in queer Dutch narratives (1930-1939) Cyd Sturgess IN 53 (3): 193–211 DOI: 10.5117/IN2015.3.STUR Abstract During the early twentieth century, Germany and the Netherlands witnessed an unprecedented surge in discourses on sexuality, galvanized by the pioneering research of central European sexologists. Against the backdrop of sexological developments and the hedonism of post-war society, Berlin saw the emergence of a thriving homosexual circuit during the interbellum. Across the border, however, the conservatism of Dutch society meant that a Sapphic subculture would not fully emerge in the Netherlands until the mid- 1950s. Drawing on a framework that Laura Doan has recently termed ‘queer critical history’, and through an exploration of a selection of literary, scientific and ‘emancipatory’ writings, this article will examine how societal and cultural constructions of female same-sex desire in Dutch contexts were often at odds with scientific depictions of the ‘congenital invert’. Acknowledging the existence of this incongruence, as the article will argue, can provide historians with a space to explore alternative configurations of same-sex desire in Dutch interwar society that cannot be interpreted in the sense of a self-reflexive ‘lesbian’ identity. Keywords: queer, sexology, lesbian, Josine Reuling, Eva Raedt-de Canter, Magnus Hirschfeld, sexual inversion 1 Introduction On Saturday, 4 December 1937 Josine Reuling’s novel Terug naar het eiland was described in the Sumatra Post as a ‘meesterwerk der nederlandse pornographie’. A story about the life of a young Swedish girl who has VOL. 53, NO. 3, 2015 193 INTERNATIONALE NEERLANDISTIEK romantic relationships with women during her extended summers in Paris, Reuling’s work sparked outrage in the newspapers of the Dutch colonies.