Kroaten-Tag Kittsee 1985
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
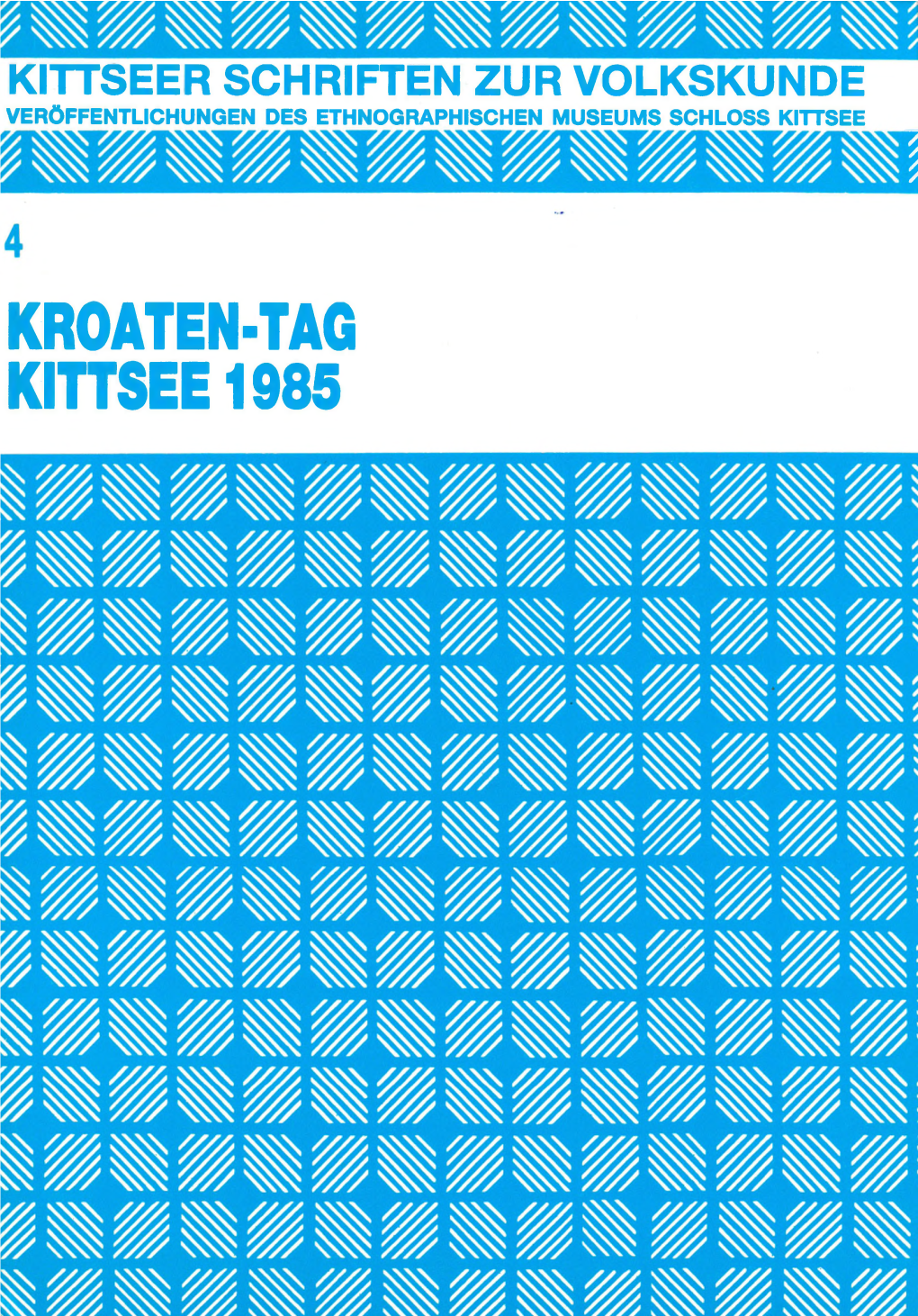
Load more
Recommended publications
-

Linie 292: Neusiedl/See – Frauenkirchen – Andau
292 Neusiedl/See - Frauenkirchen - Andau Betreiber: Österreichische Postbus AG, Kundeninformation: Tel.: 05 1717 Alle Angaben ohne Gewähr. Montag - Freitag Kursnummer 101 105 107 109 111 161 163 113 117 115 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 Verkehrshinweis 43 43 j9 j9 43 43NP 43 j9 43 43 j9 43 43 j9 R700 von Wien Hauptbahnhof an 7.55 8.55 10.55 12.55 14.55 15.55 R64/REX64 von Wulkaprodersdorf an 6.24 7.24 7.55 8.55 10.55 12.55 14.55 15.55 Neusiedl am See Bahnhof (B) 5.56 6.40 7.29 8.00 9.00 11.00 13.00 15.00 16.00 Neusiedl am See Bezirkshauptmannschaft 5.58 6.42 7.31 8.02 9.02 11.02 13.02 15.02 16.02 Neusiedl am See Hauptplatz an 6.00 6.44 7.33 8.04 9.04 11.04 13.04 15.04 16.04 Neusiedl am See Hauptplatz ab 6.01 6.45 7.34 8.05 9.05 11.05 11.55 12.43 12.46 13.05 13.41 15.05 15.21 16.05 Neusiedl am See Klosterschule 6.02 6.46 7.35 8.06 9.06 11.06 11.56 12.44 12.47 13.06 13.42 15.06 15.22 16.06 Neusiedl am See Schulzentrum (B) 7.39 12.00 12.48 12.51 13.46 13.50 15.26 Neusiedl am See Kaserngasse 6.03 6.47 7.43 8.07 9.07 11.07 12.04 12.52 12.55 13.07 13.50 13.54 15.07 15.30 16.07 Neusiedl am See Untere Hauptstr. -

Burgenländische
©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at BURGENLÄNDISCHE HEIMATBLÄTTER Herausgegeben vom Volksbildungswerk für das Burgenland in Verbindung mit dem Landesarchiv und Landesmuseum 24. Jahrgang Eisenstadt 1962 Heft Nr. 1 Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee 5. Ergänzung zum gleichnamigen Buch von Karl Pili. Von Gottfried T r a x 1 e r, Eisenstadt. Zufolge der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung werden in den letzten Jahren auch in unserem Lande die natürlichen Bodenflächen als Aufenthalt der heimischen Fauna und Flora durch den Fremdenverkehr, durch die Industrialisie rung, durch den Ausbau der Verkehrs- und Energiewege, durch die Erweiterung der Siedlungen und durch die Maßnahmen zur Verbesserung und Verwertung des Bodens in einem bisher nie dagewesenen Ausmaße zerstört. Ich möchte daher aus Anlaß des Erscheinens meiner 5. Teilarbeit mit allem Nachdruck klarstellen, daß ich meine Aufgabe nicht darin erschöpft sehe, die Pflanzenarten des Gebietes fein säuberlich zu verzeichnen, etwa damit man später einmal nachlesen kann, was zu unserer Zeit noch alles zu finden war. Meine Bemühungen haben vielmehr den Zweck, die heimische Flora vor aller Augen ins rechte Licht zu setzen, um das Interesse für sie zu wecken und die Erkenntnis ihres hohen ideellen Wertes zu fördern. Dadurch soll schließlich erreicht werden, daß sich die Allgemeinheit be wußt wird, welch reicher Schatz hier vorhanden ist, und daß es dringend notwen dig ist, diesen Schatz in jeder denkbaren Weise zu schützen, um ihn möglichst un geschmälert den nach uns kommenden Generationen zu erhalten. Abkürzung: WF. = Weitere(r) Fund(e). LITERATUR: M e 1 z e r Helmut, Neues und Kritisches zur Flora der Steiermark und des angrenzenden Burgenlandes, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, 90, 1960, 85— 102. -

Verordnung Der Burgenländischen Landesregierung Vom ___Über
Entwurf Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom …………… über die Einteilung der Gemeinden in Ortsklassen Gemäß § 3 Abs. 4 und 5 des Burgenländischen Tourismusgesetzes 1992, LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 33/2007 wird verordnet: § 1 Für die nachstehend angeführten Gemeinden des Burgenlandes werden die Ortsklassen für die Jahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 wie folgt festgesetzt: Gemeinde Ortsklasse Andau II Antau IV Apetlon II Bad Sauerbrunn I Bad Tatzmannsdorf I Badersdorf IV Baumgarten IV Bernstein III Bildein IV Bocksdorf IV Breitenbrunn I Bruckneudorf III Burgauberg - Neudauberg II Deutsch Jahrndorf IV Deutsch Kaltenbrunn IV Deutsch Schützen - Eisenberg III Deutschkreutz III Donnerskirchen I Draßburg IV Draßmarkt IV Eberau III Edelstal IV Eisenstadt I Eltendorf IV Forchtenstein II Frankenau - Unterpullendorf II Frauenkirchen III Gattendorf IV Gerersdorf - Sulz IV Gols III Grafenschachen III Großhöflein IV Großmürbisch III Großpetersdorf II Großwarasdorf IV Güssing II Güttenbach IV Hackerberg III Halbturn IV Hannersdorf III Heiligenbrunn II Heiligenkreuz im Lafnitztal I Heugraben IV Hirm IV Horitschon III Hornstein IV Illmitz I Inzenhof IV Jabing IV Jennersdorf I Jois I Kaisersdorf IV Kemeten IV Kittsee IV Kleinmürbisch IV Klingenbach IV Kobersdorf IV Kohfidisch IV Königsdorf III Krensdorf IV Kukmirn III Lackenbach IV Lackendorf IV Leithaprodersdorf IV Litzelsdorf IV Lockenhaus II Loipersbach im Burgenland IV Loipersdorf - Kitzladen II Loretto IV Lutzmannsburg I Mannersdorf an der Rabnitz IV Mariasdorf -

Bruck an Der Leitha Po Rastených Trstinou, Je „Vietor, Víno a Voda“
CESTNÁ MAPA S TRASAMI PRE OBJAVITEĽOV KEĎ SA DUNAJ STRETNE S NEZIDERSKÝM JAZEROM www.donau.com | www.neusiedlersee.com Naši hostia nie sú pri rozmýšľaní obmedzení Burgenland so svojimi výborne vybudovanými hranicami krajiny a okrem toho si vážia atraktívnu cyklistickými trasami dlhými 2 500 km je turistickú ponuku. Záleží mi na tom, aby sa tu- rajom pre cyklistov. Týmto cezhraničným cy- rizmus rozvíjal a prepájal aj cez spolkové hranice kloprojektom sa atraktivita cyklistickej ponuky a táto skutočnosť prispievala k udržateľnému ešte viac zvýši. V neposlednom rade predsta- pozitívnemu rozvoju cestovného ruchu po Výstave vuje pre miestne a regionálne hospodárstvo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. väčšie príležitosti na rozvoj cestovného ruchu. Predseda krajinskej vlády Dr. Erwin Pröll Predseda krajinskej vlády Hans Niesel Medzi dvoma veľkými aglomeráciami, Viedňou Teší ma, že sa nám podarilo uviesť do života a Bratislavou, sa stalo z regiónu Römerland tento cezkrajinský projekt v súvislosti s Výsta- Carnuntum – Marchfeld vyhľadávané miesto vou spolkovej republiky Dolné Rakúsko. Dobré dovoleniek a oddychu. So susedným regiónom partnerstvo medzi Burgenlandom a Dolným „Neziderské jazero“ ho spája množstvo prírod- Rakúskom tak pokračuje aj v oblasti cestov- ných a kultúrnych atrakcií, ktoré majú spoločný ného ruchu, a to projektom, ktorý bude určite rozvojový a trhový potenciál. na úžitok obom regiónom. Krajinská radkyňa pre cestovný ruch Dr. Petra Bohuslav Krajinská poradkyňa Mag.a Michaela Resetar 2 TRASA PRE OBJAVITEĽOV očakávania. Región Neziderské jazero predsa patrí do oficiálneho zoz- KEĎ SA DUNAJ STRETNE namu svetového dedičstva UNESCO. Po ceste máte k dispozícii mno- S NEZIDERSKÝM JAZEROM ho zastávok, počas ktorých sa nestretnete len s vínom a vodou, ale aj s gurmánskymi lahôdkami, ktoré na vás čakajú pozdĺž príjemnej Mottom trasy pre objaviteľov dlhej približne 97 kilometrov, ktorá vedie rovinky. -

Zur Siedlungsgeschichte Der Gemeinde St. Andrä
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Burgenländische Heimatblätter Jahr/Year: 1962 Band/Volume: 24 Autor(en)/Author(s): Lotz Friedrich Artikel/Article: Zur Siedlungsgeschichte der Gemeinde St. Andrä 88-91 ©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at Zur Siedlungsgeschichte der Gemeinde St. Andrä Von Friedrich L o t z, Bad Homburg- Viele Dörfer des Nordburgenlandes wurden im Türkenjahr 1683 vom Feinde schwer heimgesucht, zerstört und entvölkert. Damals flutete das geschlagene Osmanenheer von Wien zurück durch den Verwaltungsbezirk Neusiedl am See, plünderte die Stadt- und Dorfsiedlungen und legte viele in Schutt und Asche. Ein Teil der Einwohner suchte in der Flucht seine Rettung, versteckte sich in den Wäldern oder floh in die ummauerten Städte, wie z. B. die von Edelstal und Kitt see nach Hainburg, wo sie aber alle umkamen. Der andere Teil der Bevölkerung, der bei Herd und Hof sitzen blieb, wurde massenhaft brutal getötet oder in die Gefangenschaft verschleppt. So ein hartes Los traf Apetlon, Deutsch-Jahrndorf, Frauenkirchen, Gols, Halbturn, Illmitz, Jois, Mönchhof, Neudorf bei Parndorf und viele andere Siedlungen1. Nach diesem letzten Durchzug der Türken begann alsbald die Neubesiedlung und der Wiederaufbau, worüber wir nur mangelhaft unterrichtet sind, da das einschlägige Quellenmaterial bisher noch nicht ausgewertet ist. Hier steht der siedlungsgeschichtlichen Forschung ein weites Feld offen2. Während des Wiederaufbaues nach der Türkenherrschaft wurden auch alte Wüstungen, ehemalige Dörfer, die schon um die Wende von 15. zum 16. Jahr hundert eingegangen waren, im Zuge der Neubevölkerung neubesiedelt, so z. B. 1696 St. Andrä bei Frauenkirchen im Seewinkel. -

Arisierungsakten Des Nördlichen Burgenlandes (Landeshauptmannschaft Niederösterreich)
Arisierungsakten des nördlichen Burgenlandes (Landeshauptmannschaft Niederösterreich) Faszikel 1 16 Orley Olga Bruck a. d. Leitha F 1 34 Feigelstock Hugo u. Jolan Deutschkreutz F 1 34 a Feigelstock Gustav, Hugo u. Jolan Deutschkreutz F 1 37 Nemeth Maria Eisenstadt F 1 117 Mayer Karl Bruckneudorf F 1 Fould Anna; Lederer Valarie; Stutzer 202 Deutschkreutz F 1 Charlotte; Weiler Sigmund u. Stefanie Aufzeichnungen über die zum Abbruch 214 Deutschkreutz F 1 bestimmten Judenhäuser 218 Reiner Netti Sara Deutschkreutz F 1 238 Mandel Ernst Israel Sauerbrunn F 1 246 Eisenberg Isidor Deutschkreutz F 1 248 Entenberg Sigmund Neudörfl F 1 249 Engel Leopold Frauenkirchen F 1 250 Steindler Julius Eisenstadt F 1 252 Gerstl Josefine Sara Frauenkirchen F 1 253 Goldner Sigmund, Gisela, Erich u. Rosa Deutschkreutz F 1 255 Grünwald Gabriel u. Giza Deutschkreutz F 1 257 Gerö Oskar Eisenstadt F 1 268 Hirschenhäuser Eugenie Mattersburg F 1 269 Hirsch Alfred Mattersburg F 1 272 Krauß Berta Deutschkreutz F 1 275 a Judenmöbel Oberpullendorf F 1 275 b Judenmöbel Frauenkirchen F 1 275 c Judenmöbel Sauerbrunn F 1 342 Hacker Isidor u. Maria Kobersdorf F 1 342 a Hacker Isidor u. Maria Kobersdorf F 1 342 c Hacker Maria Lindgraben F 1 Faszikel 2 417 Weiss Pratin Bruckneudorf F 2 433 Bruckner & Spiegel; Spiegel Emanuel Deutschkreutz F 2 439 Boskovits Hugo; Mayer Josef Nickelsdorf F 2 439 Boskovits Hugo Nickelsdorf F 2 445 Unger Karl Eisenstadt F 2 473 Rom Michael, Gustav u. Elisabeth Purbach F 2 489 Zinszahlungen an Hr. Fetter Frauenkirchen F 2 517 Hacker Ignatz Lackenbach F 2 517 a Hacker Ignatz Lackenbach F 2 517 b Hacker Ignatz Lackenbach F 2 523 Riegler Regina Kobersdorf F 2 527 Siegar Julius, Margarethe, Stefan u. -

Die Verpfändung Von Parndorf Und Neudorf an Die Stadt Bruck A
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Burgenländische Heimatblätter Jahr/Year: 1953 Band/Volume: 15 Autor(en)/Author(s): Ernst August Artikel/Article: Die Verpfändung von Parndorf und Neudorf an die Stadt Bruck a. d. L. 167-174 ©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at 16 nev. Denare 24 Pfennige wienner und 1 flor. VII Schilling Wiener. 50 Denare „ Copczen“ gelten dagegen V Schilling Wiener.121 Die Königin Witwe Elisabeth hat im Kampfe um den Thron Ungarns für ihren Sohn Ladislaus debet„ cudi et in Viennae et in Hungar. sub eadem liga“ (denarios), darin sollten zur Hälfte reines Silber sein und 200 von ihnen einen Floren gelten.122 Anderseits fühlte sich auch die Königin veranlaßt, der Stadt Ödenburg „ex graciosa donacione condam serenissimorum principum dominorum Ladizlai e Karoli regum Ungarie indelende memorie et confir- matoriis dictorum dominorum regum diclam libertatem vidimus... contineri“.l23 Ladislaus Posthumus selbst prägte dann in Wien einen Weißpfennig nach dem Muster Albrechts und Friedrichs III. mit dem Bindenschild, von dem 150 auf einen Goldgulden gingen.124 Die Wiener Hausgenossen aber klagten,„daz man auswendig zu Pres- burgk und anderen enden gemünsst hat auf der hawsgenossen preg geringer an körn und aufzahV‘. Da müssen wir an den Ricker in Wolfstal denken,125 vielleicht auch an eine Münzstätte in Kittsee. Die Verpfändung von Parndorf und Neudorf an die Stadt Bruck a. d. L. Von August Ernst, Landesarchiv, Eisenstadt Im Jahre 1570 wurde Neudorf bei Parndorf von dem Freiherrn Leon hard IV. von Har rach neu besiedelt. -

Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015
Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 Burgenländische Landesbibliothek Europaplatz 1_A-7001 Eisenstadt_Tel.:02682/600 2358_Fax: 02682/600 2058 E-Mail: [email protected]_www.burgenland.at/landesbibliothek DVR-Nr.:0066737 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 Erstellt aus den Neuzugängen der Burgenländischen Landesbibliothek Medieninhaber (Herausgeber und Verleger): Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7-AB Hauptreferat Landesarchiv und Landesbibliothek Hauptreferatsleitung: WHR Dr. Roland Widder Zusammengestellt von: Michael Hess Eisenstadt 2016 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 2 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 1. Mikrofilmaufnahmen Gebetbuch - Kroatischer Kreuzweg von 1761 aus Trausdorf "Szvéti krisni put toje pohadjanye po kóm je Jesus Kristus ...". - Ödenburg : Joseffi Sieszu, 1761 (In: Mikrofilm Spule 338 - Schloss Rotenturm) Schlagwort: g.Trausdorf ; g.Kroaten ; s.Gebetbuch ; s.Christentum 2. Flugblatt zur Umstellung vom Links- auf den Rechtsverkehr in Niederdonau und im nördlichen Burgenland / Burgenländische Landeshauptmannschaft. - Eisenstadt [Druckort] : Nentwich, [1938]. - 1 Bl. Schlagwort: g.Nordburgenland ; s.Rechtsverkehr ; s.Verkehrsregelung ; s.Straßenverkehr ; z.Geschichte 1938 ; g.Niederdonau ; s.Rechtsverkehr ; s.Verkehrsregelung ; s.Straßenverkehr ; z.Geschichte 1938 Sign.: 59933B 3. Mikrofilm Spule 338 - Schloss Rotenturm : [3 Fotos und 4 Pläne] Schlagwort: g.Rotenturm <Pinka> / Schloss Sign.: 61480Z/Sp338 Anzahl Artikel: 5 Inhaltsangaben: Mikrofilm enthält -

TB 2015 Zusammenstellung Gesamt.Indb
Tätigkeits- bericht 2015 Burgenländische Landwirtschaftskammer Burgenländische Landwirtschaftskammer Tätigkeitsbericht 2015 Tätigkeitsbericht 2015 Inhalt 3 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 4 I. Präsidium/Direktion Bäuerinnenbeirat 6 Liste der Kammerräte 7 Die Ausschüsse 8 Öffentlichkeitsarbeit 10 II. Organisation Interne Organisation / Arbeitgebervertretung 15 III. Förderung Förderung Allgemein 16 IV. Betriebswesen Beratung 26 Ernährung – Landwirtschaft und Konsument 33 Einkommenskombinationen 35 Urlaub am Bauernhof 36 Green Care 37 Lehrlings- und Fachausbildungsstelle 37 ARGE MeisterInnen 41 Landjugend 43 Recht – Steuer – Soziales 48 V. Tierzucht 50 Pferde 55 Rinder 56 Schweine 67 Geflügel 70 Schafe & Ziegen 72 Bienen 73 Farmwild – Aquakulturen – Sonstige 74 Titelfoto: Präsident Ök.-Rat Franz Stefan Hautzinger und Vizepräsident Bürgermeister VI. Pflanzenbau 76 Ök.-Rat Adalbert Resetar feierten im November 2015 ihr 25-jähriges Dienstjubiläum Forstwirtschaft 86 als Präsident und Vizepräsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer Weinbau 92 Obstbau 99 Gemüsebau 106 Impressum: Medieninhaber Burgenländische Landwirtschaftskammer; Pflanzenschutz 111 Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt; Gartenbau 116 Für den Inhalt und das Layout verantwortlich: Matthias Leitgeb, Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt, Tel 02682 / 702-102 Österreichische Hagelversicherung 119 Produktion: Mangold & Kovac Produktionsagentur, BERTA 120 Rosengasse 4, 7021 Draßburg, Tel. 02686/3122; Fax: DW 40 und Leiter, Fachreferenten und Sachbearbeiter der Bgld. Landwirtschaftskammer 122 IZ NÖ Süd, Straße 2, Objekt M60, 2351 Wiener Neudorf, Adressen 125 Tel. 02236/89160-0, Fax: DW 24, [email protected], www.xl-design.at Ehrentafel 126 4 Vorwort Tätigkeitsbericht 2015 Tätigkeitsbericht 2015 Vorwort 5 Die öffentliche Diskussion wurde – auch wieder sehr unsachlich und populistisch – vom Thema Uhudler und TTIP überschattet. Beim Uhudler sorgten Anzeigen für Aufregung, weil entgegen den Bestimmungen zusätzliche Flächen ausgepflanzt wurden, was teilweise zu Rodungsbescheiden führte. -

Landesgesetzblatt Für Das Burgenland
Seite 1 von 2 LANDESGESETZBLATT FÜR DAS BURGENLAND Jahrgang 2020 Ausgegeben am 10. Juli 2020 46. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 7. Juli 2020, mit der Teile des Gebietes der Katastralgemeinden Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Parndorf und Zurndorf zum „Europaschutzgebiet Parndorfer Platte - Heideboden“ erklärt werden [CELEX Nr. 32009L0147] Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 7. Juli 2020, mit der Teile des Gebietes der Katastralgemeinden Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Parndorf und Zurndorf zum „Europaschutz- gebiet Parndorfer Platte - Heideboden“ erklärt werden Auf Grund des § 22b Abs. 1 und 3 und des § 22c des Burgenländischen Naturschutz- und Land- schaftspflegegesetzes - NG 1990, LGBl. Nr. 27/1991, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2019, wird verordnet: § 1 Schutzgebietsgrenzen (1) Teile des Gebietes der Katastralgemeinden Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Parndorf und Zurndorf werden zum „Europaschutzgebiet Parndorfer Platte - Heideboden“ erklärt. (2) Die Fläche des „Europaschutzgebietes Parndorfer Platte - Heideboden“ wurde über Koordinaten im Gauß-Krüger-System BMN M34 erstellt und ist im Koordinatenverzeichnis (Anlage 1) im pdf-Format ausgewiesen. Diese Aufzählung ist konstitutiv. Bestehen Zweifel über den Grenzverlauf, ist die koordinatenbezogene Darstellung der Anlage 1 maßgeblich. (3) In Anlage 2 erfolgt in einem Übersichtsplan im Maßstab 1 : 25 000 die deklarative Darstellung der Ausdehnungsfläche des „Europaschutzgebietes Parndorfer Platte - Heideboden“. (4) In Anlage 3, bestehend aus 14 Detailplänen (3.1 bis 3.14) im Maßstab 1 : 5 000 erfolgt die deklarative planliche Darstellung des „Europaschutzgebietes Parndorfer Platte - Heideboden“. § 2 Schutzzweck Zweck der Verordnung ist die Bewahrung, Entwicklung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der im Gebiet vorkommenden Vogelarten gemäß § 3. -

(Burgenland) Von A. B Ernhauser , Wien
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Jahr/Year: 1970 Band/Volume: 044 Autor(en)/Author(s): Bernhauser Augustin Artikel/Article: Erläuterungen zur Bodenkundlichen Karte der Gemeinden Andau, Tadten, Wallern (Burgenland). 39-49 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at WISS. ARBEITEN BGLD. 44 39—49 EISENSTADT 1970, ÖSTERR. ERLÄUTERUNGEN ZUR BODENKUNDLICHEN KARTE DER GE MEINDEN ANDAU, TADTEN, WALLERN (Burgenland) Von A. Bernhauser, Wien. Die folgende Arbeit stellt eine Teilauswertung der Ergebnisse der österreichischen amtlichen Bodenschätzung dar. Aus rein technischen Gründen folgt die Darstellung nach den Gemeindegrenzen. 1. Die Gemeinde Andau. Das Kartierungsgebiet umfaßt das Gemeindegebiet von Andau; es erstreckt sich von dem eiszeitlichen Schwemmkegel (Würm I nach RIEDL 1964/65; cf. „post — paudorf“ FINK 1965) bis in den Waasen (Hansäg). Wo die ursprüngliche Oberfläche des Schwemmkegels noch erhalten ist, finden wir Paratschernoseme im Sinne FRANZ“ (I960)). Sie zeigen einen in seinen obersten Zonen rotbraunen, entkalkten Schotterkörper, mit wechselnd mächtig aufliegenden, meist grobsandigen mobilen A — Horizonten, die ebenfalls kalkfrei sind. Sie unterliegen heute noch einer deutlichen Windver- und -umlagerung. Bei den, in die Schotter eingela gerten Sandkörpern treten häufig dünenähnliche Gebilde, die an die von RIEDL (1964/65) nach BRUNNACKER (1960) beschriebene aeolische Se dimentdifferenzierung erinnern, auf. Sie zeigen, wo sie als anstehend an gesehen werden können, tiefgründige Entkalkung und einen breiten, rotbraunen Horizont, der als B — Horizont bezeichnet werden könnte, aber analog zur Interpretation der Paratschernoseme (s. str.) auf Schotter (vergl. FRANZ 1960, S. 276) besser als Di bezeichnet wird. In letzterem Falle kann man als Bodentypenbezeichnung „Paratschnosem“ wählen. -

55. Bezirksbewerb Um Das FLA (05.06.2010 in Deutsch-Jahrndorf)
55. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb 2010 05.06.2010 , Deutsch-Jahrndorf Ergebnisliste FLA Bronze, Klasse A Rang Nr. Bewerbsgruppe Bezirk Gesamt Angriff Fehler Staffellauf Fehler Pokalspender 1 1 Andau ND 413,55 32,70 0 53,75 0 LH-StV. Mag. Franz Steindl 2 49 Winden ND 403,47 41,50 0 55,03 0 Vzbgm. Johann Muhr 3 24 Tadten I ND 392,19 35,00 20 52,81 0 Firma Gombay OHG 4 26 Tadten III ND 390,75 45,16 0 64,09 0 GV Gerhard Bachmann 5 25 Tadten II ND 388,34 43,85 10 57,81 0 Landtagsabgeordnete Edith 6 14 Gattendorf ND 386,82 50,53 5 57,65 0 GH Gerald Bachmayer 7 31 Wallern ND 381,09 59,25 0 59,66 0 Raika Dreiländereck Bgld.- 8 41 Mönchhof ND 380,43 62,10 0 57,47 0 LH-StV. Mag. Franz Steindl 9 20 Jois ND 377,92 44,71 20 57,37 0 Mediendesign Eric Kastler 10 44 Pamhagen ND 374,97 54,00 15 56,03 0 Altes Landgut Werdenich 11 3 Deutsch-Jahrndorf I ND 373,55 47,45 25 54,00 0 12 9 Edelstal I ND 371,55 64,76 5 58,69 0 13 17 Halbturn I ND 366,55 66,80 5 61,65 0 14 18 Halbturn II ND 365,43 69,54 5 60,03 0 15 11 Frauenkirchen ND 360,17 55,48 25 59,35 0 16 21 Kittsee ND 356,34 72,97 10 60,69 0 17 22 St. Andrä a.