Landeshauptstadt Sankt Pölten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
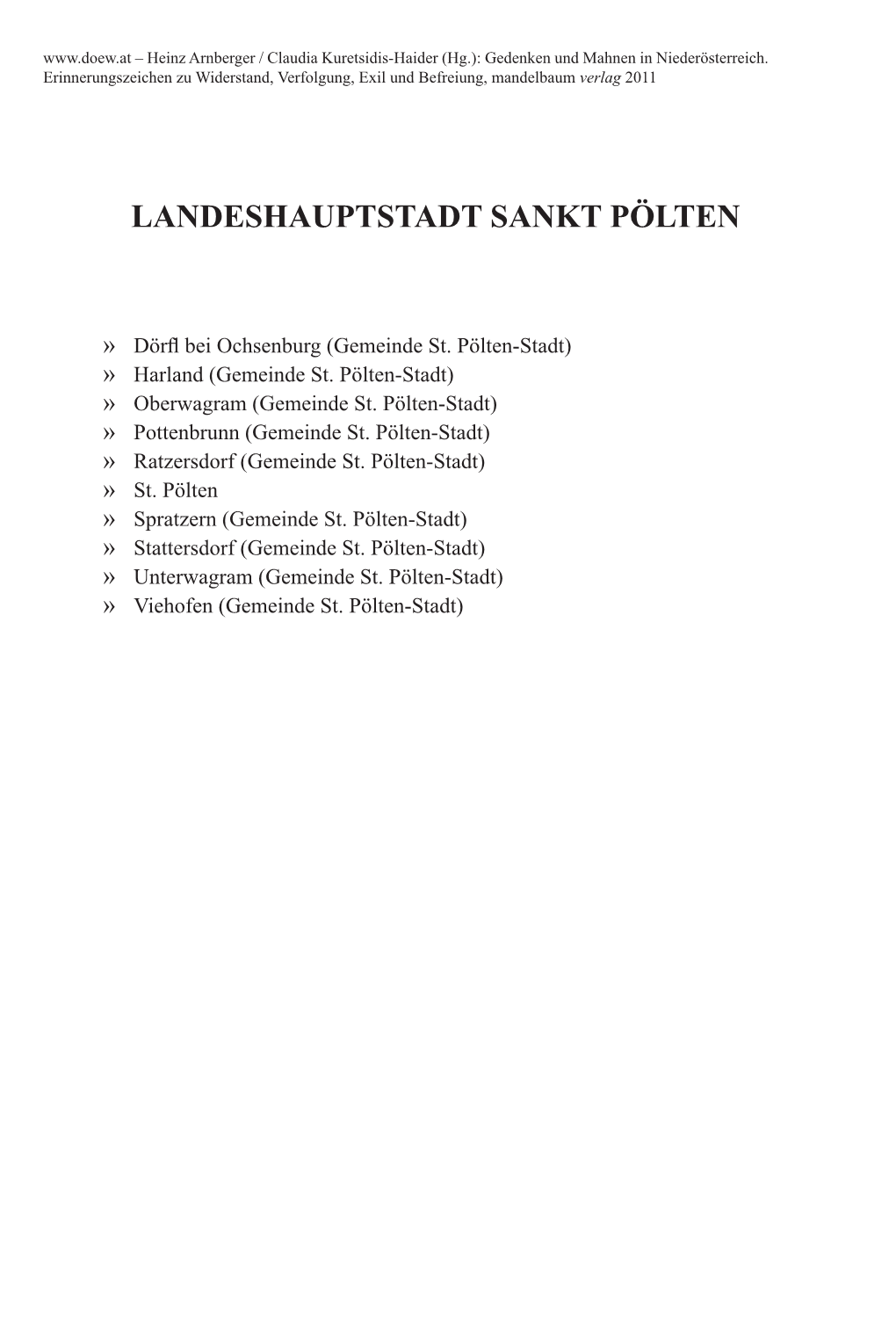
Load more
Recommended publications
-

Tut Gut Wanderkarte (Pdf)
Familienwanderwege Niederösterreichische Waldviertel »TUT GUT«-WANDERWEGE »TUT VonAnreise Wien kommend: mit dem Westautobahn Auto: A1 – Melk – Wei- tenegg – Pöggstall – Würnsdorf – Martinsberg – Bad »TUT GUT«-WANDERWEGE Traunstein oder Wien – Autobahn A22 bis Stockerau – S5 bis Krems – Spitz an der Donau – Ottenschlag – Bad Ausflugstipps: Traunstein BAD TRAUNSTEIN FREIZEITANLAGE BAD TRAUNSTEIN Die Freizeitanlage mit Naturbadeteich bietet einen großen Spielplatz, Tennisplatz und Outdoorplatz zum Basketball- Öffentliche Anreise: spielen, Skaten … und die Hafenbar. Wien Westbahnhof – Postbus mit Route Bad Traunstein TRAUNSTEIN BAD BadCharakteristik: Traunstein liegt auf einer der aussichtsreichsten Kontakt: Erhebungen im Herzen des Waldviertels auf 911 m Seehöhe. Granitgasse 15 3632 Bad Traunstein Es ist eine der schönsten Gemeinden im »steinreichen« SchulgasseNavigationsdaten: 4, 3632 Bad Traunstein Teil des Waldviertels. Die sehenswerte moderne Kirche, Tel.: 02878 6077 umgeben vom imposanten Wachtstein, grüßt weit www.bad-traunstein.at ins von Granitblöcken übersäte sanftwellige Land. Zwettl Zwettl, Horn WACHTSTEIN Waldviertel www.bad-traunstein.at B34 B37 Arbesbach Mit Aussichtsplattform und dem Wohnzimmer im Freien B36 sowie dem Heilkräuter-Schau- und -Lehrgarten. Ottenschlag Spitz Krems BAD TRAUNSTEIN an der Donau Pöggstall Koordinaten: 48.436335, 15.113075 S33 Yspertal B216 B36 B3 Weitenegg Donau Linz B3 Ybbs Pöchlarn St. Pölten AUSSTELLUNGSZENTRUM JOSEF ELTER Linz Melk Wien an der Donau A1 A1 Amstetten Ybbs Pöchlarn Melk Knoten St. -

Region St. Pölten – Alle Linien Auf Einen Blick
Region St. Pölten – alle Linien auf einen Blick 446 (vormals 547) Krems – Traismauer – Sieghartskirchen o Fährt täglich o Sa: Krems – Sieghartskirchen alle 2 Stunden o So- und Feiertags nur zwischen Krems und Traismauer o Bus fährt zwischen Brunnkirchen und Krems direkt über B37 statt über Furth –Mautern – Stein 470 (vormals 1520) St. Pölten – Tullnerfeld Bf. o Fährt täglich o Fährt Mo – Fr jede Stunde und verlängert die Betriebszeit bis 21:00 Uhr o Sa, So- und Feiertags: Alle 2 Stunden mit Anbindung an Tullnerfeld Bf. 471 (vormals 1564) Böheimkirchen – Michelbach o Fährt Mo – Fr jede Stunde o Anpassung an die Unterrichtszeiten der NMS und VS Böheimkirchen o Verbesserte Anbindung an Böheimkirchen Bf. mit Übergangszeiten von 5 – 7 Minuten o Eigene Kurse für Schüler nach Böheimkirchen bzw. St. Pölten 472 (vormals 1566) Böheimkirchen – Stössing o Fährt Mo – Fr jede Stunde o Anpassung an die Unterrichtszeiten der NMS und VS Böheimkirchen o Verbesserte Anbindung an Böheimkirchen Bf. mit Übergangszeiten von 5 – 7 Minuten o Eigene Kurse für Schüler nach Böheimkirchen bzw. St. Pölten 473 (vormals 547 bzw. 7746) Böheimkirchen – Herzogenburg o Fährt Mo – Fr an Schultagen o Neue direkte Verbindung Böheimkirchen – Kapelln – Herzogenburg o Anpassung an die Unterrichtszeiten in Böheimkirchen und Herzogenburg o Anbindung an Böheimkirchen Bf. und Herzogenburg mit Übergangszeiten von max. 10 Minuten 474 (vormals 1564 bzw. 7766) Böheimkirchen – Totzenbach o Fährt Mo – Fr an Schultagen o Direkte Anbindung an die VS und NMS Böheimkirchen o Zusätzlicher Bus in der Früh mit späterer Abfahrtszeit zum Unterrichtsbeginn der VS und NMS Böheimkirchen für Totzenbach, Oberwolfsbach und Doppel o Anbindung der höheren Schulen in St. -

NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvorsorgeabgabe (NÖ GVS)
NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvorsorgeabgabe (NÖ GVS) 3620/1–0 Stammverordung 123/05 2005-12-30 Blatt 1-6 3620/1–1 1. Novelle 17/06 2006-02-27 Blatt 1, 2 3620/1–7 3620/1–2 2. Novelle 92/06 2006-10-25 Blatt 1 3620/1–3 3. Novelle 132/11 2011-12-29 Blatt 2, 3 3620/1–4 4. Novelle 54/12 2012-06-25 Blatt 2 3620/1–5 5. Novelle 144/12 2012-12-28 Blatt 2 3620/1–6 6. Novelle 14/13 2013-03-08 Blatt 2 3620/1–7 7. Novelle 147/13 2013-12-20 Blatt 1, 2 0 Ausgegeben am Jahrgang 2013 20. Dezember 2013 147. Stück Die NÖ Landesregierung hat am 26. November 2013 auf Grund des § 9 Abs. 4 des NÖ Seuchenvorsorgeabgabe- gesetzes, LGBl. 3620–2, sowie der §§ 23 und 24 des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes, LGBl. 1600–5, ver- ordnet: Änderung der NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvorsorgeabgabe (NÖ GVS) 3620/1–7 Artikel I Die NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvor- sorgeabgabe, LGBl. 3620/1, wird wie folgt geändert: 1. Im § 1 Z. 1 entfällt die Wortfolge “und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs”. 2. Im § 1 Z. 8 wird nach dem Wort “Aggsbach,” die Wort- folge “Albrechtsberg an der Großen Krems,” einge- fügt. 3. Im § 1 Z. 8 wird nach dem Wort “Lengenfeld,” die Wortfolge “Lichtenau im Waldviertel,” eingefügt. Artikel II Artikel I tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. Niederösterreichische Landesregierung: Pernkopf Landesrat 0 1. Abschnitt Gemeindeverbände §1 Name, Sitz, beteiligte Gemeinden Es werden folgende Gemeindeverbände gebildet: 1. “Gemeindeverband zur Einhebung der Seuchenvor- sorgeabgabe in der Region Amstetten” (GVS Amstet- ten) mit dem Sitz in Oed-Oehling, bestehend aus den Gemeinden Allhartsberg, Amstet- ten, Ardagger, Aschbach-Markt, Behamberg, Biber- 3620/1–7 bach, Ennsdorf, Ernsthofen, Ertl, Euratsfeld, Ferschnitz, Haag, Haidershofen, Hollenstein a. -

Abschnittsfeuerwehrkommando St.Pölten - Ost | 3071 Böheimkirchen Url Homepage: | Email (System): [email protected]
Abschnittsfeuerwehrkommando St.Pölten - Ost | 3071 Böheimkirchen Url Homepage: http://www.afkdo-plost.at/ | EMail (System): [email protected] vorläufige Ergebnisliste (Stand: 09.06.2019 12:30) Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb 09.06.2019 - 09.06.2019 AFKDO St.Pölten - Ost Rang Gruppenname Instanz AFKDO Nr. Gesamt Bronze o Alterspunkte / Eigene 1 Stössing Stössing St.Pölten - Ost 4 404,13 2 Untergrafendorf Untergrafendorf St.Pölten - Ost 5 403,38 3 Böheimkirchen-Mechters Böheimkirchen-Mechters St.Pölten - Ost 12 394,14 4 Kasten Kasten St.Pölten - Ost 2 379,13 5 Fahrafeld Fahrafeld St.Pölten - Ost 3 378,26 6 Pyhra-Ober Tiefenbach Pyhra-Ober Tiefenbach St.Pölten - Ost 49 372,14 7 Böheimkirchen Ausserkasten-Furth Böheimkirchen Ausserkasten-Furth St.Pölten - Ost 11 359,69 8 Böheimkirchen-Markt Böheimkirchen-Markt St.Pölten - Ost 7 356,74 9 Pyhra-Perersdorf Pyhra-Perersdorf St.Pölten - Ost 13 354,37 10 Michelbach Michelbach St.Pölten - Ost 1 341,32 Bronze mit Alterspunkte / Eigene 1 Wald Wald St.Pölten - Ost 8 379,39 Silber o Alterspunkte / Eigene 1 Fahrafeld Fahrafeld St.Pölten - Ost 20 385,70 2 Untergrafendorf Untergrafendorf St.Pölten - Ost 29 384,65 3 Stössing Stössing St.Pölten - Ost 23 377,96 4 Pyhra-Ober Tiefenbach Pyhra-Ober Tiefenbach St.Pölten - Ost 55 373,21 5 Kasten Kasten St.Pölten - Ost 22 362,16 6 Böheimkirchen-Mechters Böheimkirchen-Mechters St.Pölten - Ost 28 344,82 7 Michelbach Michelbach St.Pölten - Ost 21 339,26 Bronze o Alterspunkte / Abschnitt 1 Karlstetten Karlstetten St.Pölten - West 42 385,84 2 Haunoldstein 1 Haunoldstein -

NÖ Statistisches Handbuch 2017
NÖ Landesstatistik Statistisches Handbuch Eine Servicestelle des Landes Niederösterreich des Landes Niederösterreich 41 Auskunfts- und Servicestelle Informationen nach Verfügbarkeit für alle Interessierten 41. Jahrgang 2017 Projektarbeit Beratung, Mitarbeit und Durchführung Datenauswertung Auf Anfrage und projektbezogen Statistische Erhebungen Im Interesse des Landes Niederösterreich Kontakt Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik – Statistik Landhausplatz 1 3109 St. Pölten E-Mail: [email protected] Tel.: 02742 9005-14241 2 1 5 NÖ Statistisches Handbuch 2017 Statistisches Handbuch des Landes Niederösterreich 41. Jahrgang 2017 1| 215 2 Bezirkstabellen und -grafiken ohne Wien-Umgebung beziehen sich auf den ab 1. 1. 2017 gültigen Gebietsstand (LGBl. Nr. 4/2016), jene mit Werten für Wien-Umgebung auf den bis 31. 12. 2016 gültigen. Datenstände vor 2017 wurden nach Möglichkeit umgerechnet, Sonderfälle sind gekennzeichnet. Falls nicht ausdrücklich anders angegeben, beziehen sich die Tabellen in diesem Handbuch ausschließlich auf das Bundesland Niederösterreich. Die enthaltenen Daten, Tabellen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Trotz sorgfältiger Prüfung des Inhalts kann für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität der in dieser Publikation enthaltenen Informationen keine Gewähr übernommen werden. NÖ Schriften 215 – Information Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Markus Hemetsberger Abteilung Raumordung und Regionalpolitik – Statistik Datenkonvertierung: Laudenbach, 1070 Wien Druck: Druckerei Haider Manuel e. U., 4274 Schönau i. M. Erschienen im Oktober 2017 ISBN 978-3-85006-215-2 3 Vorwort Dynamische Entwicklung und Mut zu Innovation sind zwei wesentliche Eck- pfeiler einer erfolgreichen Landesentwicklung. Um diesen Erfolg auch stetig weiterführen zu können, braucht es eine Art Kontrollinstanz, die in regelmäßigen Abständen die Entwicklung des Bundeslandes aus unterschiedlichen Blick- winkeln beleuchtet. -
Programm 2021 Führungen Und Bildungsveranstaltungen Biosphärenpark Wienerwald Und Partner
PROGRAMM 2021 FÜHRUNGEN UND BILDUNGSVERANSTALTUNGEN BIOSPHÄRENPARK WIENERWALD UND PARTNER Eine Initiative der Länder Niederösterreich und Wien BIOSPHÄRENPARK WIENERWALD PARTNERINNEN Das vorliegende Programm ist in Zusammenarbeit mit dem Netz- werk der Biosphärenpark-BildungspartnerInnen entstanden. Es handelt sich dabei teilweise um Organisationen, die geförderte Programme anbieten, aber auch um selbstständige VermittlerIn- nen bzw. Betriebe, die kostendeckend arbeiten müssen. Daraus und auch auf Grund der verschiedenen Programmlängen und Zusatzleistungen ergeben sich unterschiedliche Preise für die einzelnen Angebote. Die Biosphärenpark Wienerwald GmbH stellt hier lediglich Infor- mationen zur Verfügung und übernimmt keine Haftung für allfäl- lige Schäden oder Gewährleistungsansprüche, die durch Partne- rInnenangebote entstehen können. Die PartnerInnen sind für ihre Angebote selbst verantwortlich. Wir ersuchen umPEFC Verständnis,zertifiziert dass es aufgrund der gesetzlichen Maßnahmen zurDieses Eindämmung Produkt stammt der COVID-19 Pandemie zu Ver- aus nachhaltig schiebungen bzw.bewirtschaftete Änderungenn der Termine und Angebote kom- Wäldern und men kann. Imkontrollierten Zweifelsfall Quellen. empfehlen wir vorab mit dem/der PEFC/06-39-03 VeranstalterInPEFC/06-39-03 ww direktenw.pefc.at Kontakt aufzunehmen. PEFC/06-39-03 PEFC zertifiziert Aktuelle Infos zum Programm der Führungs- und BildungsveranPEFC zertifiziert - Dieses Produkt Dieses Produkt staltungen des Biosphärenpark Wienerwaldstammt aus nachhaltig und seiner Partner- bewirtschafteten -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Exkursionsziele Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele Und Landwirtschaftliche Exkursionsbetriebe Im Bezirk St
... im Bezirk St. Pölten Bezirksbauernkammer St. Pölten Exkursionsziele Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und landwirtschaftliche Exkursionsbetriebe im Bezirk St. Pölten Vorwort Herzlich willkommen im Kammerbezirk St. Pölten, unser Bezirk zeichnet sich in agrarischer Hinsicht durch eine gro- ße Vielfalt aus. Beginnend im Norden reicht unser Bezirk mit dem Weinbaugebiet Traisental bis zur Donau. In dieser Region haben Wein- und Obstbau, aber auch Gemüseproduktion traditionell einen hohen Stellenwert. Im Zentralraum entlang der Westbahn, mit der Landeshauptstadt St. Pölten als Mittelpunkt, gibt es eine dynami- sche Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung, die für die Landwirtschaft nicht nur Vorteile bringt. Dennoch wird dieses Ge- biet landschaftlich durch den Ackerbau geprägt, Schweinehaltung Anna Bracher und Rindermast sind die wichtigsten Produktionszweige. Im Süden Bezirksbäuerin reicht der Bezirk mit dem Pielachtal, durch die Früchte (Dirndln) der Kornelkirsche auch bekannt als Dirndltal, fast bis zur Steiermark. Grünlandbewirtschaftung, Milchproduktion, Rinderzucht und Forst- wirtschaft sind hier die wichtigsten Betriebssparten. Im Raum Neu- lengbach erreicht unser Bezirk die Ausläufer des Wienerwaldes, eine von Äckern, Streuobstwiesen, Weiden und Wald reich struk- turierte Landschaft. – In all diesen Regionen hat die Arbeitsgemein- schaft der Bäuerinnen innovative Betriebe gefunden, die bereit sind, als Exkursionsziele zu Verfügung zu stehen, um dem landwirtschaft- lich interessierten Besucher die Leistungen der Land- und -

Landesparteilisten Landeswahlkreis 3 – NÖ
Nationalratswahl 2019 Landeswahlbehörde für den Landeswahlkreis 3 - Niederösterreich KUNDMACHUNG Gemäß § 49 Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung 1992 - NRWO werden folgende Landeswahlvorschläge (Landesparteilisten) für die Nationalratswahl 2019 veröffentlicht Landesparteilisten für den Landeswahlkreis 3 - Niederösterreich Liste 1 Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP) 1 SOBOTKA, Mag. Wolfgang 1956 Nationalratspräsident 3340 Waidhofen an der Ybbs 20 SCHMID, MSc Susanne 1968 Direktorin VS u. NMS Lichtenegg 2822 Walpersbach 39 FORSTHUBER, Mag. Gottfried 1983 Rechtsanwalt 2500 Baden 58 KERSCH Lena 1995 Studentin 2733 Grünbach am Schneeberg 2 HIMMELBAUER, BSc Eva-Maria 1986 Selbstständig 3741 Pulkau 21 FREISTETTER, Ing. Andreas 1968 Angestellter 3032 Eichgraben 40 YOUNG Regina 1948 Pensionistin 2351 Wiener Neudorf 59 LUEF Johannes 1969 Polizist 2620 Wartmannstetten 3 SCHMUCKENSCHLAGER Johannes 1978 Weinhauer 3400 Klosterneuburg 22 KALAB, Mag. Belinda 1967 Berufsschullehrerin, Dipl.-Päd. 3580 Horn 41 MINNICH Andreas 1974 Unternehmer 2100 Korneuburg 60 PÖLTL Sabrina 1980 Hausfrau 2340 Mödling 4 STEINACKER, Mag. Michaela 1962 Juristin 3002 Purkersdorf 23 BROIDL Franz Xaver 1988 Winzer 3550 Langenlois 42 BOLLWEIN Tamara 1981 Beamtin 3100 St. Pölten 61 SONNAUER Armin 1947 Pensionist 3512 Mautern an der Donau 5 AUER Otto 1966 Landwirt 2465 Höflein 24 STIFT Catharina 1973 Selbstständig 3430 Tulln an der Donau 43 MAYR, Ing. Lorenz 1982 Landwirt 2002 Steinabrunn 62 HAGHOFER, BSc Anna 1996 Ergotherapeutin 3910 Zwettl 6 BERGER-GRABNER, Mag. Dr. Doris 1978 Angestellte 3500 Krems an der Donau 25 RÄDLER Christian 1974 Geschäftsführer 2822 Bad Erlach 44 ZEIDLER-BECK, Mag., MBA Marlene 1987 Kampagnenmanagerin 2344 Maria Enzersdorf 63 SMUK, Ing. Alexander 1978 Unternehmer 2603 Felixdorf 7 HINTEREGGER, Ing., BA Florian 1989 Angest., Leitstellenl. -

Frauenstudienzirkel-Rosa-Jochmann
Frauenstudienzirkel 12. Jänner 2012 EINE ERINNERUNG AN ROSA JOCHMANN (1901-1994) ZUM 110. GEBURTSTAG Rosa Jochmann, wurde am 19. Juli 1901 in Wien-Brigittenau geboren. Die Eltern sind wie viele andere, vor der Jahrhundertwende in der Hoffnung auf bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen aus Mähren nach Wien gekommen. Ihre Kindheit beschreibt sie als „armselig“, aber glücklich. Ihre Mutter Josefine, Wäscherin und Bedienerin, war eine fromme Katholikin, der Vater Karl, Eisengießer, Sozialdemokrat. Es gab insgesamt sechs Kinder. Die Mutter, starb früh, auch zwei der Geschwister. Die Wohnung bestand, wie bei vielen anderen ArbeiterInnenfamilien aus einem Zimmer und einer Küche, sogenannte „Bettgeher“ sollten helfen das Familieneinkommen aufzubessern.1 Im Elternhaus wurde tschechisch gesprochen. Die Mutter beherrschte auch die deutsche Sprache, der Vater hat sie nie richtig erlernt. Er hat die Kinder im Auftrag der Mutter regelmäßig die Kirche gebracht, hat aber an den Messen selbst nicht teilgenommen. Die politische Sozialisation Rosa Jochmanns erfolgte durch den Vater: er nahm die Tochter zu den Versammlungen der tschechischen SozialdemokratInnen in Simmering mit. Über den Betten hingen analog zu dieser Familiensituation die Portraits von Karl Marx, Ferdinand Lassalle und ein Bild der „Heiligen Familie“. „Und wenn ich gebetet habe, dann habe ich immer zum Karl Marx gebetet. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wer das ist. Aber weil er so gütig ausgeschaut hat und einen so schönen Bart gehabt hat, da habe ich mir immer gedacht, so schaut der liebe Gott aus“. 2 Berufswünsche - Träume vom „süßen Leben“ Rosa Jochmann wollte zunächst Nonne wären, später Lehrerin, doch für eine Ausbildung konnte der Vater nicht aufkommen (die Mutter ist 1915 gestorben). -

Nationalsozialismus in Der Österreichischen Provinz
Am Umschlag: "Beschauschein vom 11. 4. 1945. Der Beschauarzt verübte beim Zusammenbruch Selbstmord." Aus: Erlaftal-Bote, 90. Jg., Nr. 17, 23. April1980. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST, 46. JG. 1991 I NR. 4, öS 50,- 1 WlFIBJM_~ ' EDITORIAL INHALT Historische Forschung und Vermittlung darf nicht Jacqueline Vansant auf Gedenktage und Jubiläen beschränkt bleiben. NATIONALSOZIALISMUS UND Der Arbeitskreis "Nationalsozialismus in der Öster• AUTOBIOGRAPHIEN VERFOLGTER reichischen Provinz" versucht die insbesonders FRAUEN ... :. 2 durch das Gedenkjahr 1938/88 in Fluß gekommene Beschäftigung mit dem deutschen Faschismus in Klaus-Dieter Mulley Österreich interdisziplinär weiterzuführen und auch "AHNENGAU DES FÜHRERS" Lokalforschern eine Plattform für die Präsentation Alltag und Herrschaft in "Niederdonau" und Konfrontation ihrer Forschungsergebnisse zu 1 938-1945 . 7 geben. Die folgenden Beiträge zeigen eine Vielfalt der Zugänge zum regionalen und lokalen Gesche hen. Eine Ablöse der "alten Heimatgeschichten", in Franz Steinmaßl welchen die Zeit 1938 bis 1945 ausgeklammert DAS HAKENKREUZ IM HÜGELLAND oder auf die Erwähnung von ein paar überregiona• Widerstand und Verfolgung im len Ereignissen beschränkt, somit die Mitwirkung ei Bezirk Freistadt 1938-1945 ................ 18 nes Großteils der Bevölkerung an der Etablierung und Aufrechterhaltung des NS-Regimes schamhaft Ernst Langthaler verschwiegen wurde, scheint sich anzubahnen. Im THESEN ZUR GESELLSCHAFTS Arbeitskreis werden nicht nur Regional- oder Lokal GESCHICHTE DES NATIONAL geschichten diskutiert, sondern - wie der Beitrag SOZIALISMUS AM BEISPIEL "Nationalsozialismus und Autobiographien verfolg FRANKENFELS 1932-1956 ................ 22 ter Frauen" zeigt - auch "überregionale" Aspekte und Konsequenzen des Nationalsozialismus vorge tragen, besprochen und zum "heimatlichen" Ge Robert Streibel schehen in Beziehung gesetzt. Was Altred Pfoser in DIE "GAUHAUPTSTADT" KREMS einem anderen Zusammenhang schrieb, gilt auch Eine Geschichte in vier Bildern ............. -
Weinstraßen-Betriebe Im Traisental
Weinstraßen-Betriebe im Traisental AUF ZUM HEURIGEN HERZOGENBURG JÄN FEB MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ Sitzenberg-REIDLING JÄN FEB MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ Helmut Kern 4 Winzerhof Familie Hinterleitner 24.5. 12.7. 19.10. 70 Weinbegleiterwanderung zum Korkenzieher mit anschließendem Heurigenabend Ahrenberger Kellergasse, 3454 Sitzenberg-Reidling, DIE WINZER Birkengasse 14, 3130 St. Andrä, – – – nach telefonischer Voranmeldung (für Gruppen bis zu 20 Personen) T/F 02782/825 42, tägl. ab 12 Uhr, 6.6. 25.7. 29.10. T 02276/20 00, M 0664/170 83 92 Weinverkauf ganzjährig HERZOGENBURG 72 Heuriger Familie Heinrich und Eva Redl 12.1. 27.4. 17.8. 26.10. Winzerhof Kaiser Ahrenberger Keller gasse, 3454 Sitzenberg-Reidling, – – – – Wein & Heuriger Familie Baumgartner 111 26.1. 20.4. 7.8. 2 Untergasse 12, 3130 Einöd, – – – T 02276/23 24, M 0664/252 05 70, 25.1. 10.5. 30.8. 8.11. Heuriger im Stiftsmeierhof, 3130 Herzogenburg, T 02782/867 96, tägl. ab 9 Uhr 5.2. 1.5. 20.8. Mo-Sa ab 14 Uhr, So ab 10 Uhr M 0664/134 59 63, Heuriger Familie Keiblinger www.weinundheurigerbaumgartner.at, tägl. ab 9 Uhr INZERSDOrf-GETZERSDORF JÄN FEB MAR APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ 95 26.7. Anton Keiblingerstraße 19 & 21, 3454 Sitzenberg-Reidling, – Stiftsweingut Herzogenburg 125 Heuriger & Weinhof Englhart-Schoderböck 1.5. 25.11. M 0676/384 87 55, www.karpfenwein.at, 8.8. Wielandsthal 1, 3130 Herzogenburg, 11 Dorfstraße 24, 3131 Inzersdorf, – – Mo-Sa ab 15 Uhr, So ab 10 Uhr M 0664/173 14 22, www.stiftsweingut-herzogenburg.com T 02782/821 51, www.englhart.co.at, 14.5.