Warum Der Braunkohlenplan Welzow-Süd II Abgelehnt Werden Muss Seite 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
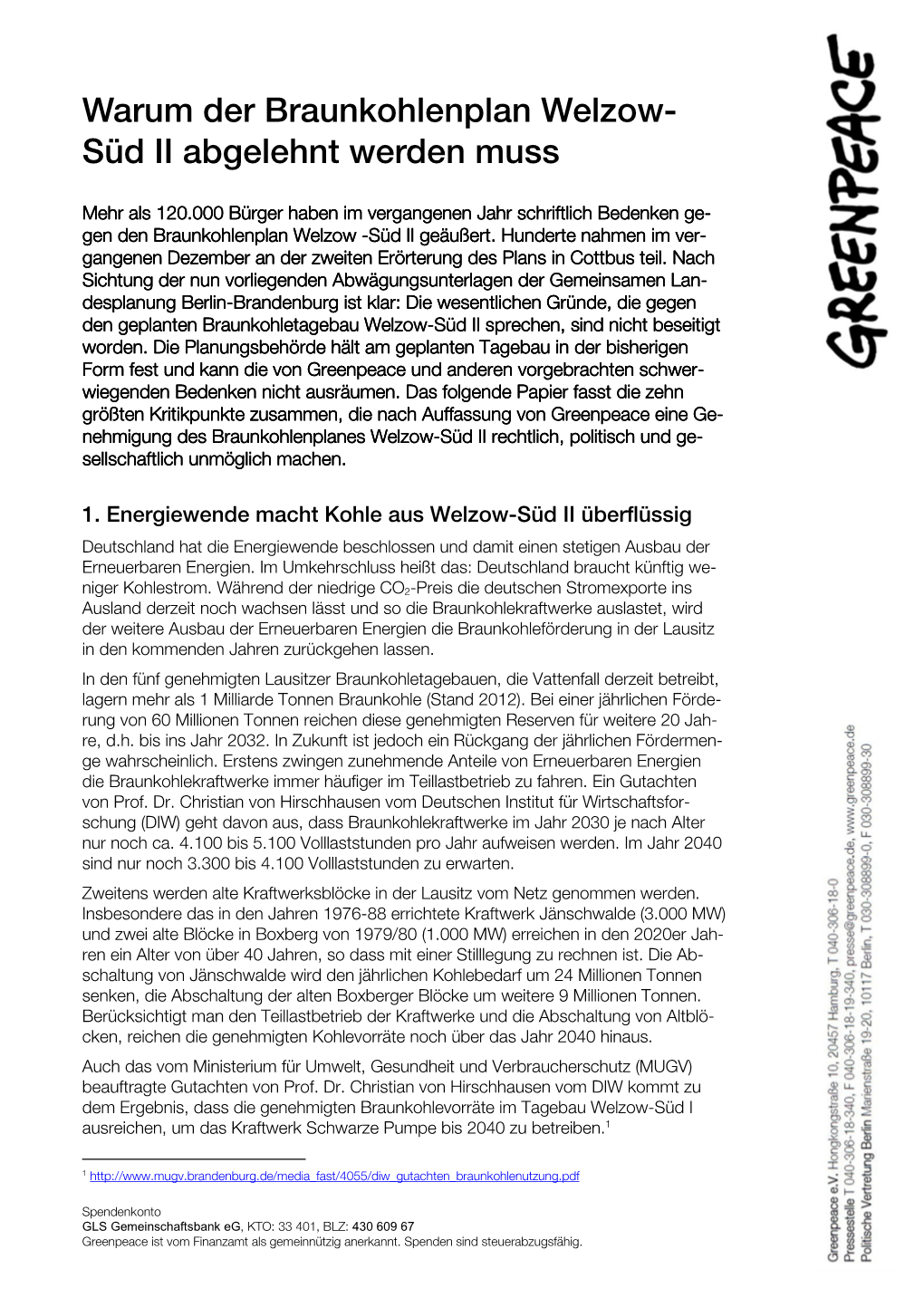
Load more
Recommended publications
-

Gemeinde Kolkwitz Mehr Zum Thema Auf Seite 9
26. JAHRGANG 1|19 26. JANUAR 2019 FÜR DIE BLAGEMEINDETT KOLKWITZ mit den Ortsteilen Babow, Brodtkowitz, Dahlitz, Eichow, Glinzig, Gulben, Hänchen, Kackrow, AKleinA Gaglow,mts Kolkwitz, Krieschow, Kunersdorf, Limberg, Milkersdorf, Papitz, Wiesendorf, Zahsow Inhalt Amtlicher Teil Seite 8 Seite 18 - Veranstaltungen im Februar - Angebote für Kinder und Jugendliche in den Seite 2 - Buchempfehlung der Bibliothek Winterferien - Lärmaktionsplanung Stufe 3 Seite 9 Seiten 22 - 32 - Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen- - Gedenkfeier für Pfarrer Fritze derjahr 2019 - Fastnachten und Zampern in den Ortsteilen Seite 11 Seite 27 nicht Amtlicher Teil - Stellenausschreibung Leiter Bauverwaltung - Gemeindeschwester Irene Starick erinnert Seiten 3 - 15 Seiten 14 - 15 sich. Ein Interview mit Gerhard Zilz - Informationen aus dem Rathaus/Grußwort - Kolkwitzer Neujahrsempfang mit Ausblick auf das Jahr 2019 und Rückschau des Jahres Seite 35 Seite 7 - Der KSV lädt zur Mitgliederversammlung - Veränderungen in der Kolkwitzer Feuerwehr 2018 Am 15. Januar stand in und an der Kolkwitzer Kirche der einstige Pfarrer Johann Friedrich Fritze im Mittelpunkt. Mit einer Andacht und Kranzniederlegung wurde anlässlich des 200. Todestages sein Wirken vor allem bei der Übersetzung des Alten Testamentes in die wendische Sprache gewürdigt. Großes Interesse gab es an der imposanten Ahnentafel des Pfarrers Johann Friedrich Fritze. Hier nehmen die beiden Gulbener, Mechthild Scholz (vorn) und Doreen Schiemenz, gekleidet in wendischer Kirchgangstracht, die Ahnen des Pfarrers in Augenschein. Foto: Gemeinde Kolkwitz Mehr zum Thema auf Seite 9 Januar 2019 Seite 1 Amtlicher Teil Lärmaktionsplanung Stufe 3 Die Gemeinde Kolkwitz ist verpflichtet nach § 47 d Abs. 1 i.V.m. § Öffnungszeiten im Zimmer 1.11 des Rathauses zur Einsichtnahme 47e Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) den Lärm- ausgelegt und gleichzeitig auf der Homepage der Gemeinde aktionsplan der Stufe 3 aufzustellen. -

Amtsblatt Welzow April 2021.Pdf
Stadt Welzow 1 Welzow, den 31.03.2021 Monat April Nummer 4 IMPRESSUM: Amtsblatt für die Stadt Welzow mit dem • Verantwortlich für Für Anzeigenveröffentlichungen gelten die allgemeinen Geschäftsbe- Ortsteil Proschim. Anzeigenteil und Druck: dingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste des Verlages. Für Druck und Satz, unverlagt an die Verwaltung oder den Verlag eingesandte Manuskripte • Herausgeber: GbR Mayer und Lorz und Fotos wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Stadt Welzow Gewerbestraße 17 e-mail: Veröffentlichung. Für Anzeigeninhalte übernimmt Druck und Satz ebenfalls 01983 Großräschen [email protected] keine Haftung. Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal monatlich und • Verantwortlich für den amtlichen Tel.: 035753 177-03 [email protected] wird an alle Haushalte in der Stadt Welzow kostenlos verteilt. und nichtamtlichen Teil: Fax: 035753 177-00 www.drucksatz.com Auflagenhöhe: 2.500 Exemplare Die Bürgermeisterin • Verantwortlich für die Für Personen, die von dieser Verteilung nicht erreicht werden, liegt das • Redaktionelle Bearbeitung: Verteilung des Welzower Boten: „Amtsblatt für die Stadt Welzow mit dem Ortsteil Proschim (Welzower Die Bürgermeisterin Frau Zuchold, KG WochenKurier Bote)“ im Rathaus (03119 Welzow, Poststraße 8, Bürgerservice) ko- Poststraße 8, 03119 Welzow, Verlagsgesellschaft mbH & Co. Brandenburg stenlos aus. Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Telefon 035751 250-0, Fax 250-22, Geierswalder Str. 14, 02979 Bergen Herausgeber zu beziehen. www.wochenkurier.info -

16-03-03 Anlage Waldbrandalarmplan 2016
Forst Anlage zum Waldbrandalarmplan 2016 Landesbetrieb Forst Brandenburg Oberförsterei Cottbus Oberförsterei Drebkau Waldbrandzentrale Peitz Landeswaldoberförsterei Peitz Waldbrandgefahrenstufe 1 sehr geringe Gefahr 2 geringe Gefahr 3 mittlere Gefahr 4 hohe Gefahr 5 sehr hohe Gefahr Stand: 03.03.2016 2 Oberförsterei Cottbus August-Bebel-Straße 27 03185 Peitz Waldbranddiensthandy: 0173/ 99 76 429 Telefon: 035601/ 37130 Fax: 035601/ 37133 e-mail: [email protected] [email protected] Oberförsterei Drebkau Drebkauer Hauptstraße 12 03116 Drebkau Waldbranddiensthandy: 0173/ 99 76 430 Telefon: 035602/ 5191823 Fax: 035602/ 5191820 e-mail: [email protected] Landeswaldoberförsterei Peitz August-Bebel-Straße 27 03185 Peitz Diensthandy: 0172/ 30 64 218 Telefon: 035601/ 37132 Fax: 035601/37113 e-mail: [email protected] 3 Waldbrandzentrale Peitz Arbeitsplätze Kamera 035601 / 371-19 Diensthandy: 0173/ 99 76 433 FAX Waldbrandzentrale: 035601 / 371-25 Dienstzeiten: Besetzung der Waldbrandzentrale vom 01. März bis 30. September Montag bis Sonntag MEZ MESZ Waldbrandgefahrenstufe 3 9 - 17 Uhr 10 - 18 Uhr 4 9 - 18 Uhr 10 - 19 Uhr 5 9 - 19 Uhr 10 - 20 Uhr Bei Gefahrenstufe 1 und 2 erfolgt keine Besetzung. Notruf: 112 Telefon Fax Leitstelle Lausitz 0355/6320 0355/632-138 Dresdener Straße 46 03050 Cottbus [email protected] Zuständig für: Stadt Cottbus, Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Elbe-Elster 4 Dienstzeiten: Diensthabender je Oberförsterei vom 01. März bis 30. September Montag bis Sonntag MEZ MESZ Waldbrandgefahrenstufe 2 und 3 9 - 17 Uhr 10 - 18 Uhr 4 9 - 18 Uhr 10 - 19 Uhr 5 9 - 19 Uhr 10 - 20 Uhr Bei Gefahrenstufe 1 erfolgt kein Dienst. -

Entwurf – Arbeitsstand 28.03.2013
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II - Nr. 58 vom 2. September 2014 3 Anlage 1 zu § 1 der Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den räumlichen Teilabschnitt II und Änderung im räumlichen Teilabschnitt I (Brandenburgischer Teil) Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II - Nr. 58 vom 2. September 2014 4 Inhaltsübersicht 0 Vorbemerkungen .......................................................................................................................................................3 1 Allgemeines.................................................................................................................................................................5 1.1 Definition, Zielstellung und Inhalt des Braunkohlenplans.....................................................................................5 1.1.1 Definition.....................................................................................................................................................................5 1.1.2 Zielstellung ..................................................................................................................................................................5 1.1.3 Inhalt............................................................................................................................................................................5 1.2 Rechtsgrundlagen und Bindungswirkungen, Verhältnis zu anderen Raumordnungsplänen .............................6 -

MTSBLATT Für Die Stadt Welzow Mit Dem Ortsteil Proschim (Welzower Bote)
MTSBLATT für die Stadt Welzow mit dem Ortsteil Proschim (Welzower Bote) Welzow, den 02.05.2011 Jahrgang 22 Nummer 05 IMPRESSUM: Für Anzeigenveröffentlichungen gelten Auflagenhöhe: 2.500 Exemplare Amtsblatt für die Stadt Welzow mit • Verantwortlich für den die allgemeinen Geschäftsbedin- dem Ortsteil Proschim. Anzeigenteil: gungen und die z.Z. gültige Anzeigen- Für Personen, die von dieser Verteilung Druckerei Greschow preisliste des Verlages. nicht erreicht werden, liegt das „Amts- • Herausgeber: Stadt Welzow Kochstraße 23, Für unverlangt an die Verwaltung oder blatt für die Stadt Welzow mit dem Orts- 03119 Welzow, den Verlag eingesandte Manuskripte teil Proschim (Welzower Bote)“ im • Verantwortlich für den amtlichen Telefon 035751 28158, Fax 27082 und Fotos wird keine Haftung übernom- Rathaus (03119 Welzow, Poststraße 8, und nichtamtlichen Teil: e-mail: men. Es besteht kein Anspruch auf Ver- Bürgerservice) kostenlos aus. die Bürgermeisterin [email protected] öffentlichung. Für Anzeigeninhalte Einzelexemplare sind gegen Kostener- • Redaktionelle Bearbeitung: übernimmt die Druckerei Greschow stattung über den Herausgeber zu be- • Druck und Verlag: Die Bürgermeisterin Frau Zuchold, ebenfalls keine Haftung. ziehen. Druckerei Greschow, Poststraße 8, 03119 Welzow, Das Amtsblatt erscheint mindestens vertreten durch den Geschäftsführer Telefon 035751 250-0, Fax 250-22, einmal monatlich und wird an alle www.druckerei-greschow.de e-mail: [email protected] Haushalte in der Stadt Welzow kosten- los verteilt. Inhaltsverzeichnis Amtlicher Teil S. 2 - Amtliche Bekanntmachung, Beschlüsse aus der Sitzung des Hauptausschusses am 23.03.2011 - Amtliche Bekanntmachung, Beschluss aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2011 - Amtliche Bekanntmachung, Bekanntmachung Beschlüsse aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06.04.2011 S. 3 - Amtliche Bekanntmachung, Auslegung des Abschlusses des Wirtschaftsjahres 2009 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Welzow S. -

Liste Der Wahlberechtigten Mitarbeiterinnen Und Mitarbeiter, Stand 19.05.2020
Liste der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stand 19.05.2020 Nachname Vorname Dienststelle Tätigkeit Dienstort wählen wählbar Ahmatova Svetlana KG Forst Reinigungskraft Kita Forst x x Albrecht-Paßora Kathrin KK Cottbus Erzieherin Kita Bodelschwingh x Alexander Bernd KG Werben Friedhofsarbeiter KG Werben x x Alizada Murtaza KK Cottbus Hausmeistergehilfe Kita Forst x Anspach Sabine KK Cottbus Erzieherin Kita Klostersternchen x x Aschendorf Michaela KG Jänschwalde Bache Steffi KK Cottbus Erzieherin Kita Forst x x Ballaschk Gisela KK Cottbus Erzieherin Kita Lutherrose x Ballat Suitbert KK Cottbus Hausmeisterdienste KG Luther /Kloster x x Banke H.-Jürgen KG Drebkau Friedhofsmitarbeiter KG Drebkau x x Baron Anett KG Cottbus-Süd Erzieherin Kita St.Martin x x Batram Olaf KG Dissen Pflege Außenanlagen KG Dissen x x Batzk Marianne KK Cottbus Erzieherin, Leitung Kita Kita Bodelschwingh x Beck Jeanne Estelle KK Cottbus Erzieherin Kita Bodelschwingh x x Behla Sabrina KK Cottbus Erzieherin Kita Bodelschwingh x x Behla Steffen KK Cottbus Erzieher Kita Arche Noah x x Benke Ludmilla Michael KG Spremberg Reinigungskraft Michael KG Spremberg x x Bihler Heike KK Cottbus Erzieherin Kita Melanchthon x x Bischoff Monika KG Cottbus-Süd Erzieherin, Leitung Kita Kita st.Martin x Blanck Sylvia KK Cottbus Erzieherin Kita Welzow x x Böttcher Martin KG Forst Friedhofsverwaltung KG Region Forst x x Bolech Dorothea KG Welzow Verwaltung KG Welzow Budischin Lydia KG Burg Kantorkatechetin KG Burg x x Bunar Annette KK Cottbus Erzieherin Kita Kloster x x Christoph Dietmar KG Burg Hausbesuchsdienst KG Burg x x Christoph Manuela KK Cottbus Erzieherin Kita Arche Noah x x Drews Jana KK Cottbus MA Öffentlichkeitsarbeit KK Cottbus x x Dombrowski Susanne KG Burg Büroangestellte KG Burg x x Drogan Susanne Kloster KG Cottbus Kantorin Klosterkirche x x Engwicht Elisabeth KK Cottbus Dipl. -

Welzow, Den 08.03.2019 Monat März Nummer 3 Inhaltsverzeichnis
Stadt Welzow 1 Welzow, den 08.03.2019 Monat März Nummer 3 IMPRESSUM: Amtsblatt für die Stadt Welzow mit dem • Verantwortlich für Für Anzeigenveröffentlichungen gelten die allgemeinen Geschäftsbe- Ortsteil Proschim. Anzeigenteil und Druck: dingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste des Verlages. Für Druck und Satz, unverlagt an die Verwaltung oder den Verlag eingesandte Manuskripte • Herausgeber: GbR Mayer und Lorz und Fotos wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Anspruch Stadt Welzow Gewerbestraße 17 e-mail: auf Veröffentlichung. Für Anzeigeninhalte übernimmt Druck und Satz 01983 Großräschen [email protected] ebenfalls keine Haftung. Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal mo- • Verantwortlich für den amtlichen Tel.: 035753 177-03 [email protected] natlich und wird an alle Haushalte in der Stadt Welzow kostenlos verteilt. und nichtamtlichen Teil: Fax: 035753 177-00 www.drucksatz.com Auflagenhöhe: 2.500 Exemplare Die Bürgermeisterin • Verantwortlich für die Für Personen, die von dieser Verteilung nicht erreicht werden, liegt das • Redaktionelle Bearbeitung: Verteilung des Welzower Boten: „Amtsblatt für die Stadt Welzow mit dem Ortsteil Proschim (Welzower Die Bürgermeisterin Frau Zuchold, KG WochenKurier Bote)“ im Rathaus (03119 Welzow, Poststraße 8, Bürgerservice) ko- Poststraße 8, 03119 Welzow, Verlagsgesellschaft mbH & Co. Brandenburg stenlos aus. Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Telefon 035751 250-0, Fax 250-22, Geierswalder Str. 14, 02979 Bergen Herausgeber zu beziehen. www.wochenkurier.info -

Haftungsfreistellungsverfahren Für Altlasten Im Landkreis Spree-Neiße
LCKW-Kontamination der ehemaligen Textilreinigung in Forst - Die etwas andere Sanierung- Dipl.-Ing. (FH) Maik Müller Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde Landkreis Spree-Neiße [email protected] 25. Bodenschutzforum 13.09.2017 IHK Ostbrandenburg Sanierung von LCKW-Schäden Textilreinigung Forst Gliederung 1. Lage 2. Historischer Abriss 3. Bisherige Untersuchungen 4. Untersuchung / Ergebnisse 2016 Außenluft (KITAs / Spielplätze) Boden (KITAs / Spielplätze) Bodenluft Grundwasser 5. Weitere Maßnahmen 6. Fazit 13.09.2017 - Bodenschutzforum Landkreis Spree-Neiße IHK Ostbrandenburg Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 2 Textilreinigung Forst Gemeinde Schenkendöbern Stadt Guben 1. Lage Amt Peitz Amt Burg (Spreewald) Gemeinde Kolkwitz Kreisstadt Forst (Lausitz) Gemeinde Neuhausen/Spree Stadt Drebkau (Niederlausitz) Amt Döbern-Land Stadt Spremberg Stadt Welzow 13.09.2017 - Bodenschutzforum Landkreis Spree-Neiße IHK Ostbrandenburg Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 3 Textilreinigung Forst 2. Historischer Abriss Betriebszeitraum von 1902 bis 1992 anfangs mit Benzin gereinigt in den 30er Jahren Umstellung auf Trichlorethen (TRI) pro Jahr wurden ca. 45 t – 50 t TRI verbraucht, ca. 30 % Verlust, u. a. auch auf das unkontrollierte Überlaufen des Auffangbehälters zurückzuführen ab ca. 1975 durch Tetrachlorethen (PER) abgelöst 13.09.2017 - Bodenschutzforum Landkreis Spree-Neiße IHK Ostbrandenburg Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 4 Textilreinigung Forst 2. Historischer Abriss 1995 bis -

Amtlicher Teil
Amtsblatt-Februar_Muster SPN-Kurier.qxd 07.02.2017 09:23 Seite 1 Jahrgang 10 • Forst (Lausitz), den 10. Februar 2017 • Nummer 02 Inhaltsverzeichnis AMTLICHER TEIL AMTLICHER TEIL ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Fünfter Vertrag zur Änderung des öffentlich-rechtlichen ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Vertrages zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und Fünfter Vertrag zur Änderung - der Gemeinde Kolkwitz Seite 1 - dem Amt Burg (Spreewald) Seite 2 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur - dem Amt Peitz Seite 2 Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Achter Vertrag zur Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Durchführung der Aufgaben nach Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg § 12 Abs. 1 Satz 2 Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg zwischen dem vom 24.11.2009 Landkreis Spree-Neiße und - der Stadt Forst (Lausitz) Seite 2 - dem Amt Döbern-Land Seite 3 Zwischen dem Landkreis Spree-Neiße, vertreten durch den Landrat, - der Stadt Drebkau Seite 3 - im Folgenden: Landkreis - - der Stadt Guben Seite 3 und der - der Gemeinde Neuhausen/Spree Seite 4 Gemeinde Kolkwitz, vertreten durch den Bürgermeister - der Gemeinde Schenkendöbern Seite 4 - der Stadt Spremberg Seite 4 - im Folgenden: Gemeinde - - der Stadt Welzow Seite 5 wird zur teilweisen Änderung des zwischen den Vertragsparteien am 24.11.2009 vereinbar - SONSTIGE AMTLICHE MITTEILUNGEN ten öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 S. 2 Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages der Stadt Welzow zur Erteilung einer Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG), zuletzt geändert durch den Vierten Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Seite 5 Änderungsvertrag vom 05.11.2015 folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen: Neues Verfahren für den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr Seite 5 § 1 Änderung von Abschnitt III Ziffer 1 NICHTAMTLICHER TEIL Abschnitt III Ziffer 1 wird durch folgende Regelungen ersetzt: 1. -

Amtsblatt Oktober 2018 (3,9 Mib)
Stadt Welzow 1 Welzow, den 28.09.2018 Monat Oktober Nummer 10 IMPRESSUM: Amtsblatt für die Stadt Welzow mit dem • Verantwortlich für Für Anzeigenveröffentlichungen gelten die allgemeinen Geschäftsbe- Ortsteil Proschim. Anzeigenteil und Druck: dingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste des Verlages. Für Druck und Satz, unverlagt an die Verwaltung oder den Verlag eingesandte Manuskripte • Herausgeber: GbR Mayer und Lorz und Fotos wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Anspruch Stadt Welzow Gewerbestraße 17 e-mail: auf Veröffentlichung. Für Anzeigeninhalte übernimmt Druck und Satz 01983 Großräschen [email protected] ebenfalls keine Haftung. Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal mo- • Verantwortlich für den amtlichen Tel.: 035753 177-03 [email protected] natlich und wird an alle Haushalte in der Stadt Welzow kostenlos verteilt. und nichtamtlichen Teil: Fax: 035753 177-00 www.drucksatz.com Auflagenhöhe: 2.500 Exemplare Die Bürgermeisterin • Verantwortlich für die Für Personen, die von dieser Verteilung nicht erreicht werden, liegt das • Redaktionelle Bearbeitung: Verteilung des Welzower Boten: „Amtsblatt für die Stadt Welzow mit dem Ortsteil Proschim (Welzower Die Bürgermeisterin Frau Zuchold, KG WochenKurier Bote)“ im Rathaus (03119 Welzow, Poststraße 8, Bürgerservice) ko- Poststraße 8, 03119 Welzow, Verlagsgesellschaft mbH & Co. Brandenburg stenlos aus. Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Telefon 035751 250-0, Fax 250-22, Geierswalder Str. 14, 02979 Bergen Herausgeber zu beziehen. www.wochenkurier.info -

1. Branitzer Park 2. Flugplatz Neuhausen 4. Talsperre
® 1. Branitzer Park ® 13. Ostdeutscher Rosen- Der Branitzer Park, das zweite große garten Forst (Lausitz) Lebenswerk von Herrmann Fürst von Umrahmt von Pergolenhöfen und ro- Pückler-Muskau, gilt als Höhepunkt mantischen Wasserspielen blühen zehn- der deutschen Gartenkultur und letz - tausend e Rosen in mehr als 900 Sor - ter deutscher Landschaftsgarten des ten. Der historische Park (1913), heute 19. Jahrhunderts. Historische Räume mit Restaurant und Kinderspielplatz, in Schloss und Marstall, inmitten des bietet ganzjährig eine zauberhafte Parks, vermitteln Einblicke in das Le- Kulisse für einen erholsamen Spazier - ben und Werk des großen Garten- gang. Tipp: die traditionell am letzten künstlers, Literaten und Weltreisen - Juniwochenende stattfindenden Rosen - den. garten-Festtage, u.a. mit Schnittrosen - schau und „Nacht der 1000 Lichter“. ® ® 2. Flugplatz Neuhausen 14. Brandenburgisches Der Verkehrslandeplatz Neuhausen Textilmuseum Forst (Lausitz) lädt zu einem Rundflug über die Nie - Die Rosenstadt war einst Metropole derlausitz ein. Auch Fallschirmsprin - der Textilindustrie. Bewahrt wird diese gen, Drachenfliegen oder Ballonfahr - Tradition vom Brandenburgischen Tex - ten sind hier möglich. tilmuseum, welches sich in einem alten Fabrikgebäude aus dem Jahr 1897 befindet. Funktionstüchtige historische Maschinen können in Aktion erlebt und zum Teil auch selbst ausprobiert werden. ® 3. Strittmatters ® 15. Wasserkraftwerk, „Laden“, Bohsdorf Grießen Bohsdorf, die Heimat des Schriftstel - Ein Beispiel für alternative Energiege - lers Erwin Strittmatter, heißt in seinen winnung – herrlich in der Neißeaue Romanen „Bossdom“. Der Original- gelegen. Seit 1993 wird hier auf Priva - Laden ist als Gedenkstätte wiederher - tinitiative wieder Strom erzeugt. Vom gerichtet. Auf einem 2,5 km langen Aussichtsturm bietet sich ein herrlicher Rundweg zum Felixsee sind weitere Ausblick auf die Neißelandschaft. Originalschauplätze des Romans zu be- sichtigen. -
Bürgerbroschüre LK SPN 4. Auflage
Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa www.landkreis-spree-neisse.de 4. Auflage 2020 Der attraktive Arbeitgeber in der Region Biella-Falken GmbH · Am Bahnhof 5 · 03185 Peitz www.falken.eu 4 Landkreis Spree-Neiße / Wokrejs Sprjewja-Nysa Inhaltsverzeichnis 7 Vorwort 8 Der Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa 10 Tourismus 12 Radeln nach Zahlen zwischen Spree und Neiße 15 Kleiner Wegweiser durch das Kreishaus 16 Die Kreisverwaltung 18 Sprechzeiten und Außenstellen der Fachbereiche 20 Kartografie 22 Übersicht der Ämter, Städte und Gemeinden und deren Ortsteile 24 Amt Burg (Spreewald) 24 Amt Peitz 25 Amt Döbern-Land 25 Gemeinde Schenkendöbern 26 Gemeinde Neuhausen/Spree 26 Gemeinde Kolkwitz 27 Stadt Drebkau 28 Stadt Spremberg 29 Stadt Welzow 29 Eurostadt Guben-Gubin 30 Rosenstadt Forst (Lausitz) 32 Der Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße 32 Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Spree-Neiße 33 Centrum für Innovation und Technologie GmbH 35 »Internationale Folklorelawine« 36 Der Kreistag 38 Pflegekindern ein liebevolles zu Hause geben Impressum 38 (D)eine Zukunft verwalten beim Landkreis Herausgeber: Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Redaktion: Pressestelle Gesamtherstellung: Verlag Reinhard Semmler GmbH www.verlag-semmler.de Akquise: Gerd Rubin Fotos: Rainer Weisflog S10, S12, S23; K. Möbes S24 oben; Amt Peitz/Kliche S24 unten; Melanie Köder S25 oben; Gemeinde Schenkendöbern S25 unten; Gemeinde Neuhausen/ Spree S26 oben; Gemeinde Kolkwitz S26 unten; M. Wentworth S27; A. Adam S28; Stadt Welzow S29 oben; Stadt Guben S29 unten; A. Schild S30; Redaktionsschluss: 2020 Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, so wie Vervielfältigung jeglicher Art sind untersagt. 19-36 Landkreis Spree-Neiße / Wokrejs Sprjewja-Nysa 5 6 Landkreis Spree-Neiße / Wokrejs Sprjewja-Nysa Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, Lube cytarki a cytarje, mittlerweile liegen 26 ereignisreiche Jahre naš wokrejs ma mjaztym 26 połnych tšo- hinter unserem Landkreis, der im Dezember jenjow lět za sobu.