Anlage 1 Zur Grdrs …………
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
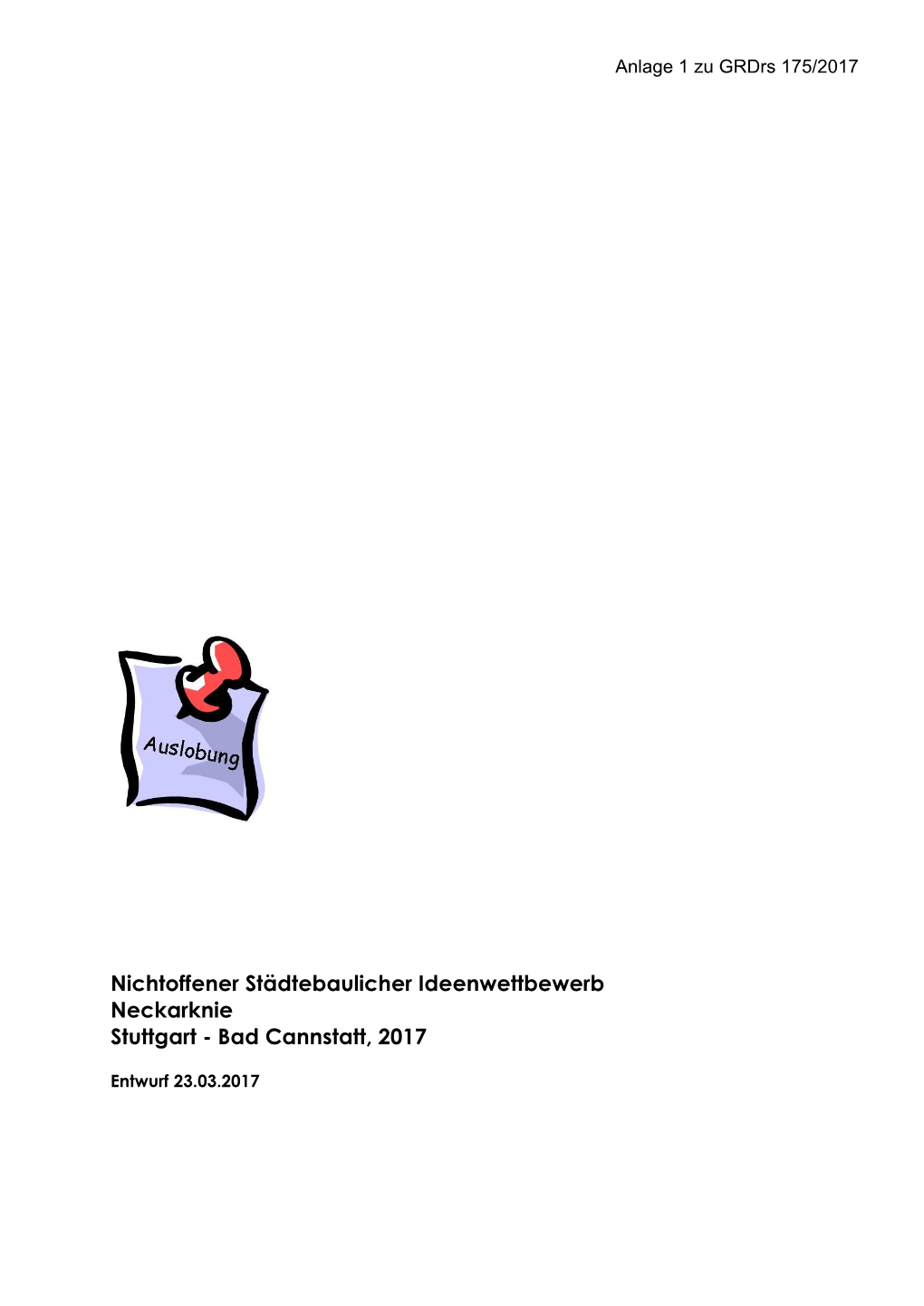
Load more
Recommended publications
-

Alstom Digitalises Stuttgart 21
PRESS RELEASE Alstom digitalises Stuttgart 21 • 130 million-euro contract is an important enabler to increasing capacity and safety in busy Stuttgart • Alstom will equip 215 S-Bahn trains with next generation European Train Control System and Automatic Train Operation technology - an important building block for the full digitalization of the Stuttgart rail node 24 June 2021 – Alstom has signed a contract with Deutsche Bahn’s (DB) DB Regio AG to equip 215 of Stuttgart, Germany’s S-Bahn trains with the European Train Control System (ETCS) and Automatic Train Operation (ATO) signalling technology. Part of the landmark rail project known as Stuttgart 21, the contract will see Alstom retrofit the BR 423 and BR 430 trains operating in the greater Stuttgart area’s S-Bahn and conventional railway lines. The contract is worth around 130 million euro. Implementing ETCS Level 2 and Level 3 as well as ATO in automation level 2 (GoA 2) will ensure more sustainable operation, shorter headways and a denser train sequence, while supporting the associated relief of individual trains. With an overall smoother flow of rail traffic, passengers can look forward to more frequent service and faster connections. “By equipping the vehicles with the latest signalling technology and the innovation partnership with Deutsche Bahn, we are jointly making a decisive contribution to the implementation of the Stuttgart 21 lighthouse project and the digitalisation of German rail transport,” says Michael Konias, Head of Digital & Integrated Systems at Alstom for Germany, Austria and Switzerland. “This signalling contract for the Stuttgart S-Bahn is another demonstration of the valuable synergies resulting from Alstom’s acquisition of Bombardier Transportation. -

21 Gute Gründe Für Stuttgart 21
21 GUTE GRÜNDE FÜR STUTTGART 21 Die guten Argumente überwiegen das Bahnprojekt stuttgart–ulm Das Land Baden-Württemberg, Stutt- gart und seine Region sind seit Jahr- zehnten Motoren des Fortschritts. Hier wurde Technikgeschichte ge- schrieben, hier wurden neue Ent- wicklungen eingeleitet und wichtige Akzente im Städtebau gesetzt. Eine gewaltige Ingenieurleistung ist der Stuttgarter Bahnhof aus dem vergangenen Jahrhundert, der in der Gegenwart jedoch an seine Grenzen stößt. Die technische Entwicklung ist vorangeschritten und Stuttgart hat bekommt einen leistungsfähigeren, Zusätzlich wird eine moderne Hoch- lassen Fahrzeiten kürzer werden und jetzt die Chance, an diese Entwick- unterirdischen Bahnknoten und der geschwindigkeitsstrecke bis nach die Menschen bequemer reisen. lung in einzigartiger Weise Anschluss Hauptbahnhof eine neue Bahnsteig- Ulm gebaut: die Neubaustrecke Dieses Projekt umfasst eine Vielzahl zu gewinnen. halle. Wendlingen–Ulm. Stuttgart 21 bildet von Maßnahmen zur Verbesserung zusammen mit der Neubaustrecke der Infrastruktur sowie zur Aufwer- Stuttgart 21 ermöglicht es, die Stadt Die oberirdischen Bahngleise werden Wendlingen–Ulm das Bahnprojekt tung der Lebensqualität in Stuttgart. für die Zukunft zu stärken und durch abgetragen. Auf ihrer Fläche kann ein Stuttgart–Ulm. Innovationen und Investitionen neuer Stadtteil und eine erweiterte Viele gute Gründe sprechen für das neue Akzente zu setzen. Stuttgart Parklandschaft entstehen. Schnellere regionale Verbindungen Bahnprojekt Stuttgart–Ulm. Richtung Karlsruhe, DAS BAHNPROJEKTBahnprojekt -

Bebauungsplan Mit Satzung Über Örtliche Bauvorschriften Rosensteintunnel / Leuzetunnel (Ca 264) in Den Stadtbezirken Bad Canns
Landeshauptstadt Stuttgart GRDrs 111/2012 Referat Städtebau und Umwelt GZ: StU Stuttgart, 14.09.2012 Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften Rosensteintunnel / Leuzetunnel (Ca 264) in den Stadtbezirken Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost - Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB und § 74 LBO mit Anregungen i.S.v. § 3 (2) BauGB Beschlussvorlage Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin Ausschuss für Umwelt und Technik Vorberatung öffentlich 02.10.2012 Ausschuss für Umwelt und Technik Vorberatung öffentlich 09.10.2012 Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 25.10.2012 Dieser Beschluss wird nicht in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen. Beschlussantrag Der Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften Rosensteintunnel / Leuze- tunnel (Ca 264) in den Stadtbezirken Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost wird in der Fassung vom 06.06.2011 / 31.01.2012 nach § 10 BauGB und § 74 LBO als Satzung beschlossen. Es gilt die Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan vom 06.06.2011 / 31.01.2012 und der Landschaftspflegerische Begleitplan vom 03.06.2011 / 31.01.2012. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Kartenausschnitt auf dem Titelblatt der Begründung mit Umweltbericht (Anlage 2) dargestellt. Zur Sicherung der externen Aus- gleichsmaßnahmen für Mauereidechsen wird ein externer Geltungsbereich im Bereich des Travertinparks / Cannstatter Halde festgesetzt. Der Geltungsbereich dieser Aus- gleichsmaßnahme ist in der Anlage 3 dargestellt. Es gingen 1645 Äußerungen von Bürgerinnen und Bürgern während der beiden Auslagen ein. 2 Anregungen gingen verspätet mit Datum vom 28. August 2012 ein. Viele Bürgerin- nen und Bürger haben sich in gleich lautenden Anregungen zu dem Bebauungsplan Ro- senstein- /Leuzetunnel geäußert und sich dabei grundsätzlich gegen das Projekt ausge- sprochen. Bei vielen Anregungen können die beschriebenen Befürchtungen/Bedenken widerlegt oder ausgeräumt werden. -
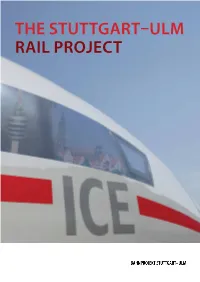
The Stuttgart–Ulm Rail Project Information Contents
THE STUTTGART–ULM RAIL PROJECT INFORMATION CONTENTS WWW.BAHNPROJEKT-STUTTGART-ULM.DE/EN/ENGLISH/ ON THE CONSTRUCTION SITE 4–5 WHAT IS THE STUTTGART–ULM RAIL PROJECT? The latest information on all construction sites of the Stuttgart–Ulm rail project: www.bsu.link/auf-der-baustelle 6–9 THE NEW INFRASTRUCTURE MEDIA CENTRE 10 –11 TRANSPORT BENEFITS Webcams, construction site photos, films and many other media resources: www.bsu.link/media-library 12 –13 FIND OUT MORE TOURS Experience the construction site live on a variety of guided tours: Fold-out page NUMBERS, FIGURES, FACTS www.bsu.link/guided-tours 14 –15 THE NEW MAIN STATION CONTACT: Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. 16 –17 URBAN DEVELOPMENT Turmforum Im Hauptbahnhof 18 –19 WORK AND BUSINESS | PARTNERS AND FINANCING Arnulf-Klett-Platz 2 70173 Stuttgart, Germany Phone: +49 (0)711 2092 2920 20 –21 ECOLOGY Email: [email protected] www.bsu.link/turmforum-exhibition 22 –23 CONSTRUCTION METHODS AND LOGISTICS WHAT IS THE STUTTGART–ULM RAIL PROJECT? The Stuttgart–Ulm rail project encompasses available for urban development in the very heart benefit from the shorter journey times and in- Stuttgart and Baden-Württemberg as a place to live Stuttgart 21 and the new section of track between of the city. creased numbers of direct connections offered and work. More jobs and a larger population mean Wendlingen and Ulm. by the rail project. In addition, the Stuttgart–Ulm higher revenues for city and state. The Stuttgart– SHORTER JOURNEY TIMES rail project is part of the impor-tant European long- Ulm rail project is also an ecological one: surveys TWO SUB-PROJECTS, AND MORE DIRECT CONNECTIONS distance corridor from Paris to Bratislava, which have shown that Stuttgart 21 and the new section MANY ADVANTAGES is being developed into a high-speed route. -

Stuttgart 21 Rail Project Plan Approval Procedure. an Ethical Considerations Approach
Stuttgart 21 rail project plan approval procedure. An ethical considerations approach. _ _ Contents 1 Introduction 3 2 Society and large-scale projects in Europe 3 2.1 Is it possible to enjoy wealth while developing infrastructure for thefuture? .............................. 4 2.2 Comparison to large-scale projects in emerging countries . 5 2.3 TheSwissmodel ........................... 5 3 The Stuttgart 21 plan approval procedure 6 4 The actors and their positions 6 4.1 Against . 7 4.2 Infavor ................................ 7 5 Discussion 8 5.1 Analysis of the argumentation of the actors . 8 5.2 EthicalCycleandindependentanalysis . 9 6 Conclusion & Recommendations 11 1 Summary Taking the plan approval procedure of the German Stuttgart 21 railway project the essay discusses how the approval of a large-scale project should be ethically conducted in order to avoid public conflicts while ensuring the governments ability to promote polemic projects. The insight that virtually always there will be disadvantaged citizens affected by a project in densely populated areas such as Germany is thereby essential. This notion generated the ethical dilemma between caring for affected individuals and the society that profits on the long term. Approval procedures in other countries are depicted in order to have some reference of other approaches to this problem. Then the Stuttgart 21 project is laid out in more detail. The actors and their positions are explained. The discussion analyses the standpoints of the involved parties with an ethical ap- proach. Thereafter, the ethical cycle is developed using principles of ethical reasoning and ethical theories. From the insights gained at the ethical cycle, the conclusion is drawn that the efficient approval of a large-scale project like Stuttgart 21 should allow more public participation. -

Stuttgart 21 – List of Flaws & Gaps
Stuttgart 21 – List of Flaws & Gaps A working paper of Ingenieure22 with a selection of defects, risks and criticisms (As of 04.07.2018) Foreword Stuttgart 21 should really be a "lighthouse project". Therefore it must come as a great disappoint ment to the protagonists, if today this project which has still not once been completely planned and approved and which is structurally still in its early stages is accused of such a complete list of deficiencies. Already in 1998, the former CEO of Deutsche Bahn Johannes Ludewig stopped the Stuttgart 21 project and referred to it as "simply too big and too expensive for the Deutsche Bahn". But then politics intervened, because it was realised that through the construction of an underground rail way, there would be a chance to build properties in the centre of Stuttgart, in place of the existing railway lines. To justify this, supporters of the project established the objectively false assertion that the terminus station had reached its absolute performance limits. And they went so far as to make the dubious assertion that Stuttgart 21 could perform twice as well as the existing terminus station. The state of BadenWürttemberg, the region and the city of Stuttgart lured the railway into continuing the planning work on Stuttgart 21: A highly overpriced transport contract was conclu ded, the airport link was subsidised, and already in 2001 the city of Stuttgart bought the track are as from the Deutsche Bahn and waived any interest payments until at least 2019. And so it was that those at the head of the rail company also tossed their reservations (which were more than ju stified from today's perspective) over board, and took over the implementation responsibility for Stuttgart 21. -
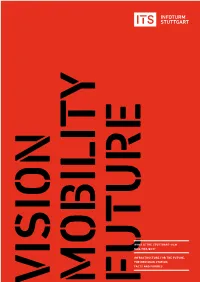
What Is the Stuttgart–Ulm Rail Project?
WHAT IS THE STUTTGART–ULM RAIL PROJECT? INFRASTRUCTURE FOR THE FUTURE, THE NEW MAIN STATION, FACTS AND FIGURES. OVERVIEW 03 AUGMENTED REALITY EXPERIENCE 20 THE PROJECT VIRTUALLY 1. DOWNLOAD THE FREE “ITS-BROSCHÜRE” APP FROM THE APP STORE OR GOOGLE PLAY. 2. SELECT THE “SCANNEN” MENU ITEM. 3. SCAN PAGES WITH THE AUGMENTED REALITY SYMBOL 15 AND VIEW DIGITAL CONTENT. THE 10 PROJECT AT A GLANCE 04 THE STUTTGART–ULM RAIL PROJECT 06 INFRASTRUCTURE FOR THE FUTURE 10 THE NEW MAIN STATION 14 FAST AND DIRECT TRAVEL 16 THE ROSENSTEIN QUARTER 18 BWEGT – PUBLIC TRANSPORT FOR THE FUTURE 20 AN EFFICIENT S-BAHN SERVICE FOR THE REGION 22 “DEUTSCHLANDTAKT” AND DIGITAL HUB 24 SUSTAINABILITY 26 CONSTRUCTION PROCESS AND LOGISTICS 28 FACTS AND FIGURES 0 32 FURTHER INFORMATION 34 PUBLISHING INFORMATION STUTTGART–ULM RAIL PROJECT STUTTGART–ULM RAIL PROJECT 04 05 Thanks to shorter journey times, the economic THE STUTTGART–ULM RAIL PROJECT TWO SUB-PROJECTS, centres of Stuttgart, Ulm and Munich are CONSISTS OF TWO SUB-PROJECTS: growing closer together. A HOST OF BENEFITS STUTTGART 21 AND THE NEW WENDLINGEN–ULM SECTION. The owner of the Stuttgart–Ulm Rail Project is Deutsche Bahn, which is tackling the project Around 120 kilometres of new track are together with its partners. These are: being built. THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY The Stuttgart–Ulm Rail Project will bring THE STATE OF BADEN-WÜRTTEMBERG tremendous changes and improvements for THE STATE CAPITAL OF STUTTGART WHAT IS THE Stuttgart and the State of Baden-Württem- THE VERBAND REGION STUTTGART AND berg. 75 percent of people in Baden-Württem- STUTTGART AIRPORT. -

Dt.1.2.7 Accessibility to Stuttgart Airport
DT.1.2.7 ACCESSIBILITY TO STUTTGART AIRPORT WRS, 21.08.2017 Analysis of the mulimodal mobility system in Version 1 the local airport FUA 09 2017 Table of Contents 1. Introduction............................................................................................ 2 2. Stuttgart Airport and the functional urban area (FUA) ...................................... 2 2.1. General describtion ............................................................................... 2 2.2. Airport facts and figures ......................................................................... 3 2.3. Facts on enviromental and social engagement.............................................. 4 3. Characterisation of the mobility system ........................................................ 5 3.1. Airport access to Stuttgart and the FUA ...................................................... 5 3.1.1. Characterisation of road network and services .......................................... 6 3.1.2. Characterisation of rail network and services ............................................ 7 3.2. On demand mobility services ................................................................... 8 3.2.1. Car-sharing ........................................................................................ 8 3.2.2. Ride-sharing ...................................................................................... 9 3.2.3. Other on-demand services .................................................................... 9 4. Mobility information systems .................................................................... -
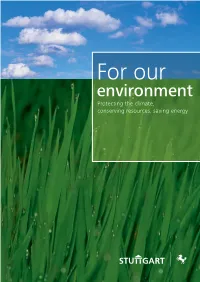
Environment Protecting the Climate, Conserving Resources, Saving Energy for Our Environment Protecting the Climate, Conserving Resources, Saving Energy Introduction
For our environment Protecting the climate, conserving resources, saving energy For our environment Protecting the climate, conserving resources, saving energy Introduction The City of Stuttgart looks back on a long and great supply. We are continuing to reduce CO2 emissions, tradition of safeguarding our habitat and natural re- and making a concerted effort to ensure effective soil sources. First concerns were raised in the 19th Century and water conservation, to expand our green spaces as Stuttgart underwent rapid growth in the wake of the and renaturize brownfield sites and so preserve recre- industrial revolution, turning the city basin into a caul- ational areas and a healthy natural habitat for ourselves dron swathed in smog and fumes. Awareness of the and for wildlife. We are cutting down on noise pollu- significance of woodlands and of public green spaces tion, reducing particulate and extending the cycle path and the importance of their preservation for the com- network, with all the associated health benefits. We munity as a whole was raised at that time by the civic provide grants for energy saving homes, support initia- commitment of the Preservation Trust associated with tives by children and young people to make a differ- the Waldheim movement, a Christian initiative to estab- ence to the environment, run a tree adoption scheme lish independently operated woodland centres of recre- and are appreciative of the personal commitment ation for workers. shown by all Stuttgart’s citizens. We use the city’s own waste management company to recycle raw materials Stuttgart was also the first city to establish its own De- and we extract energy from effluent. -

Delft University of Technology Review of Planning and Capacity Analysis for Stations with Multiple Platforms – Case Stuttgart
Delft University of Technology Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21 Hansen, Ingo A. DOI 10.1016/j.jrtpm.2016.12.002 Publication date 2017 Document Version Accepted author manuscript Published in Journal of Rail Transport Planning & Management Citation (APA) Hansen, I. A. (2017). Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21. Journal of Rail Transport Planning & Management, 6(4), 313-330. https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2016.12.002 Important note To cite this publication, please use the final published version (if applicable). Please check the document version above. Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons. Takedown policy Please contact us and provide details if you believe this document breaches copyrights. We will remove access to the work immediately and investigate your claim. This work is downloaded from Delft University of Technology. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to a maximum of 10. © 2017 Manuscript version made available under CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Postprint of Journal of Rail Transport Planning & Management Volume 6, Issue 4, January 2017, Pages 313-330 Link to formal publication (Elsevier): https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2016.12.002 Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – case Stuttgart 21 Ingo A. -

A Case Study of Stuttgart 21, Germany
The Landscape of Gap Built Upon Environmental Subjects: A Case Study of Stuttgart 21, Germany Degree of Master of Science (Two Years) in Human Ecology: Culture, Power and Sustainability 30ECTS CPS: International Master’s Programme in Human Ecology Human Ecology Division Department of Human Geography Faculty of Social Science Lund University Author: Chih-Kan Hsieh Supervisor: Richard Langlais Spring Term 2012 1 Human Ecology Division, Department of Human Geography, Faculty of Department: Social Science, Lund University Address: Geocentrum 1, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sweden Telephone: +46 46 2228417 Supervisor: Richard Langlais The Landscape of Gap Built Upon Environmental Subjects: Title and Subtitle: A Case Study of Stuttgart 21, Germany Author: Chih-Kan Hsieh Examination: Master’s thesis (two year) Term: Spring Term 2012 Abstract This research explores the project Stuttgart 21, which is going to reconstruct the main station of Stuttgart city and build new tunnels to connect the node with the high-speed line. This project has been triggering controversies over issues such as cost, risk, ecology, and public participation, and thus raised intense conflicts between supporters and opponents. Thus, this research aims to explore how both sides manage to claim their own legitimacy that can potentially stop or progress Stuttgart 21, and aims to outline how those actions of legitimacy claiming shape the landscape of gap. With materials from online news / forum / articles and the interviews conducted in field work, this research found that both sides – as environmental subjects – had their own interpretations of what proper actions should be, which were shaped and controlled under specific governmentality. -

Stuttgart 21 Und NBS Wendlingen-Ulm
1 2 Deutschland Germany Tunnel 7/2009 Stuttgart 21 und NBS Stuttgart 21 and new Wendlingen–Ulm Wendlingen–Ulm Route H. Azer, B. Engel H. Azer, B. Engel Das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz The European high-speed railway network is der Eisenbahnen wird kontinuierlich being continuously expanded. An important ausgebaut. Ein wichtiger Teil dieser Planungen element of these plans will be represented by ist das Großprojekt Stuttgart 21 und Neubau- the major project Stuttgart 21 and the new Ulm strecke Wendlingen–Ulm, das im folgenden – Wendlingen route (NBS), which is presented Beitrag vorgestellt wird. in the following report. 1 Magistrale für plan als Vorhaben des vordring- 1 Arteries for Europe (NBS) (see box on project histo- Europa lichen Bedarfs aufgenommene ry). Aus- und Neubaustrecke in The European high-speed Das europäische Hochge- Richtung München in Verlänge- railway network (Trans-Euro- 1.1 Development of schwindigkeitsnetz der Eisen- rung der Neubaustrecke (NBS) pean Network) is being contin- Travelling Times bahnen (Transeuropäische Netz- Mannheim–Stuttgart schaffen. uously expanded. The major In addition to the expansion werk) wird stetig ausgebaut. Bereits 1988 wurde von Prof. project Stuttgart 21 – Wend- of the mainline arteries for Zentral auf der Magistrale für Heimerl ein Durchgangsbahn- lingen–Ulm is located centrally Europe, Stuttgart 21 will provide Europa von Paris über Straß- hof in Stuttgart und in der on the European arteries from substantial improvements and burg, Stuttgart, München, Wien Weiterführung in Richtung Ulm Paris via Strasbourg, Stuttgart, cuts in travelling times for local bis nach Bratislava bzw. Buda- eine autobahnnahe Trasse vor- Munich, Vienna right up to and regional traffi c as well.