Luchs-Monitoring Im Pfälzerwald
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
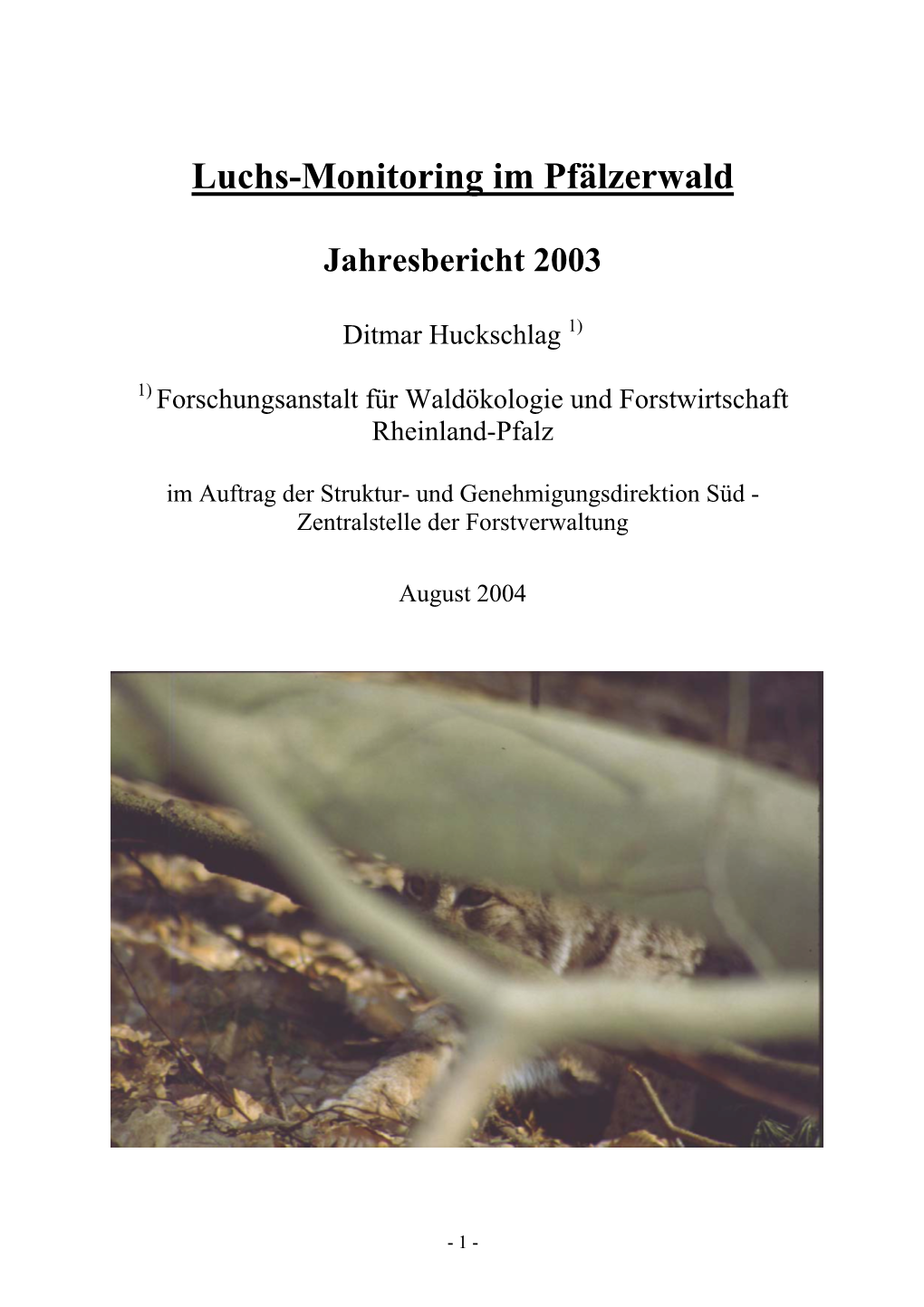
Load more
Recommended publications
-

Der Pfälzische Königsweg
Der Pfälzische Königsweg Copyright © 16.06.2016 by Alwin Müller. All Rights Reserved. Der Pfälzische Königsweg Inhaltsverzeichnis Wegbeschreibung ............................................................................................................... 3 1. Etappe: Herz-Jesu-Kloster – Hohe Loog (618,7 m) ............................................................. 5 2. Etappe: Hohe Loog (618,7 m) -- Taubenkopf (603,8 m) ..................................................... 8 3. Etappe: Taubenkopf (603,8 m) -- Kalmit (672,6 m) ......................................................... 10 4. Etappe: Kalmit (672,6 m) -- Stotz (603,2 m) ................................................................... 11 5. Etappe: Stotz (603,2 m) -- Hochberg (635,3 m) .............................................................. 12 6. Etappe: Hochberg (635,3 m) -- Blättersberg (617,5 m) ..................................................... 16 7. Etappe: Blättersberg (617,5 m) -- Roßberg (637,0 m) ...................................................... 18 8. Etappe: Roßberg (637,0 m) -- Kesselberg (661,8 m) ........................................................ 24 9. Etappe: Kesselberg (661,8 m) -- Steigerkopf (613,6 m) .................................................... 28 10. Etappe: Steigerkopf (613,6 m) -- Morschenberg (Platte) (608,3 m) .................................. 30 11. Etappe: Morschenberg (Platte) (608,3 m) -- Schafkopf (616,8 m) .................................... 32 12. Etappe: Schafkopf (616,8 m) -- Rothsohlberg (607,1 m) ................................................ -

Forschungsbericht
Forschungsbericht Grenzwertüberschreitende Radiocäsiumkontamination von Wildschweinfleisch in Rheinland-Pfalz Eine Mageninhaltsanalyse erlegter Wildschweine aus dem westlichen Pfälzerwald Ulf Hohmann & Ditmar Huckschlag Transferpfad von Radiocäsium im Wildschwein Fließgleichgewicht Verzögerungseffekt Gewebe Niere Radiocäsium Magen-Darm in der Nahrung Radiocäsium im Urin Internetdokument der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz Zitationsvorschlag: Hohmann, U. & D. Huckschlag (2004): Forschungsbericht – Grenzwertüberschreitende Radiocäsiumkontamination von Wildschweinfleisch in Rheinland-Pfalz - Eine Mageninhaltsanalyse erlegter Wildschweine aus dem westlichen Pfälzerwald. Internetdokument der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland- Pfalz, 64 S. Adresse: www.fawf.wald-rlp.de Ulf Hohmann und Ditmar Huckschlag, FAWF Rheinland-Pfalz - Abt. Wald- und Wildökologie Zur grenzwertüberschreitenden Radiocäsiumkontamination von Wildschweinfleisch in Rheinland-Pfalz Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung............................................................................................................. 4 2 Danksagung........................................................................................................................ 5 3 Einleitung ........................................................................................................................... 6 3.1 Ausgangslage ............................................................................................................ -

Wasserversorgungsplan Rheinland-Pfalz Teilgebiet 8
Wasserversorgungsplan Rheinland-Pfalz Karte 1 Teilgebiet 8 - Versorgungsstruktur Moosalbe Obernheim- Kirchenarnbach Bechhofen Weselberg Rosen- kopf Wiesbach Hetten- hausen Horbach Schmalenberg Knopp-Labach 3 Käshofen Krähenberg Geiselberg Saalstadt e b Hermersberg l 1 a Bieders- Wallhalben s Steinalben o Klein- hausen o M 7 bundenbach Schmits- Schauer- hausen berg Heltersberg Herschberg Winterbach Groß- 2 Waldfischbach- bundenbach Burgalben Höheinöd ach 6 Waldfischbach - zb ar Reifenberg Burgalben w Leimen Battweiler ch S Maßweiler Thaleischweiler - Fröschen Clausen Zweibrücken, Donsieders Stadt Thaleischweiler - Rieschweiler- 12 Fröschen R 4 od Schwarzbach Mühlbach a Merzalben l 8 h b Zweibrücken S ac Höhfröschen Hornbach chwarzb Rodalben Contwig Petersberg 5 Rodalben, Stadt Dellfeld Höheischweiler Nünschweiler 11 Walshausen Münchweiler a. d. Pirmasens Rodalb Dietrichingen 9 Alt- hornbach Kleinstein- hausen Großstein- Ruppertsweiler hausen Bottenbach Pirmasens, Stadt rnbac Ho h Hornbach, Stadt Mauschbach Rodalb Riedelberg Vinningen Ober- simten Lemberg Kröppen Trulben Schweix 10 Hilst Eppenbrunn Versorgungsstruktur Träger der öffentlichen Wasserversorgung Versorgungsgebiet eines Trägers 1 Verbandsgemeindewerke Wallhalben der öffentlichen Wasserversorgung 2 Zweckverband Wasserversorgung Schmitshausen 3 Zweckverband Wasserversorgung Sickingerhöhgruppe Träger der öffentlichen Wasserversorgung 4 Verbandsgemeindewerke Zweibrücken - Land 8 (mit lfd. Nr.) 5 Stadtwerke Zweibrücken 6 Gemeindewerke Waldfischbach - Burgalben Verbandsgemeindegrenze -

Vineyard Soils of Rhineland-Palatinate
Vineyard Soils of Rhineland-Palatinate Rocks. Soils. Terroir. Impressum Publishers: Foreword Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz Ministry for Economic Affairs, Climate Protection, Energy and Spatial Planning Rhineland-Palatinate Dear ladies and gentlemen, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz for ten years now, the “Soil of the Year” for the upcoming year is announced on December 5th, [email protected] the International World Soil Day. When the vineyard soil was selected for 2014, the federal www.mwkel.rlp.de state of Rhineland-Palatinate, as the largest wine-growing state in Germany gladly assumed patronage for this soil. The brochure “Vineyard Soils of Rhineland-Palatinate“ introduces the Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz large diversity of soils of the wine-growing areas Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen Ministry for the Environment, Agriculture, Nutrition, Viniculture and Forestry Rhineland-Palatinate Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz and Pfalz. Six of the thirteen German wine-growing regions are located in Rhineland-Palatinate [email protected] and characterize large areas of our state. www.mulewf.rlp.de Wine has been grown here since Roman times. Wine production has created unique cultural landscapes in Rhineland-Palatinate and is an important economic factor today. This is not Coordination and editors: only a result of wine production alone, which generates nearly a third of the total agricultural Dr. J. Backes*, Dr. P. Böhm, H. Gröber**, J. Jung*, Dr. E.-D. Spies*** production value of our federal state, but is also due to the growing number of tourists who come here because of the wine. -

210204 VRN-Wabenplan.Fh11
Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) Hier gilt eine spezielle Übergangsregelung für bestimmte Fahrausweise des VRN. Näheres finden Sie im VRN-Tarifprospekt oder unter www.vrn.de © Bingen am Rhein © Mainz © ©Nieder-Olm Wolfsheim Gau- Vendersheim Parten- Bickel- heim Saulheim Udenheim Stadtpro- heim Gau- zelten Faulbach Hasloch Weinheim Schornsheim Dorfprozelten 645 Wörrstadt Gabsheim Faulbach Uettingen Mädelhofen Hier gelten alle VRN-Fahrscheine einschließlich SuperMAXX-Ticket, Westpfalz Zeitkarten Ausbildung Wallertheim Sulzheim Abzw. Mond- Staustufe Bettingen Würzburg und MAXX-Ticket sowie Semester-Ticket plus Westpfalz, Westpfalz Anschluss-Semester-Ticket, Reistenhausen- Boxtal feld Bestenheid/ Roßbrunn Wöllstein Bechtols- Tremhof 612 Wertheim Remlingen Hbf. Semester-Ticket und Anschluss-Semester-Ticket. Diese Regelung gilt ebenfalls für Fahrten zwischen Lohnsfeld Bad Kreuznach © Oppenheim Fechenbach Glashütte Village Rommersheim heim 6123 6450 und Wartenberg-Rohrbach. Das Semester-Ticket und das Anschluss-Semester-Ticket gelten zusätzlich auf Gumbsheim Spiesheim Grünenwört Holzkirchen 640 © © Biebeln- © 613 Waldbüttel- © den Schienenstrecken von Hochspeyer/Kaiserslautern nach Alsenz. © Armsheim heim Eichel brunn Freudenberg Boxtal Lindelbach 644 Höchberg Eckelsheim Bermersheim Ensheim Mainz Darmstadt Wald- Wertheim Würzburg Süd Siefers- Dietenhan Dertingen Wüstenzell Waldbrunn © heim Flonheim v.d.H. © Amorbach Bf. Freudenberg 6133 Wonsheim © Waldenhsn. Niedermoschel ALSENZ Hainstadt 611 02 Gunters- Wartberg Urphar Kembach Eisingen © © Gau- Stein-Bockenheim Uffhofen Bornheim Lonsheim blum Hetschbach Rai- Meisenheim Ober- Odernheim Breitenbach moschel Gimbsheim Pfirsch- Reicholzheim Unkenbach Kalkofen Lichtspiele Frankfurt Alsbach Reinheim Hassenroth Sand- Vockenrot Holzkirchhausen 641 Niederhausen Erbes- Hilles- bach Höchst Rauenberg 6153 Kist © Hier sowie in dem Korridor bis Kaiserslautern Hbf gelten alle VRN-Fahrscheine Sitters 861 an der Appel Wendels- Albig © bach Winterborn heim Büdesheim heim 04 © Hummetroth Annels- Seck- Steingasse inkl. MAXX-Ticket. -

From the Northern Ice Shield to the Alpine Glaciations a Quaternary Field Trip Through Germany
DEUQUA excursions Edited by Daniela Sauer From the northern ice shield to the Alpine glaciations A Quaternary field trip through Germany GEOZON From the northern ice shield to the Alpine glaciations Preface Daniela Sauer The 10-day field trip described in this excursion guide was organized by a group of members of DEUQUA (Deutsche Quartärvereinigung = German Quaternary Union), coordinated by DEUQUA president Margot Böse. The tour was offered as a pre-congress field trip of the INQUA Congress in Bern, Switzerland, 21– 27 July 2011. Finally, the excursion got cancelled because not enough participants had registered. Apparently, many people were interested in the excursion but did not book it because of the high costs related to the 10-day trip. Because of the general interest, we decided nevertheless to finish the excursion guide. The route of the field trip follows a section through Germany from North to South, from the area of the Northern gla- ciation, to the Alpine glacial advances. It includes several places of historical importance, where milestones in Quaternary research have been achieved in the past, as well as new interesting sites where results of recent research is presented. The field trip starts at Greifswald in the very North-East of Germany. The first day is devoted to the Pleistocene and Ho- locene Evolution of coastal NE Germany. The Baltic coast with its characteristic cliffs provides excellent exposures showing the Late Pleistocene and Holocene stratigraphy and glaciotectonics. The most spectacular cliffs that are located on the island of Rügen, the largest island of Germany (926 km2) are shown. -

GNOR Info 108 090327, 0900 .Qxd
GNOR Info Nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz Nr. 108 April 2009 anerkannter Landespflegeverband Aus dem Inhalt: • Kormoranabschuss in Rheinland-Pfalz • Leitbild der GNOR (Seite 5) beschlossen (Seite 17) • Umfangreiche Amphibienschutz- • Neues aus der Halbwilden Haltung (Seite 8) maßnahmen in der Pfalz (Seite 20) • Erfassung ausgewählter Vogelarten der Gewässer (Seite 14) • Zur Bestandsentwicklung der Tagfalter in der Pfalz 2008 (Seite 27) Editorial Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der GNOR, "Die natürliche Auslese sorgt dafür, Harmonie und die "heilige Naturkraft dass immer die Stärksten oder die am inneren Wirkens", wie es Goethe besten Angepassten überleben." Das ist, formulierte. Darwins düstere Theorie der wie Sie sicher richtig vermuten, ein Zitat natürlichen Selektion dagegen idealisierte des berühmten Evolutionsforschers und verklärte die Natur nicht länger, Charles Darwin. Darin steckt aber auch sondern konnte sie erklären. Gleichwohl eine ganz wichtige Bemerkung, die meist war Darwin, wie Humboldt, ein großer unter den Tisch fällt. Nicht nur die Humanist, der an die moralische (körperlich?, geistig?) Stärksten über- Verbesserungsfähigkeit des Menschen leben, sondern ganz entscheidend ist die glaubte". Beide haben es verdient, Tatsache, dass es die am besten gewürdigt zu werden, daher finden Sie Angepassten sind, die auf Dauer in der im Innern unseres GNOR-Infos noch Natur überleben. Warum erwähne ich weitere Informationen zum Leben und Vielfalt, die im Mai in Bonn stattfand, das? Ich möchte Euch aufmerksam Werk der beiden. und will einen Beitrag dazu leisten, deren machen auf das Darwin-Jahr 2009, in Anliegen und Ziele in Rheinland-Pfalz dem wir den 200. Geburtstag des Von der Erklärung der Welt zu den umzusetzen", stellt Umweltministerin Naturforschers feiern. Ein weiteres, Niederungen in Rheinland-Pfalz. -

Ein Schutzkonzept Für Die Wildkatze in Deutschland Habitat Fragmentation
Lebensraumzerschneidung und Wiedervernetzung – Ein Schutzkonzept für die Wildkatze in Deutschland Habitat fragmentation and (re-)connection – a conservation concept for the wildcat in Germany Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) eingereicht im Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin vorgelegt von Nina Klar aus Berlin 2010 Diese Arbeit wurde unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Carsten Niemitz vom Institut für Humanbiologie und Anthropologie der Freien Universität Berlin, Dr. Stephanie Kramer-Schadt vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ, Department Öko- logische Systemanalyse, in Leipzig und Dr. Mathias Herrmann, ÖKO-LOG Freiland- forschung, Parlow, zwischen November 2004 und September 2007 angefertigt und nach einer Babypause im Juni 2010 in Hamburg beendet. Die Arbeit wurde durch ein Promotionsstipendium der Dr. Joachim und Hanna Schmidt- Stiftung für Umwelt und Verkehr e.V. von November 2004 bis Oktober 2006 gefördert. 1. Gutachter: Prof. Dr. Carsten Niemitz 2. Gutachter: Prof. Dr. Heribert Hofer Disputation am 7. September 2010 2 Inhalt Zusammenfassung 4 Abstract 7 Einleitung 9 Struktur der Arbeit 13 Kapitel 1 Habitat selection models for European wildcat conservation 16 Kapitel 2 Between ecological theory and planning practice: (Re-) Connection of forest patches for the wildcat in Lower Saxony, Germany 38 Kapitel 3 Effects and mitigation of the impact of roads on individual movement behaviour of wildcats 56 Kapitel 4 Effects -

€ 4.990,–*1 Dank Umweltprämie Und Inklusive 3 Jahren Garantie
Auflage: 23.000 Februar 2009 Regionales Wirtschaft Termine www.rwt-magazin.de Redaktion und Anzeigenberatung: 06331 - 239237 Magazin für die Südwestpfalz € 4.990,–*1 Dank Umweltprämie und inklusive 3 Jahren Garantie. 2-spaltig Höhe 212mm Autohaus Schechter Inh. Thomas Metzger Der freche Cityflitzer MATIZ für 5 Personen, mit Sie zahlen dank Schulstr. 4 ABS, Fahrer- und Beifahrerairbag, Servo- Umweltprämie für 66976 Rodalben lenkung, Zentralverriegelung, elektro- nischer Wegfahrsperre, 3 Jahren Garantie den Matiz jetzt nur: Tel. 0 63 31 - 80 40 13 1 2 und vielem mehr. * * Mehr Informationen zur Umweltprämie € 5.580,– Öffnungszeiten: finden Sie unter: www.chevrolet.de. Mo. Ruhetag Di.-Do. 10:00-13:00 / 16:00 - 24:00 Uhr Fr.-Sa. 10:00 - 24:00 Uhr So. 10:00-13:00 / 16:00 - 24:00 Uhr GET REAL. 05.02.09 Schlachtfest ab 12:00 Uhr 14.02.09 Westernabend mit Long Road Autohaus Schechter GmbH & Co. KG Eckstraße 12 Telefon 06331 / 2328-0 mit CD Vorstellung, ab 20:00 Uhr 66976 Rodalben/Neuhof Fax 06331 / 2328-13 22.02.09 Nach Rodalber Straßenfasching www.schechter24.de [email protected] *1 Angebotskalkulation, z. B. für den Matiz 0.8 S: eigentlicher Kaufpreis € 7.490,– Live Musik, ab 17:00 Uhr abzgl. € 2.500,– staatliche Umweltprämie – soweit die Voraussetzungen erfüllt werden = Ihr Zahlbetrag € 4.990,–. Mehr Informationen zur Umweltprämie finden Sie unter: www.chevrolet.de. Abbildung zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts/außerorts/kombiniert: 6,9/4,2/5,2; Täglich von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr warme Küche CO2-Emission (g/km): 119. -

Maßnahmenprogramm 2016-2021 Nach Der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Für Die Rheinland-Pfälzischen Gewässer Im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar
Maßnahmenprogramm 2016-2021 nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für die rheinland-pfälzischen Gewässer im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar Stand: 22. Dezember 2015 Das vorliegende Dokument wurde nach Auswertung der Stellungnahmen aus der Anhörung überarbeitet. Es dient als zusätzliche Information (Hintergrundinformation) über die Gewässer in Rheinland-Pfalz für die „Zusammenfassung der Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz zum aktualisierten Bewirtschaftungsplan und den Maßnah- menprogrammen für den internationalen Bewirtschaftungsplan Rhein 2016-2021 Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, welches nicht abschließend ist. Aufgrund weiterer Erkenntnisse und anderweitiger Gegebenheiten können Maßnahmen entweder entfallen oder neu hinzukommen. Inhaltsverzeichnis 1 STAND DER MAßNAHMENUMSETZUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN ................................................ 1 2 GRUNDSÄTZE UND VORGEHEN BEI DER MAßNAHMENPLANUNG .......................................................... 1 2.1 GRUNDSÄTZE ......................................................................................................................................... 2 2.1.1 ALLGEMEINES ......................................................................................................................................... 2 2.1.2 KLIMAENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND ...................................................................................................... 3 2.2 BESCHREIBUNG DES ZUSTANDS DER GEWÄSSER ....................................................................................... -

App Ins Grüne!
Mountainbikepark Pfälzerwald Radfahren in der Pfalz 2017 – Das über 900 Kilometer Willkommen zum Sattel-Fest! lange Streckennetz lässt jedes Biker-Herz höher App ins Ob Sie mit dem Trekking-Rad oder einem E-Bike kommen, ob Sie Hobby- schlagen. 20 Touren von App ins Radler sind oder sportliche Ambitionen haben ist einerlei, denn an schönen, Kaiserslautern im Norden Die abwechslungsreichen Radtouren herrscht bis an die deutsch-franzö- kein Mangel. Durch die Region verlaufen sische Grenze im Süden 34 beschilderte Th emenrouten mit einer erschließen verschiedene Pfalz Gesamtlänge von über 1800 Kilometern. Grüne! Und für alle, die den Kalorienverbrauch Landschaft sräume: Grüne! den Pfälzerwald, die am liebsten mit der Kalorienaufnahme Deutsche Weinstraße und veranstaltungstipps verbinden, haben die Pfälzer die Rad- den Wasgau mit seinen erlebnistage erfunden. © Mountainbikepark Pfälzerwald e.V. Pfälzerwald © Mountainbikepark kinoprogramm bizarren Felsformationen. Mountainbiker fi nden ebenfalls ideale Bei abwechslungsreichen Höhenprofi len und einem Singletrailanteil von regionale nachrichten Bedingungen vor. Bikeparks, MTB-Events bis zu 25 Prozent ist Fahrspaß garantiert. Nicht nur versierte Biker, sondern Raderlebnisse orte & empfehlungen und über 900 Kilometer ausgeschilderter auch Familien mit Kindern kommen dank der unterschiedlichen Schwierig- Touren im Mountainbikepark Pfälzerwald keitsgrade auf ihre Kosten. Die Touren VRN-Routenplaner 2017 lassen jedes Biker-Herz höher schlagen. e.V. Germersheim Landkreis Südpfalz-Tourismus reichen von 24 bis 78 Kilometern und es sind zwischen 530 und e-bike-ladestationen 1990 Höhenmeter zu bewältigen. Übersicht der Aktionstage • • Mountainbike-Veranstaltungen PFAFFEN- FRANKFURT SCHWABENHEIM 3. Fatbikecamp im Dahner Felsenland 10. bis 12.02.2017 4b 66994 Dahn · www.trailrock.de KIRCHHEIM- 10a BOLANDEN 4c I • WÜRZWEILER • MONSHEIM Mountainbike-Wochenenden rund um den Donnersberg LAUTERECKEN • • 05. -

Ergebnisliste - 21
Ergebnisliste - 21. Kalmit-Berglauf 2012 1 PLATZ NAME VEREIN JG ZEIT KLASSE RANG 1 Lehmann Jonas TuS 06 Heltersberg 89 00:31:06 MHK 1 2 Hinze Dr. Stefan LG DUV 63 00:31:26 M45 1 3 Trauth Oliver TV Herxheim 83 00:33:21 MHK 2 4 Heuer Tom TuS 06 Heltersberg 70 00:33:38 M40 1 5 Barnsteiner Alexander LLG Landstuhl 74 00:33:54 M35 1 6 Eisel Philipp TV Mußbach 85 00:34:02 MHK 3 7 Haak Steffen Karlsruher Lemminge 82 00:34:08 M30 1 8 Hassenzadeh Hakim MTG-Mannheim 92 00:34:14 MHK 4 9 Könnel Tim TuS 06 Heltersberg 94 00:34:15 MJU20 1 10 Dörr Christian Ohne 76 00:34:29 M35 2 11 Kolkhorst Henrich Karlsruher Lemminge 89 00:34:40 MHK 5 12 Becht Joachim LT Furtwangen 61 00:34:52 M50 1 13 Lüttel Uli Karlsruher Lemminge 71 00:35:05 M40 2 14 Anton Sascha Grojos LTF Elversberg 80 00:35:16 M30 2 15 Steiner Mario LLG Landstuhl 70 00:35:20 M40 3 16 Wittwer Thomas Südpfalz-adventures.com 82 00:35:28 M30 3 17 Lebeau Leander Tri-Treff Storz 87 00:35:52 MHK 6 18 Kirschbaum Max TSG Eisenberg 86 00:35:57 MHK 7 19 Wolf Daniel Karlsruher Lemminge 85 00:36:03 MHK 8 20 Bullerkotte Christian DIL Eppelheim 83 00:36:06 MHK 9 21 Gernhardt Robert MSU Running Club 92 00:36:08 MHK 10 22 Seibel Wolfgang Südpfalz-adventures.com 62 00:36:11 M50 2 23 Wach Oliver TV Herxheim 84 00:36:15 MHK 11 24 Joa Bernhard Lauftreff Lambrecht 77 00:36:23 M35 3 25 Weiß Melanie TSV Annweiler 84 00:36:27 WHK 1 26 Buser Frédéric 1.FC Kaiserslautern 81 00:36:42 M30 4 27 Remus Elmar LC Solbad Ravensberg 78 00:36:46 M30 5 28 Draudt Lars LG Rülzheim 72 00:36:51 M40 4 29 Gaisser Thomas Uni Lauftreff