„Vorrathskammern Der Seele“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
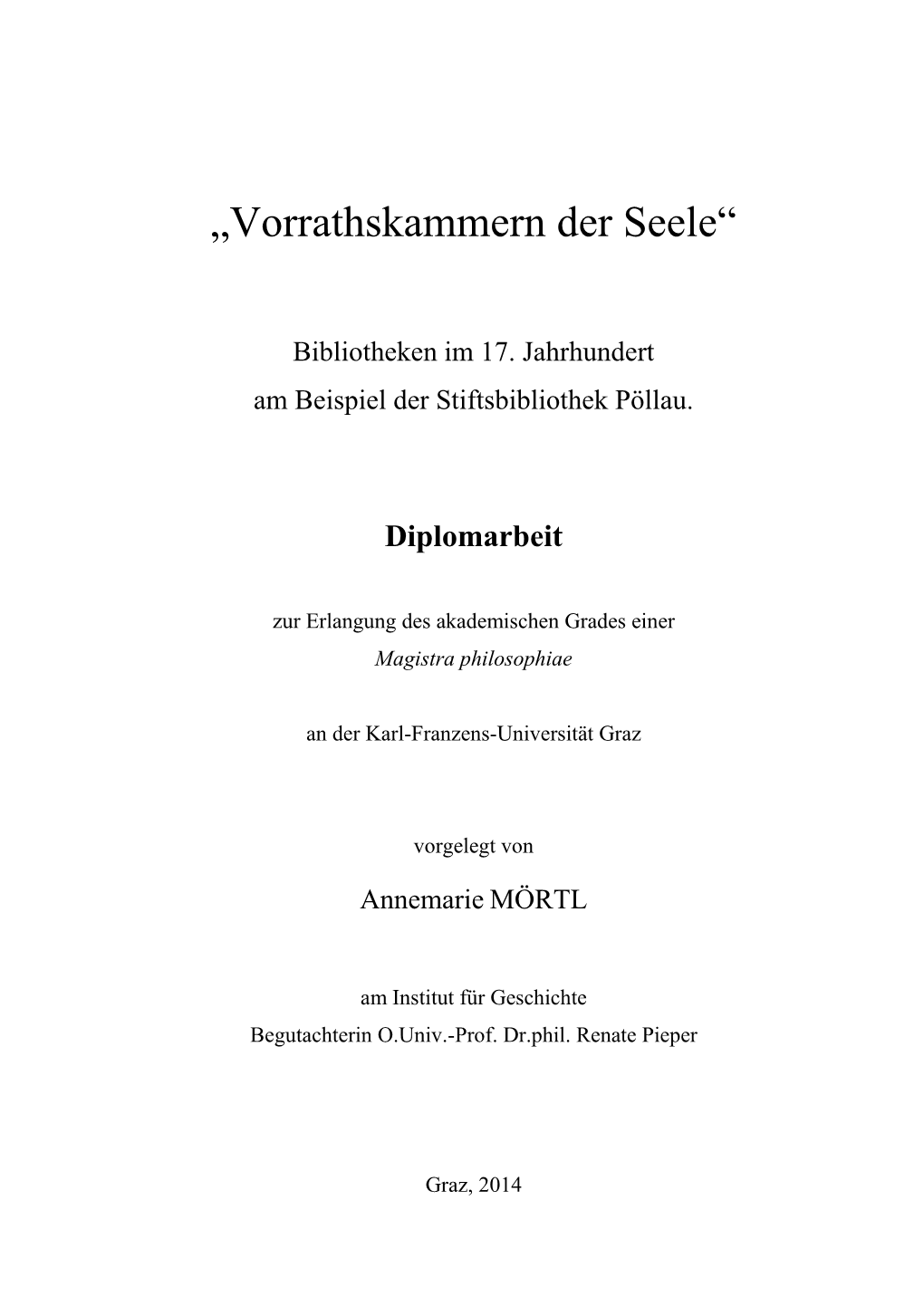
Load more
Recommended publications
-

William Cave (1637-1713) and the Fortunes of Historia Literaria in England
WILLIAM CAVE (1637-1713) AND THE FORTUNES OF HISTORIA LITERARIA IN ENGLAND ALEXANDER ROBERT WRIGHT Sidney Sussex College, Cambridge This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy, December 2017 Faculty of English Abstract WILLIAM CAVE (1637-1713) AND THE FORTUNES OF HISTORIA LITERARIA IN ENGLAND Alexander Robert Wright This thesis is the first full-length study of the English clergyman and historian William Cave (1637-1713). As one of a number of Restoration divines invested in exploring the lives and writings of the early Christians, Cave has nonetheless won only meagre interest from early- modernists in the past decade. Among his contemporaries and well into the nineteenth century Cave’s vernacular biographies of the Apostles and Church Fathers were widely read, but it was with the two volumes of his Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Literaria (1688 and 1698), his life’s work, that he made his most important and lasting contribution to scholarship. The first aim of the thesis is therefore to build on a recent quickening of research into the innovative early-modern genre of historia literaria by exploring how, why, and with what help, in the context of late seventeenth-century European intellectual culture, Cave decided to write a work of literary history. To do so it makes extensive use of the handwritten drafts, annotations, notebooks, and letters that he left behind, giving a comprehensive account of his reading and scholarly practices from his student-days in 1650s Cambridge and then as a young clergyman in the 1660s to his final, unsuccessful attempts to publish a revised edition of his book at the end of his life. -

Orientalium Linguarum Bibliotheca» in 17Th-Century Vienna: Sebastian Tengnagel and the Trajectories of His Manuscripts
Hülya Çelik - Chiara Petrolini* Establishing an «Orientalium linguarum Bibliotheca» in 17th-century Vienna: Sebastian Tengnagel and the trajectories of his manuscripts 1. «Insatiabilis cupiditas»: fragments of an apprenticeship n January 1630, Lucas Holstenius was on his way to Poland, where Cardinal Francesco Barberini had sent him to negotiate with King ISigismund and bring the red hat to Monsignore Santacroce, the papal nuncio in Warsaw. Stopping in Vienna, Holstenius had a long * Sections 1 and 2 of this contribution are written by Chiara Petrolini and 3 and 4 by Hülya Çelik. This article stems from the research project The Oriental Outpost of the Repu- blic of Letters. Sebastian Tengnagel (d. 1636), the Imperial Library in Vienna and Knowledge about the Orient, carried out by Hülya Çelik, Paola Molino, Chiara Petrolini, Claudia Römer, Thomas Wallnig, and funded by the Austrian Science Fund (FWF P-30511 – running from January 2018 to the end of 2021), see Oorpl 2018. The outcomes of the research will be extensively presented in a book cur- rently in preparation by the project team members, to be titled: Court Librarian Sebastian Tengnagel, Central European Christianity and Knowledge about the Orient, 1600–1640. A first version of this paper was presented at the conferen- ce Was wäre die Bibliothek ohne Bibliothekare? Die Wiener Hofbibliothek im Spannungsfeld von Macht und Öffentlichkeit, held by the Institute for Austrian Historical Research on 19–20 November 2018 in Vienna. Bibliothecae.it, 10 (2021), 1, 175-231 Saggi DOI <10.6092/issn.2283-9364/13081> Bibliothecae.it Hülya Çelik - Chiara Petrolini 10 (2021), 1, 176-231 Establishing an «Orientalium linguarum Bibliotheca» Saggi in 17th-century Vienna conversation with Emperor Ferdinand and then visited the Imperial Library. -

2014 Programme
2014 Programme Wednesday, 23rd April 2014 Dachgeschoss Seminarraum 61 Seminarraum 62 9:00 - 09:45 Registration (registration desk open until 16:00) 9:45 - 11:30 Plenary Session. Welcoming remarks and first keynote address Chair: Vittoria Feola Keynote Speaker: Thomas Wallnig (University of Vienna) Title: If there were an English word for 'Geistesgeschichte' would anyone want to use it? 11:30 - 11:45 Coffee/Tea 11:45 - 13:30 Session 1: Early Modern Cosmologies Session 2: Early Modern Medicine Session 3: Antiquarianism - crossing regions, oceans, and fields of knowledge Chair: Michal Choptiany (University of Warsaw) Panel session convened by Ariel Hessayon. Panel session convened by Marita Hübner and Marianne Klemun Nydia Pineda De Avila (Queen Mary, University of London), Crafting Chair: Vittoria Feola (Medical University of Vienna) Chair: Marianne Klemun (University of Vienna) selenographies: lunar images as crossroads of knowledge and practice Lorenza Gianfrancesco (Royal Holloway, University of London), From Lydia Barnett (Bates College, USA), Giant Bones and Taunton Stones: Circulating in early modern Europe. astrology to magic. Experimentation in early modern Naples. ‘Curiosa Americana’ in the Protestant Republic of Letters. Steven Vanden Broeck (Ghent University), Confessionalising astronomy Ariel Hessayon (Goldsmiths, University of London), Curing and Marita Huebner (University of Vienna), Natural Philosophy, Egypt and the before the Dialogo: Libert Froidmont's attack on the Copernicans Healing ‘Decayed Nature’: Jacob Boehme’s Influence on Early antiquarian imagination around 1700. (1631). Modern Medical Science. Salvatore Napolitano (New York University), Encyclopedism and Antiquarian Lionel Laborie (Goldsmiths, University of London), Jacques Massard: Studies in Italy. National identities, antiquarian schools, and historical Mystical Medicine in the Huguenot Diaspora. -

Concilium Constantinopolitanum II – Documenta Omnia
0553-0553 – Concilium Constantinopolitanum II – Documenta Omnia The Fifth Ecumenical Council. The Second Council Of Constantinople this file has been downloaded from http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.html NPNF (V2-14) Philip Schaff 297 THE FIFTH ECUMENICAL COUNCIL. THE SECOND COUNCIL OF CONSTANTINOPLE. A.D. 553. Emperor.—JUSTINIAN I. Pope.—VIGILIUS. Elenchus. Historical Introduction. Excursus on the genuineness of the Acts of the Council. The Emperor’s Letter. Extracts from the Acts, Session VII. The Sentence of the Synod. The Capitula of the Council. Excursus on the XV. Anathematisms against Origen. The Anathemas against Origen paralleled with the Anathematisms of the Emperor Justinian. Historical Note to the Decretal Letter of Pope Vigilius. The Decretal Letter of the Pope, with Introductory Note. Historical Excursus on the after-history of the Council. 299 Historical Introduction. (Hefele, History of the Councils, Vol. IV., p. 289.) In accordance with the imperial command, but without the assent of the Pope, the synod was opened on the 5th of May A.D. 553, in the Secretarium of the Cathedral Church at Constantinople. Among those present were the Patriarchs, Eutychius of Constantinople, who presided, Apollinaris of Alexandria, Domninus of Antioch, three bishops as representatives of the Patriarch Eustochius 437 NPNF (V2-14) Philip Schaff of Jerusalem, and 145 other metropolitans and bishops, of whom many came also in the place of absent colleagues. (Bossuet, Def. Cleri Gall., Lib. vii., cap. xix. Abridged. Translation by Allies.) The three chapters were the point in question; that is, respecting Theodore of Mopsuestia, Theodoret’s writings against Cyril, and the letter of Ibas of Edessa to Maris the Persian. -

2010 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the Netherlands (ISBN: 978 90 04 18262 2)
© 2010 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands (ISBN: 978 90 04 18262 2) CHAPTER THIRTEEN PATRES PATRIAE OR PRODITORES PATRIAE? LEGITIMIZING AND DE-LEGITIMIZING THE AUTHORITY OF THE PROVINCIAL ESTATES IN SEVENTEENTH-CENTURY BOHEMIA Petr Maťa Th is contribution is concerned with patriotic sentiment and language in Bohemia in the second half of the seventeenth century.1 It aims primarily at providing greater historical context to what has been writ- ten on this topic. Here, I will introduce new evidence framed by a case study. Yet a case study might be exactly a good starting point given the current state of knowledge. Hitherto, interpretations have been built up on a markedly limited scrutiny of source material, and historians have usually overprivileged a few texts and fi gures at the expense of many others. Being interested primarily in tracing the lin- eage of a national consciousness, they have perpetuated the tendency, deep-rooted in the traditional master narrative of a Czech national history, to line up seventeenth- and eighteenth-century “patriots”— mostly authors of historiographical and hagiographical writings—in a chain of canonized witnesses of national awareness. Th is tendency has predetermined both the selective research interests and the inter- pretation of these texts as primarily manifestations of Czech national consciousness. 1 In this article, I deliberately avoid the term “patriotism”. Beyond the general problematic nature of the “ism” terms, especially when applied to the premodern and early modern situations, it is precisely the notion of patriotic talk as primarily an expression of consistent patriotic positions or even a political doctrine that I intend to problematize here. -

Ec APARCHAI-Teljes.Pdf
Lectures held at the 6th conference of Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae 28–29 May 2011 Edited by: Jutai Péter Published by Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae. Publication sponsored by ELTE BTK HÖK Budapest, 2011 Table of contents Introduction 9 Eötvös Collegium Officina De Ioanne Bollók Nominata Katalin Delbó Marginalien im Florilegium Vindobonense 13 Dániel Locsmándi Das Leben und Kontaktnetz von Peter Lambeck 18 Lilla Lovász History of teaching ancient Greek in Hungarian secondary schools 28 Dóra Peszlen Dodona und die Bleitäfelchen 33 Tamara Schüszler Conclusions Concerning the Library of Péter Váradi 39 Zoltán Szegvári Johannes Kinnamos als Quelle der ungarischen Geschichte 43 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tres Montes Anton Avar Th e Balkan Campaigns of Sviatoslav (968–971) 49 Dániel Bácsatyai “Ut mortuus seculo, solus soli viveret Deo” – Th e Charter of Hermit Andreas and Admont 55 József Csermelyi Matthias Corvinus’s wooden fortresses at the Lower Danube – Military historical analysis of a diplomatic document 62 Tamás Dudás Vita Dosithei: a Way to the Sanctity 68 Katalin Goda „Ehe wir ertrinken, bezahle das Fahrgeld!” – Die Fragen einer byzantinischen Sprichwörtersammlung 75 Ákos Szilágyi Athena perdita 79 Eötvös Loránd Tudományegyetem Officina Thewrewkiana Fruzsina Bartos TT 65 – the survival of a New Kingdom tomb in the Th ird Intermediate Period and Late Period 87 Zsombor Földi Sîn-muštāl, the Overseer of Merchants of Ur 96 Miklós Kerekes Th e Assyrian Provincial Administration – Th e Neo-Assyrian Governor’s Aspects within their Province 104 Julianna Kitti Paksi Pious Pharaohs? 110 6 Szegedi Tudományegyetem Officina Försteriana György Palotás Th eory and practice of the military science in Flavius Arrianus’s tactical manuals 121 7 10 Eötvös Collegium Officina De Ioanne Bollók Nominata Katalin Delbó Marginalien im Florilegium Vindobonense Das Florilegium Vindobonense befi ndet sich im Codex Philosophicus Philologicus Graecus 169, der aus dem XIV. -

Pilgrimages of Emperor Leopold I in Central Europe
Rad. Inst. povij. umjet. 41/2017. (59–66) Szabolcs Serfőző: Pilgrimages of Emperor Leopold I in Central Europe Szabolcs Serfőző Museum of Applied Arts, Budapest Pilgrimages of Emperor Leopold I in Central Europe Review paper – Pregledni rad Received – Primljen 20. 2. 2017. UDK 2-57(4-191.2)]:7.044(430)”1640/1705” Summary The paper analyses the role of pilgrimage sites in Bavaria, Austria, and regions once constituting the Habsburg Empire, consequently the Bohemia, and Hungary in the representation of Emperor Leopold interdependence of historical and art historical research in and about I. This subject illustrates the strong relations between the kingdoms the different countries in Central Europe. Key words: sacral representation, pilgrimage, Emperor Leopold I, Central Europe, Altötting, Mariazell, Stará Boleslav, Ma- rianka (Marienthal, Máriavölgy) When it comes to medieval kings and princes, various as- al mission by God to protect the Holy Roman Empire and the pects of the sovereign’ s representation related to the sacred, Catholic Church from heresy. The Habsburgs obtained this the rites, and the ideology of sacral legitimisation of the mission owing to the merits of their ancestors, particularly monarchs have been in the focus of art historical and histo- those of the dynasty’ s founder, Rudolf IV. In order to fulfil rical-anthropological research for a longer period of time.1 this divine mission, Rudolf’ s successors were to follow his More recently, the same phenomena have been investigated example. Eucharistic piety and Marian devotion, the pietas concerning the early modern rulers. Sacral representation eucharistica and pietas mariana, made up the core elements of the Habsburg dynasty, its strategies of self-legitimisation of the pietas austriaca, but closely related to these forms of and the cult of the Virgin at the Habsburg court in Vienna devotion was the veneration of saints as well. -

ANNICK PAYNE Hesychius' Lydian Glosses I
DOI: https://doi.org/10.13130/1972-9901/15416 ANNICK PAYNE Hesychius’ Lydian Glosses I ABSTRACT: The historical distance between Hesychius, whose life dates (approx. AD 500) are only a rough estimate, and the Lydian Empire amounts to over a millennium, and a similar distance separates his work from the oldest surviving manuscript at the Marciana Library in Venice. The Hesychian lexicon contains a number of glosses referring to the Lydians which have been particularly badly understood, and therefore have been subject to emendation throughout their reception history. This unpromising situation is slowly improving due to continued work on the Lydian language and surviving inscriptions. The present article addresses a selection of Lydian glosses preserved in the Marciana manuscript. KEYWORDS: Hesychius, Lexicon, glosses, Lydian, Anatolia. 1. Introduction The work entitled Ἡσυχίου γραμματικοῦ Ἀλεξανδρέως συναγωγὴ πασῶν λέξεων κατὰ στοιχεῖον ἐκ τῶν Ἀριστάρχου καὶ Ἀπίωνος καὶ Ἡλιοδώρου was based mainly on an earlier lexicon by Diogenianus, a second century AD grammarian from Heraclea Pontia, as stated in the dedicatory letter to Eulogius. Hesychius’ lexicon survives in a sole manuscript of 439 folios from the 15th century AD, conserved in the Libreria Marciana in Venice.1 The mention of a second manuscript, thought to have existed in the Laurentian Library, Florence, is circumstantial. Alter (1796: 293) cites as evidence a handwritten note from the 1521 Hagenau edition, formerly the property of the historian and Greek scholar Peter Lambeck (1628–1680) from Hamburg.2 According * The author would like to thank Ettore Cingano for help with access to the MS, Geraldina Rozzi for procuring additional pictures. -

Legacy of the Humanists
EUROPE Legacy of the Humanists EUROPE – LEGACY OF THE HUMANISTS Humanitas hat makes human beings unique? This question was Wtaken up again during the Renaissance period upon For him, it was the rationality of language that differentiated humansreading thefrom works all other of the living Roman beings; writer it needed Cicero (106–43to be applied BCE). and precise manner, since the nurturing of the intellect saidin a refinedto be the nourishment of human dignity (humanitas humanitas implies,– and this over is andexpressed above thethrough modern language use of the– is ); term “humanity”, the aspect of „man as defined by his comprehensive intellectual wisdom“. Language, in its proper application,uch linguistic should and aim philosophical for truth and remarks the common touched good. a Scontemporary nerve amongst the Renaissance scholars, Europe–The Legacy of the Humanists for the reigning academic and cultural drift of the times Concept: Goethe-Institut Stockholm, EUNIC Stockholm, Austrian had reduced language to a practical framework which Academy of Sciences, Goethe-Institut Ljubljana, Cultural and Congress Centre Cankarjev dom For Goethe-Institut Ljubljana: Dr. Arpad-Andreas Sölter, Director withhad to socio-political be structured, changes classified the and question definable; of human freedom dignity of thought and aesthetic growth were not called for. Along For Cultural and Congress Centre Cankarjev dom: Uršula Cetinski, took on a particular dynamic, especially during this period Director General Project coordination: Nina Pirnat Spahić (Cankarjev dom), Barbara studia Krivec, Dr. Urban Šrimpf (Goethe-Institut Ljubljana), Daphne humanitatis,of transition. Based on the Classical archetype one now Springhorn (Goethe-Institut Stockholm) undertook studies that defined Man, the so-called Author of Slovene contributions: Assist. -

And Philology:The Rise and Destruction of Aconcept 247
Yearbook of the Maimonides Centre for Advanced Studies 2017 Yearbook of the Maimonides Centre for Advanced Studies Edited by Giuseppe Veltri Yearbook of the Maimonides Centre for Advanced Studies 2017 Volume Editor Bill Rebiger The Yearbook is published on behalf of the Maimonides Centre for Advanced Studies. ISBN 978-3-11-052796-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-052797-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-052809-1 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 Licence. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Ms Cod. Levy 115, fol. 158r: Maimonides, More Nevukhim, Beginn von Teil III. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Contents Editorial VII Part I: Articles Rachel Aumiller Epoché as the Erotic Conversion of Oneinto Two 3 EmidioSpinelli Some Blunt Instruments of Dogmatic Logic: Sextus Empiricus’ Sceptical Attack 15 Teresa Caligiure In antiquam litem relabimur. ScepticalHints in Petrarch’s Secretum 29 Bill Rebiger Sceptical Strategies in Simone Luzzatto’sPresentation of the Kabbalists in his Discorso 51 MichelaTorbidoni The ItalianAcademies and Rabbi Simone Luzzatto’s Socrate:the Freedom of the Ingenium and the Soul 71 Guido Bartolucci Jewish Thought vs. -

Die Bibliothek Des Johann Christian Von Boineburg (1622-1672) Ein Beitrag Zur Bibliotheksgeschichte Des Polyhistorismus
Institut für Bibliothekswissenschaft Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae Die Bibliothek des Johann Christian von Boineburg (1622-1672) Ein Beitrag zur Bibliotheksgeschichte des Polyhistorismus Eingereicht an der Philosophische Fakultät I Dekan: Prof. Dr. Oswald Schwemmer Von Kathrin Paasch Erstgutachter: Prof. Dr. Engelbert Plassmann Zweitgutachter: Prof. Dr. Peter Zahn Drittgutachter: Prof. Dr. Wolfgang Schmitz eingereicht am 21. Januar 2003 promoviert am 14. Juli 2003 Kathrin Paasch. Die Bibliothek des Johann Christian von Boineburg (1622-1672). S. 2 Zusammenfassung Der gelehrte Politiker und Diplomat Johann Christian von Boineburg baute seit seiner Ju- gend eine umfangreiche Bibliothek auf, die mit mehr als 10.000 Titeln zu den großen priva- ten Sammlungen des 17. Jahrhunderts zählte.Inhalt und Struktur der Boineburgica zum Zeit- punkt seines Todes sind durch einen Katalog bekannt, den der junge Gottfried Wilhelm Leibniz erstellte. Durch die Stiftung seines Sohnes, Philipp Wilhelm von Boineburg, wurde die Bibliothek in weiten Teilen für die Nachwelt erhalten. Auf der Grundlage des überlieferten Buchbestandes und des erhaltenen Kataloges der Bibliothek sowie des heute bekannten Briefwechsels entwirft die Arbeit ein Bild des Bücher- sammlers und –lesers Boineburg in seiner Zeit. Die Einbeziehung der überlieferten Drucke mit ihren handschriftlichen Einträgen ermög- licht die Rekonstruktion der Genese der Sammlung und die Analyse der Textaneignung durch ihren Besitzer. Gezeigt wird, inwieweit Boineburgs produktive Interessen und seine wissenschaftlichen Ambitionen neben seiner beruflichen politischen Tätigkeit und seinen mäzenatischen Aktivitäten die Zusammensetzung seiner Bibliothek begründen. Deutlich wird dabei auch Boineburgs Verwurzelung im Späthumanismus insgesamt. Im Kontext der privaten Büchersammlungen der Respublica literaria zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und dem Beginn des letzten Drittels des 17. -

Published Works Containing Letters To, From, Or About
APPENDIX I PUBLISHED WORKS CONTAINING LETTERS TO, FROM, OR ABOUT DE THOU 1 Dominicus Baudius, Epistolae, Amsterdam, 1662, passim. (Sixteen letters to de Thou and two letters about him; most of these letters also appear in seven previous editions of Baudius' letters published at Leyden and Amsterdam between 1615 and 1660.) Johann Boeder, Joannis Henrici Boecleri In Taciti primordia annalium et historias commentatio, Strassburg, 1664, p. 650. (One letter from Scipio Gentilis to Jacques Bongars about de Thou; reproduced VII, VI, g.) Jean Boivin, Petri Pithoei Vita . .. , Paris, 171 I. (One letter from de Thou to Pithou, reprinted in VII, XI, 13.) Jacques Bongers, Lettres. .. En latin et en fran;ais . .. , The Hague, 1695, pp. 650 and 672. (Two letters to de Thou.) Jacques Bongars, Jacobi Bongarsi et Georgii Michaelis Lingelshemii Epistolae, Strassburg, 1660, passim. (Six letters about de Thou repro duced by Buckley in VII, VI, passim.) Henri Bouchitte, ed., Negociations, lettres, et pieces relatives a la Con ference de Loudun, Paris, 1862, passim. (Eight letters between Louis XIII and de Thou; one letter from de Thou to Thumery.2) Innocenzo del Bufalo, La correspondance du nonce Innocenzo del Bufalo, 1601-1604, ed. Bernard Barbiche, Paris, 1964, passim. (Seven letters about de Thou.) Pieter Burmann, ed., Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum tomi quinque, vols. I and II, Leyden, 1727, passim. (Thirty-seven letters to, from, and about de Thou, some of which are reprinted in VII, passim.) 1 I have omitted Rigault's Epistola B. Aedui, Scevole de Sainte-Marthe's Ad . ... Thuanum Epistula, de Thou's dedication letters discussed in chapter 4, and some other similar publi cations, for these are not true letters but instead pamphlets and poems in the literary form of epistles.