Parlamentswahlen in Senegal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
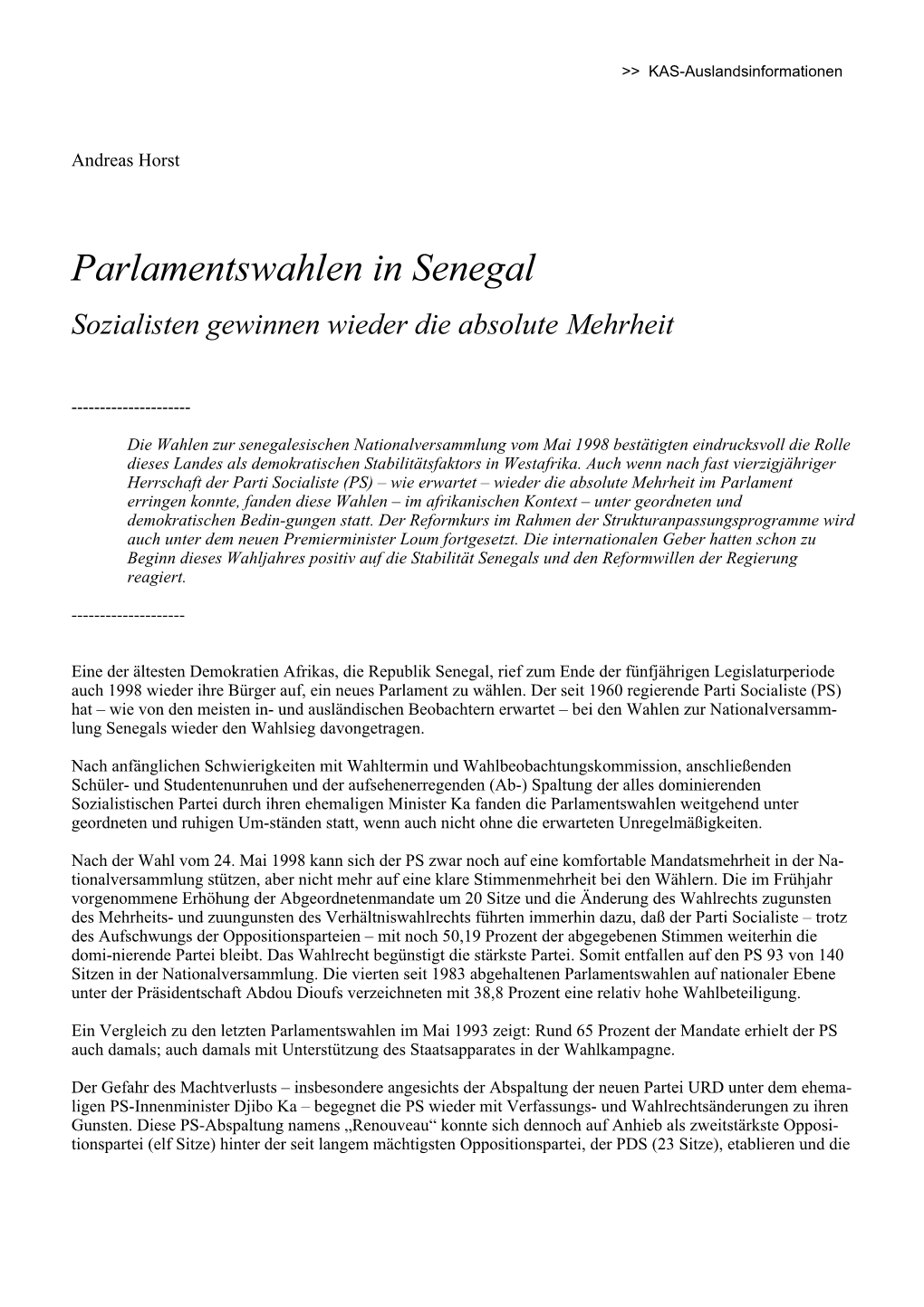
Load more
Recommended publications
-

52Nd Session of the Economic Commission for Africa Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development
52nd Session of the Economic Commission for Africa Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development Side-event Planning for tomorrow workforce: is Africa ready? Organized by the United Nations African Institute for Economic Development and Planning (IDEP) of the United Nations Economic Commission for Africa (ECA), the Sub regional office for North Africa of ECA In collaboration with The Policy Center for the New South, a Moroccan policy-oriented think tank and the High Commission for Planning of Morocco IDEP +221 33 829 55 00 [email protected] Rue du 18 juin +221 33 822 29 64 http://www.unidep.org Po. Box 3186 CP 18524 Dakar - SENEGAL MODERATOR 1. DR. KARIMA BOUNEMRA BEN SOLTANE Director, Institute for Economic Development and Planning PANEL COMPOSITION 1. Dr. YONOV FREDERICK AGAH Deputy Director-General, WTO 2. Dr. MOUBARACK LO Chief economist to Prime Minister of Senegal 3. Dr. KARIM EL AYNAOUI Executive Director, policy center for the new south 4. AYACHE KELLAF Directeur des prévisions et des prospectives, HCP, Maroc 5. LILIA HACHEM NAAS Director, ECA regional office for North Africa 6. VICTOR DJEMBA Director, Africa department, UNIDO 7. Dr. FRANCOIS PAUL YATTA Director of programme, United Cities and Local Governments IDEP +221 33 829 55 00 [email protected] Rue du 18 juin +221 33 822 29 64 http://www.unidep.org Po. Box 3186 CP 18524 Dakar - SENEGAL Yonov Frederick Agah Deputy Director-General, WTO Yonov Frederick Agah began his first term as Deputy Director-General of the WTO on 1 October 2013. He has been reappointed for a second four-year term, starting on 1 October 2017. -

Calendrier Historique De La Region De Tambacounda
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple ‐ Un but ‐ Une foi …………………. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES …………………. AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE ANSD RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE CALENDRIER HISTORIQUE DE LA REGION DE TAMBACOUNDA Version juin 2013 REGION DE TAMBACOUNDA AGES EN ANNEES EVENEMENTS MARQUANTS 2012 Kandioura Kaba fût le 1er boucher de Tambacounda 112 Création des Cantons Mort de Samory Touré au Gabon Retour de Serigne Touba du Gabon, le 22 novembre 1er élections législatives, Carpot élu député du Sénégal Commandant You Maytar- Commandant de cercle de Maka 1900 Coulibantang L’administration coloniale s’installe à Maka Décès de Arphan Oussy Kane Création de l’école de Maka ( fermé durant la 1ere guerre mondiale) Ouverture de l’école de Maka avec comme 1er maître monsieur konté Retour de Serigne Touba au Sénégal de son exil au Gabon 110 1902 Moussa Lalo se réfugie en Gambie 1903 Sack est nommé commandant du cercle de Maka 109 Le commandant Sack malade, est évacué par voie fluviale ( 108 Sandougou, fleuve à l’époque navigable de Maka à Malème Niani Le commandant Bruno succède au commandant Sack Yaya Sara Waly est nommé chef de Canto de Ouley 1904 Grande Famine à Nettéboulou ( Missirah) Création de la 1ere mosquée de Nettéboulou Mory Moussa Signaté 1er Imam de Nettéboulou Grande inondation du fleuve, on récoltait l’arachide dans l’eau ( Missirah) Le Commandant Porth remplace le Commandant Bruno à 1905 107 Maka Le Commandant Mauret remplace le Commandant -

Assemblée Nationale SOUS LE SIGNE DE LA PARITÉ
N°17 - Mai 2014 12è législature (2012 - 2017) Assemblée Nationale SOUS LE SIGNE DE LA PARITÉ Partenariat : Fondation Konrad Adenauer (FKA) Centre d’Étude des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) «Le journalisme, c’est voir, savoir, savoir-faire et faire savoir» (Gaston Leroux) Partenariat Fondation Konrad Adenauer (FKA) Centres d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) Université Cheikh Anta Diop «La paix et la liberté sont les bases de toutes existence humaine digne de ce nom» (Konrad Adenauer) Sommaire Présentation ..........................................................................................7 Avant propos ..........................................................................................9 Le mot du Directeur du CESTI ............................................................. 11 Assemblée nationale .............................................................................13 Le secrétariat général ............................................................................15 Le cabinet du président de l’Assemblée nationale ............................16 Bureau de l’Assemblée nationale ........................................................18 Les groupes parlementaires .................................................................19 Les partis politiques présents à l’Assemblée nationale .....................20 Portrait des députés ..............................................................................21 Administration de l’Assemblée nationale ........................................273 -

Senegal Since 2000. Rebuilding Hegemony in a Global Age Vincent Foucher, Tarik Dahou
Senegal since 2000. Rebuilding Hegemony in a Global Age Vincent Foucher, Tarik Dahou To cite this version: Vincent Foucher, Tarik Dahou. Senegal since 2000. Rebuilding Hegemony in a Global Age. Turning Points in African Democracy, 2009. hal-02614085 HAL Id: hal-02614085 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02614085 Submitted on 20 May 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Mustapha_01 1/5/09 15:48 Page 13 2 Senegal since 2000 Rebuilding Hegemony in a Global Age TARIK DAHOU & VINCENT FOUCHER Senegal is often seen as a model of democracy in Africa. The changing character of Senegalese political life since independence has been paralleled by just as many changes in the literature about it. Initially most work tended to focus on the long history and rooted character of Senegalese democratic culture. This was essentially an urban-based political history centred on the lives of an enlightened class of évolués, African elites with a French education. In various shades, subse- quent authors described how the powerful Muslim brotherhoods functioned as mechanisms for political integration in the countryside: in exchange for agricultural services and other resources channelled to client marabouts, the party-state could count on the votes of the disciples attached to these marabouts (Copans 1980; Coulon 1981). -

Feuille De Styles Thèse Numérique
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS ÉCOLE DOCTORALE : SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION, SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ED 455) Thèse de doctorat en Information et Communication soutenue le 07 Mars 2012 Médias et pouvoir au Sénégal depuis les indépendances (1960) Thèse de Doctorat / mars 2012 AUTEUR : Moustapha BARRY SOUS LA DIRECTION DU Professeur émérite Jacques BARRAT, Université Paris 2 Panthéon Assas MEMBRES DU JURY : Professeur émérite Francis BALLE, président du jury, Université Paris 2 Panthéon Assas Professeur émérite Jacques BARRAT, directeur de thèse, Université Paris 2 Panthéon Assas Professeur émérite Philippe BOULANGER, premier rapporteur, Université Cergy-Pontoise Professeur Bernard VALADE, deuxième rapporteur, Université Paris V Professeur émérite, Jean-Marie COTTERET, Université Paris I BARRY Moustapha | Thèse de doctorat | Mars 2012 AVERTISSEMENT La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. BARRY Moustapha | Thèse de doctorat | Mars 2012 REMERCIEMENTS Tous nos remerciements au Professeur Jacques BARRAT qui, après avoir dirigé notre Master II recherche Médias, société et mondialisation, n'a pas hésité de s'engager et de nous accompagner pour produire cette thèse. Qu'il trouve dans ce travail, notre reconnaissance et gratitude pour tous les conseils qu'il n'a cessés de nous prodiguer durant ces cinq ans de recherches. Nous remercions également notre famille pour son soutien, son affection et la confiance qu'elle a placée en nous durant notre cursus scolaire. Mention spécialement à ma mère qui m'a couvert de beaucoup d'affection durant toutes ces années de labeur. A mon épouse, Fatoumata Diouldé DIALLO, pour sa patience et sa compréhension. -

Abdoul Mbaye Et Les 25 Missionnaires EMBARGO CONTRE LE MALI Hypothèque 12 Ministres Pour Benno Bokk Yaakaar Sur 248 Milliards P.3
C M J N JEUDI 5 AVRIL 2012 NUMÉRO 249 100 F www.enqueteplus.com ISSN • 2230-133X GOUVERNEMENT MACKY-1, ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PREMIER DISCOURS DE MACKY SALL “Je ne protégerai Les alliés sous personne” P. 2 surveillance Abdoul Mbaye et les 25 missionnaires EMBARGO CONTRE LE MALI Hypothèque 12 ministres pour Benno Bokk Yaakaar sur 248 milliards P.3 LUTTE - 1 er FACE-À-FACE À THIÈS Balla traîne des pieds, Yékini boude P.11 CHRONIQUE MAGUM KËR Une si longue attente… e Premier ministre nommé est un banquier P. 2, 5, reconverti en chef d’entreprise. Sans attaches 6, 12 L politiques évidentes, son choix s’est peut-être imposé au président Macky Sall dans son besoin exprimé de récupération des biens nationaux. Un ban - quier qui a commencé sa carrière sous la houlette de l’ac - tuel président ivoirien quand celui-ci était gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et qui connaît les arcanes des financements politiques de la sous-région. L’ancien régime libéral avait été suspecté de blanchiment d’argent sale, notamment dans la dispute opposant l’ancien président Wade à son ancien Premier ministre Idrissa Seck. (SUITE P.2) COULISSES page 2 LA CHRONIQUE DE civils sont aujourd’hui en détention à FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT la maison d’arrêt et de correction de MAGUM KËR Ziguinchor “depuis plus de deux mois Seydou Guèye a “peur” où ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat ; coups et Une si longue blessures volontaires ; enlèvement et du ministère du Commerce séquestration”. -

Un Nouveau Souffle Pour La Traque ? Deux Purs Parquetiers Macky Fixe À La Manette
C M J N JEUDI 19 MAI 2016 NUMÉRO 1473 100 F DIALOGUE POLITIQUE NOUVELLES NOMINATIONS À LA CREI Un nouveau souffle pour la traque ? Deux purs parquetiers Macky fixe à la manette P. 5 5 CHEVILLARDS SURPRIS EN les règles TRAIN DE DÉPECER DEUX ÂNES La viande devait être écoulée à Séras P. 6 REPORTAGE ÎLE À MORPHIL Démette réclame “ses” 300 milliards F Cfa P. 6 La Chronique dAbdou Salam Kane “To be, or not to be ?” bdoul Mbaye, le banquier de métier et Premier ministre d’occasion (si pas de A raccroc) vient donc de sauter le pas. Il a franchi le Rubicon et est entré en politique ! Senghor disait que, pour sa part, il “y était tombé !” Au sens où il n’y avait jamais seule - ment songé. Pour Abdoul Mbaye, au contraire, son irruption en politique n’aura pas surpris grand monde, sinon personne en fait. Les concertations démarrent le 28 mai P. 3 (LIRE À LA PAGE 7) EN COULISSES 2 moyenne de 7,6 % pour les 17 déviants, apatrides sans scru - PRISON DE CAMP PÉNAL ET DE KOUTAL titres sub-saharo africains. Les pule”. Dans leur communiqué, rendements sur les 500 mil - elles “regrettent que la compé - lions de dollars de la dette tence juridique de la future Loi Des détenus en grève de la faim sénégalaise due en juillet 2024 Mbery Sylla, criminalisant les ont augmenté de 2 points de actes contre-nature, ne soit cir - ncore une grève de la base, à 7,1 % le lundi. Ce qui conscrite qu’aux limites géogra - faim de détenus. -

Table of Contents
SENEGAL COUNTRY READER TABLE OF CONTENTS Walter J. Silva 1952-1954 General Services Clerk, Dakar Cecil S. Richardson 1956-1959 GSO/Consular/Admin Officer, Dakar Pearl Richardson 1956-1959 Spouse of GSO/Consular/Admin Officer, Dakar Arva C. Floyd 1960-1961 Office in charge of Senegal, Mali and Mauritania, African Bureau, Washington, DC Henry S. Villard 1960-1961 Ambassador, Senegal Stephen Low 1960-1963 Labor Officer / Political Officer, Dakar Helen C. (Sue) Low 1960-1963 Spouse of Labor Officer / Political Officer, Dakar Phillip M Kaiser 1961-1964 Ambassador, Senegal Hannah Greeley Kaiser 1961-1964 Spouse of Ambassador, Senegal Harriet Curry 1961-1964 Secretary to Ambassador Kaiser, Dakar Walter C. Carrington 1952 Delegate, Conference of the World Assembly of Youth, Dakar, Senegal 1965-1967 Peace Corps Director, Senegal Mercer Cook 1965-1966 Ambassador, Senegal and Gambia Philip C. Brown 1966-1967 Junior Officer Trainee, USIS, Dakar John A. McKesson, III 1966-1968 Deputy Chief of Mission, Dakar Irvin D. Coker 1967 USAID, Washington, DC Albert E. Fairchild 1967-1969 Central Complement Officer, Dakar L. Dean Brown 1967-1970 Ambassador, Senegal 1 Alan W. Lukens 1967-1970 Deputy Chief of Mission, Dakar Walter J. Sherwin 1969-1970 Program Officer, USAID, Dakar John L. Loughran 1970-1972 Chargé d’Affaires, Senegal Edward C. McBride 1970-1973 USIA, Cultural Attaché, Dakar David Shear 1970-1972 USAID Africa Bureau, Washington, DC Derek S. Singer 1972-1973 Office of Technical Cooperation, United Nations, Senegal Eric J. Boswell 1973-1975 General Services Officer, Dakar Frances Cook 1973-1975 Cultural Affairs Officer, USIS, Dakar Rudolph Aggrey 1973-1976 Ambassador, Senegal Allen C. -

FICHA PAÍS Senegal República De Senegal
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Senegal República de Senegal La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. JULIO 2021 Población: la población de Senegal en 2019 se estima en 16. 209. 125 Senegal habitantes, con una edad media de 19 años; 52,2% de mujeres y 49,8% de hombres. El 53,3% de la población es rural y el 46,7% urbana. (datos: Agence Nationale pour la Statistique et la Demographie, ANSD) Capital: Dakar, 2.732.000 hab. (Economist Intelligence Unit 2019). Otras ciudades: Thiès (286.000 Hab.), Mbour (243.000 Hab.), Saint Louis Richard Toll (187.000 Hab.), Kaolack (182.000 Hab.), Ziguinchor (170.000 Hab.), (Economist Intelligence Unit 2019) Océano Atlántico St Louis Thillogne Idioma: Francés (oficial), wolof, serer, peul, mandinga, soninké, diola (len- Louga MAURITANIA guas nacionales). Franco CFA. Tipo de cambio fijo respecto al Euro (1 Euro = 655,957 Mamári Moneda: Francos CFA). Religión: Senegal es un Estado laico (Art. 1 de la Constitución), donde co- Dakar Thiés Velungara existen de forma pacífica diferentes creencias y religiones. No obstante, la MALI gran mayoría de la población (en torno a un 90%-95%) es musulmana, a Nganda su vez vinculada espiritual y socialmente a poderosas cofradías (Tijania, Tambacounda Muridí,Layène y Qadiriyya). -

Calendrier Historique De La Region De Matam
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple ‐ Un but ‐ Une foi …………………. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES …………………. AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE ANSD RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE CALENDRIER HISTORIQUE DE LA REGION DE MATAM Version mai 2013 REGION DE MATAM AGES ANNEES EVENEMENTS HISTORIQUES EN 2012 1902 Grande Sécheresse 110 1903 Décès de Yamar MBODJI derbier BRAC du Walo 109 1904 Assassinat du commandant Chaton This par Diery qui se suicide 108 1905 Décès de Bou el Mogdad SECK 107 1907 1ere peste bovine 105 Inauguration de la 2me gare de St-Louis Bataille à Dagana de Aly Yoro qui meurt dans le combat 1908 Fin du pouvoir du lieutenant gouverneur Camille GUY 104 Inauguration de la 2me Gare de Saint-Louis Arrivée du Ministre des colonies Miliesse LECROISE COURBEIL Lieutenant gouverneur du Sénégal 1910 Attoum CARTON 102 Recrutement massif de tirailleurs pour la conquête du Maroc 1911 Le marabout El Hadji Rawane Ngom revient s'installer à Mpal, 101 après un séjour Sinthiou Aly Recrutement massif de Tirailleurs pour la conquête du Maroc 1er Vol d'avion a Saint-Louis 1ère Grande famine 1912 100 Justin Deves réélu maire de St-Louis 1er vol d'avion à St-Louis Décès du Khaly de St-Louis Souleymane Seck 1913 Transfert à Dakar du laboratoire bactériologique du nom de 99 l'Institut Pasteur de Dakar 1914 ANATOLLI nommé Lieutenant gouverneur du Sénégal 98 1915 Mobilisation des Saint-Louisiens pour la Guerre 97 LE VEQUE nommé Lieutenant gouverneur du Sénégal 1916 2éme Peste -

Liste Des Premiers Ministres Du Sénégal
Liste des Premiers ministres du Sénégal Ce tableau recense les Premiers ministres du Sénégal successifs depuis le référendum de 1970. Premier ministre du Sénégal Sommaire La fonction Histoire Les titulaires successifs Armoiries du Sénégal Voir aussi Bibliographie Liens externes La fonction Le Premier ministre est nommé par le président, lui-même élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Le Premier ministre nomme les ministres après consultation du président. Histoire Titulaire actuel Mahammed Boun Abdallah Dionne Après la crise politique de décembre 1962, qui a opposé le président du depuis le 6 juillet 2014 Conseil Mamadou Dia, au président de la République Léopold Sédar Senghor, le régime parlementaire bicéphale (type quatrième République) instauré depuis la création de la Fédération du Mali, est remplacé en 1963 Création 1970 par un régime présidentiel classique dans lequel l'UPS (le parti politique Mandant Président de la de Léopold Sédar Senghor) deviendra Parti unique jusqu'en 1976. République Premier Après approbation de la décision par un référendum, la fonction de Abdou Diouf titulaire Premier ministre est créé en1970 et Abdou Diouf occupe alors le poste. Résidence Dakar La fonction est à nouveau supprimée entre1983 et 1991. officielle Site internet http://www.gouv.sn/ Les titulaires successifs La Primature, résidence du Premier ministre àDakar . N° Nom Investiture Fin du mandat Parti 1 Abdou Diouf 26 février 1970 31 décembre 1980 Parti socialiste 2 Habib Thiam 1er janvier 1981 3 avril 1983 Parti socialiste 3 Moustapha Niasse -

Sénégal (2000-2012)
Momar-Coumba Diop (dir.) Sénégal (2000-2012) Les institutions et politiques publiques à lépreuve dune gouvernance libérale CRES - KARTHALA SÉNÉGAL (2000-2012) LES INSTITUTIONS ET POLITIQUES PUBLIQUES À LÉPREUVE DUNE GOUVERNANCE LIB ÉRALE Le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) remercie le Centre de Recherches pour le Développement international (CRDI), établi à Ottawa, au Canada, qui a pris en charge les frais dédition de ce volume dans le cadre de linitiative Think Tank . Cependant, les vues qui y sont exprimées ne refl ètent pas nécessairement celles du CRES et du CRDI. International Development Centre de recherches pour le ResearchCentre développement international KARTHALA sur Internet : http://www.karthala.com Paiement sécurisé Illustration de couverture : uvre intitulée Bayaalu Colobaane de Fally Sow Sène , qui a aimablement autoris é sa reproduction Composition et mise en page : Charles Becker CRES et KARTHALA , 2013 ISBN : 978-2-8111-0878-6 Momar-Coumba Diop (dir.) Sénégal (2000-2012) Les institutions et politiques publiques à lépreuve dune gouvernance libérale Pr éface de Jean Copans CRES KARTHALA BP 7988 22-24 bd Arago Dakar Médina 75013 Paris Le Consortium pour la Recherche économique et sociale (CRES) a été cr éé par des enseignants-chercheurs de diverses sp écialit és (économie, droit, techniques quantitatives, sociologie). Les principaux objectifs du CRES sont de : • renforcer les capacit és de recherche et danalyse en sciences économiques et sociales au Sénégal et dans le reste de lAfrique ; • promouvoir une expertise de qualité permettant daider à la prise de décision sur les questions économiques et sociales ; • concevoir et impulser des programmes de recherche-formation dans le domaine de lé ducation, de lé conomie et de la sociologie ; • développer le partenariat entre les chercheurs universitaires, les experts de ladministration et les institutions de coop ération et daide au développement.