Download Programmheft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
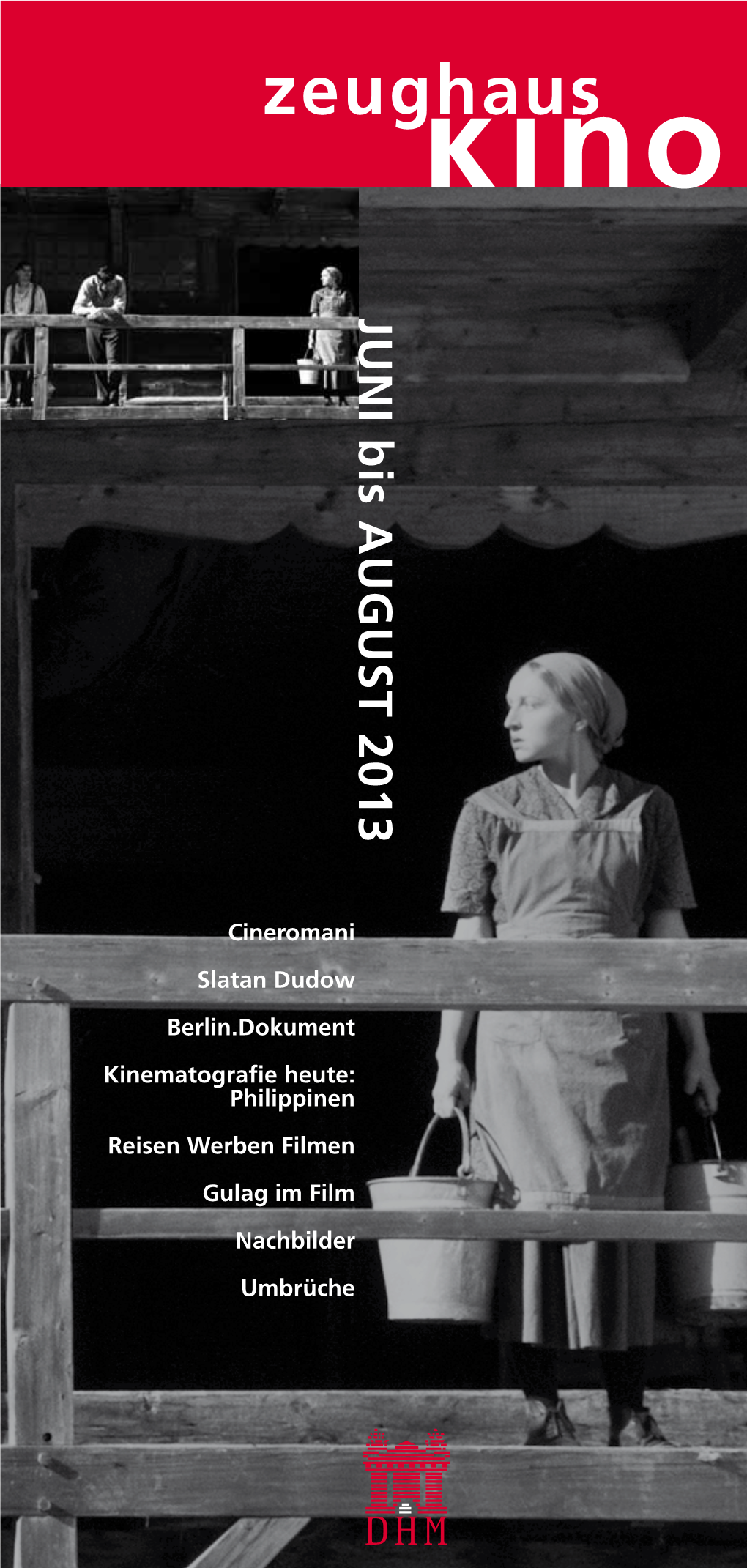
Load more
Recommended publications
-

Domestic Space in the Literature and Film of Weimar Berlin
Inside in the City: Domestic Space in the Literature and Film of Weimar Berlin by Courtney C. Johnson A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German and the Designated Emphasis in Film Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Anton Kaes, Chair Professor Deniz Göktürk Professor Mark Sandberg Spring 2016 1 Abstract Inside in the City: Domestic Space in the Literature and Film of Weimar Berlin by Courtney C. Johnson Doctor of Philosophy in German Designated Emphasis in Film Studies University of California, Berkeley Professor Anton Kaes, Chair This dissertation explores the relationship between domestic interiors and urban exteriors in Weimar literature and film. Interiors have been neglected in scholarship about Weimar Großstadtliteratur (big-city literature); scholars have focused on the street scene and the psychological effects of industrial capitalism, urbanization, and commodification. While many architecture and design theorists of the time engaged with interiors as part of a plan to modernize and thus create a new city—and society—the interiors they imagined for the Neues Wohnen (New Dwelling) are conspicuously absent from contemporary novels and films. One finds instead interiors like those of the previous century. I argue that the persistence of nineteenth-century interiors in novels and films about Weimar Berlin uncovers the tensions inherent in modern city living. The expectation of what it was like to “live” in the fictional home differs from the New Dwelling of “real- world” homes. Despite their differences, both ways of dealing with modernity seek understanding and control of the urban environment. -

Tard Exe:Plus Tard
IMAGE ET COMPAGNIE / AGAV FILMS / FRANCE 2 PRESENT ONE DAY YOU’LL UNDERSTAND DIRECTED BY AMOS GITAÏ BASED ON JÉRÔME CLÉMENT’S BOOK “PLUS TARD TU COMPRENDRAS” ome 20 years ago in an apartment overcrowded with antique objects, SRivka is trying to prepare dinner. But the Klaus Barbie trial on television breaks her concentration. Rivka is overcome with emotion listening to JÉRÔME CLÉMENT the testimony of a camp survivor. érôme Clément wrote Plus tard, tu comprendras (Grasset et Fasquelle, 2005) as an homage to his Jmother, whose parents were murdered at Auschwitz. Clément is also the author of several In Rivka's son Victor's office, the sounds of the trial are also heard. other books: Un homme en quête de vertu (Grasset, 1992), Lettres à Pierre Bérégovoy (Calmann Levy, Victor can't manage to fully concentrate on the piles of case documents on 1993), La culture expliquée à ma fille (Seuil, 1995) and Les femmes et l’amour (Stock, 2002). his desk nor his secretary's questions. Clément is currently elected President of the European television station Arte France. He’s also a board member of several cultural organizations (notably the Orchestre de Paris and Despite the intimacy of their mother-son dinner later that evening, the Théâtre du Châtelet). Clément has been decorated with the French Legion of Honor, the neither Rivka nor Victor speak of the Barbie trial. Rivka changes the subject National Order of Merit, the Society of Arts and Letters and Germany’s Grand Cross of the each time her son brings up the trial in conversation. -

Ausgabe 245 Februar 2015
Nr. 245 Kultur Februar 2015 Durch den Kakao gezogen »Das hat etwas Himmlisches« Das Kunstmuseum zeigt die bisher größte Der Cellist Maximilian Hornung setzt mit dem D ieter-Roth-Ausstellung in Stuttgart Stuttgarter Kammerorchester auf Kontraste »Über Hochfelden möchte ich wandern.« Schon sondern Buchstaben grafisch kombinierte und Als zum Abschluss des Schweizer Festivals »Som- »leidenschaftlicher Unruhegeist« erwies – so ur- beim Eintreten in die Ausstellung lässt sich die ein ganzes Buch voller »Stupidogramme« veröf- mets musicaux de Gstaad« im Februar 2013 das teilte seinerzeit die »Berliner Morgenpost«. Stimme Dieter Roths vernehmen: »Über die fentlichte, bestehend aus lauter Quadraten von Cellokonzert von Vaja Azarashvili, gespielt von Nicht nur die »Celloreisen« – so nennen Foremny B ogenbrücke möchte ich schreiten.« Viermal elf mal elf regelmäßig angeordneten Kommas. Maximilian Hornung, auf dem Programm stand, und das Stuttgarter Kammerorchester ihr Konzert wiederholt er jeden Satz. Nonchalant blättert Allem versteckten Pathos, mit dem sich die visu- mutmaßte ein Kritiker, hier solle ein schwieriges im Theaterhaus am 12. Februar – führen das Publi- der Dichter im eigenen Buch in der einstündi- elle Poesie als fortgeschrittene neue Kunstrich- zeitgenössisches Werk von beiden Seiten mit kum zu kontrastierenden Werken. Auch die Or- gen Schwarzweiß-Videoaufzeichnung von 1975, tung ausgab, entzog er so den Boden. Nur um Haydn »gezuckert« werden, um es dem Publi- chesterstücke als Rahmen des Programms könn- die gleich im Eingangsbereich neben seinen Ge- wenige Jahre später erneut mit Sonetten, Reimen kum schmackhaft zu machen. Ein schönes Bild – ten kaum unterschiedlicher sein. Luigi Boccherini, sammelten Werken aufgebaut ist: »… und mich und Versmaß zu kommen, allerdings unter dem aber unzutreffend, wie auch besagter Rezensent ebenfalls als Cellist erfolgreich, reüssierte in doch immer wieder durchgerungen zum Lied Titel »Scheisse«, mehrfach variiert bis hin zu zugeben musste. -

5. Calling for International Solidarity: Hanns Eisler’S Mass Songs in the Soviet Union
From Massenlieder to Massovaia Pesnia: Musical Exchanges between Communists and Socialists of Weimar Germany and the Early Soviet Union by Yana Alexandrovna Lowry Department of Music Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Bryan Gilliam, Supervisor ___________________________ Edna Andrews ___________________________ John Supko ___________________________ Jacqueline Waeber Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2014 i v ABSTRACT From Massenlieder to Massovaia Pesnia: Musical Exchanges between Communists and Socialists of Weimar Germany and the Early Soviet Union by Yana Alexandrovna Lowry Department of Music Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Bryan Gilliam, Supervisor ___________________________ Edna Andrews ___________________________ John Supko ___________________________ Jacqueline Waeber An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2014 Copyright by Yana Alexandrovna Lowry 2014 Abstract Group songs with direct political messages rose to enormous popularity during the interwar period (1918-1939), particularly in recently-defeated Germany and in the newly- established Soviet Union. This dissertation explores the musical relationship between these two troubled countries and aims to explain the similarities and differences in their approaches to collective singing. The discussion of the very complex and problematic relationship between the German left and the Soviet government sets the framework for the analysis of music. Beginning in late 1920s, as a result of Stalin’s abandonment of the international revolutionary cause, the divergences between the policies of the Soviet government and utopian aims of the German communist party can be traced in the musical propaganda of both countries. -

HANNS EISLER EDITION Liner Notes
HANNS EISLER EDITION Liner notes Orchestral music (CD1 & 2) passacaglia consists of the first six notes of a “series”), the second Hanns Eisler's political awareness intensified in the Twenties, the and third movements are characterized by a succinct, refined time of the Weimar Republic in Germany. The determining factors simplicity. Particularly in the third movement, Hanns Eisler strove causing this were his bitter experiences during the First World War, to create a new kind of “light music” for proletarian ears, taking up the new perspectives with which the October Revolution had a number of songs which were very popular in the labour imbued him –and many other important twentieth century artists‐ movement around 1930: Bells of Novgorod, Ivan, Dubinushka, In and finally, his growing indignation over the way in which the Vegetable Patch, Song of the Taiga. After introducing motifs musicians were failing to react to the ever‐worsening class conflicts suggesting the workers' hymn Immortal Victims, Hanns Eisler ends and the march of fascism. His radical censure of modern music led the movement with an orchestral version of Warszawjanka and a in 1926 to a rift with Arnold Schoenberg, who disapproved of the quotation of the refrain from the Internationale (“Nations hark to political leanings of his highly talented but refractory pupil (1919 to the signals”). The fourth movement bears the title Hörfleissübung 1922/23), maintaining that his altered philosophy was “not (Study in aural diligence). The twelve‐note theme now appears perceptible in his works”. distinctly in more sophisticated orchestral garb. All in all, the pervasion of the most sophisticated with the simplest is decisive This was true, Hanns Eisler having up to that point exclusively for the formation of structures and patterning. -

Fall of Grace: Nora Aunor As Cinema 46
Flores / Fall of Grace: Nora Aunor as Cinema 46 FALL OF GRACE: NORA AUNOR AS CINEMA Patrick D. Flores University of the Philippines [email protected] Abstract Nora Aunor is enlisted in this speculation as a medium in the register of both the cinema and the transmission of spirit. The key trajectory is the oft-cited film Himala, which opens up a conceptual space for mediumship, the technology of the actress, her biography and corpus of art, and the devotion to her person. The essay constellates a set of texts including the sculpture in honor of Elsa, the main character of Himala, the film Silip, and the life of a fan. Nora, the performative vessel of Elsa, becomes fundamentally cinematic. It is through her that Elsa is fleshed out as a miracle worker of vexing potency. Nora is herself a testament to the transformative potential of the technology of the cinema. Keywords devotion, film, image, medium, spirit, voice About the Author Patrick D. Flores is Professor of Art Studies at the Department of Art Studies at the University of the Philippines, which he chaired from 1997 to 2003, and Curator of the Vargas Museum in Manila. He is Adjunct Curator at the National Art Gallery, Singapore. He was one of the curators of Under Construction: New Dimensions in Asian Art in 2000 and the Gwangju Biennale (Position Papers) in 2008. He was a Visiting Fellow at the National Gallery of Art in Washington, D.C. in 1999 and an Asian Public Intellectuals Fellow in 2004. Among his publications are Painting History: Revisions in Philippine Colonial Art (1999); Remarkable Collection: Art, History, and the National Museum (2006); and Past Peripheral: Curation in Southeast Asia (2008). -

Proquest Dissertations
Saying 'G: Women, Desire and Their Depiction in East Germany by Jane Freelanci, B.A. A research essay submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts Institute of European, Russian and Eurasian Studies Carleton University Ottawa, Ontario June, 2010 ©2010, J. Freeland Library and Archives Bibliothèque et ?F? Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaONK1A0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-71676-2 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-71676-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protège cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Quarterly 1 · 2006
German Films Quarterly 1 · 2006 AT BERLIN In Competition ELEMENTARTEILCHEN by Oskar Roehler DER FREIE WILLE by Matthias Glasner REQUIEM by Hans-Christian Schmid PORTRAITS Gregor Schnitzler, Isabelle Stever, TANGRAM Film, Henry Huebchen SHOOTING STAR Johanna Wokalek SPECIAL REPORT Germans in Hollywood german films quarterly 1/2006 focus on 4 GERMANS IN HOLLYWOOD directors’ portraits 12 PASTA LA VISTA, BABY! A portrait of Gregor Schnitzler 14 FILMING AT EYE LEVEL A portrait of Isabelle Stever producer’s portrait 16 BLENDING TRADITION WITH INNOVATION A portrait of TANGRAM Filmproduktion actors’ portraits 18 GO FOR HUEBCHEN! BETWEEN MASTROIANNI AND BRANDO A portrait of Henry Huebchen 20 AT HOME ON STAGE AND SCREEN A portrait of Johanna Wokalek 22 news in production 28 AM LIMIT Pepe Danquart 28 DAS BABY MIT DEM GOLDZAHN Daniel Acht 29 DAS DOPPELTE LOTTCHEN Michael Schaack, Tobias Genkel 30 FC VENUS Ute Wieland 31 FUER DEN UNBEKANNTEN HUND Dominik Reding, Benjamin Reding 31 HELDIN Volker Schloendorff 32 LEBEN MIT HANNAH Erica von Moeller 33 LIEBESLEBEN Maria Schrader 34 MARIA AM WASSER Thomas Wendrich 35 SPECIAL Anno Saul 36 TANZ AM UFER DER TRAEUME Cosima Lange 36 TRIP TO ASIA – DIE SUCHE NACH DEM EINKLANG Thomas Grube new german films 38 3° KAELTER 3° COLDER (NEW DIRECTOR’S CUT) Florian Hoffmeister 39 12 TANGOS – ADIOS BUENOS AIRES Arne Birkenstock 40 89 MILLIMETER 89 MILLIMETRES Sebastian Heinzel 41 AFTER EFFECT Stephan Geene 42 BLACKOUT Maximilian Erlenwein 43 BUONANOTTE TOPOLINO BYE BYE BERLUSCONI! Jan Henrik Stahlberg 44 CON GAME Wolf -

Legal Wife's Angel Locsin & Maja Salvador
TFC’S BIGGEST STARS ARE COMING TO TORONTO!!! Unkabogable Vice Ganda Legal Wife’s Angel Locsin & Maja Salvador Bride for Rent’s Xian Lim Mirabella’s Enrique Gil Mr. Pure Energy Gary Valenciano plus!!! Kapamilya Celebrity Bingo hosted by Be Careful with My Heart’s Doris (Tart Carlos) & Sabel (Vivieka Ravanes) plus!!! Pinoy Food Booths, Tiangge, Giveaways & more! Advertisements go a long way with WAVES MAY 2014 Vol. 3 No.5 filipinonewswaves@ gmail.com (647) 718-1360 Miriam, Chiz & The US bases are Abad in Napo-list back? By Waves News staff By Waves News staff Justice Secretary Leila de Lima meets with Senate Blue Ribbon committee chairman Teofisto Guingona III to discuss the ‘Napolist’ yesterday. De Lima submitted the list signed by Janet Napoles (inset) to Guingona during a closed-door hearing at the sena- tor’s office. On November 24, 1992, the American Flag was lowered in Subic for the last time and The accuser becomes the accused. Senator Miriam Santiago, one of the most the last 1,416 Sailors and Marines at Subic Bay Naval Base left by plane from Naval Air vocal and staunchest critic/accuser of her lawmaker colleagues in the senate, Station Cubi Point and by the USS Belleau Wood. This withdrawal marked the first time has become herself the accused in the notorious “Pork Barrel Scandal”or the since the 16th century that no foreign military forces were present in the Philippines. Prioriy Development Assistance Fund(PDAF) scam involving billions and bil- In US President Obama’s recent visit, a new security agreement, the Enhanced De- lions of pesos in government money. -

Manila by Night As Thirdspace
Forum Kritika: A Closer Look at Manila by Night MANILA BY NIGHT AS THIRDSPACE Patrick F. Campos University of the Philippines Film Institute [email protected] Abstract The Marcosian signifier in Manila by Night has been inescapably registered in the production, distribution, and exhibition of the film and in the film text itself. The paper revisits these evaluations of the film by using Edward Soja’s broader notion of “thirdspace.” It rereads Manila by Night as Bernal’s concept of the city which approximates the lived dimension of urban spaces vis-à-vis the “concept city” of the Marcoses. Such a revaluation of Manila by Night as thirdspace 1) locates the film at the center of wider spatio-temporal interrelationship — from “global” to “national” to “cinematic” space, and 2) salvages the epistemological concerns of Bernal, which previous critiques of Manila by Night tended to eclipse. Keywords city film, cognitive map, lived city, national cinema About the Author Patrick F. Campos is a film/literary scholar and a faculty member of the University of the Philippines Film Institute. He holds an MA in Comparative Literature at the University of the Philippines and is Director of the Office of Extension and External Relations (formerly the College Secretary) of the College of Mass Communication. He is also an independent filmmaker and a musician. Author’s Note I am grateful to architects Paulo Alcazaren and Rene Luis Mata for their insights on the architecture and spaces of middle-class subdivisions discussed in the first part of the paper. ISHMAEL BERNAL’s MANILA BY NIGHT has been critically valued in geopolitical terms and rightly so. -

2016 YCC Citations Final
The Film Desk of the Young Critics Circle The 27th Annual Circle Citations for Distinguished Achievement 2016in Film for + SINE SIPat: Recasting Roles and Images, Stars,Awards, and Criticism Thursday, 27 April 2017 Jorge B. Vargas Museum University of the Philippines Roxas Avenue, UP Campus Diliman, Quezon City | 1 } 2 The 27th Annual CIrcLE CItatIONS for Distinguished Achievement in 2016Film for + SINE SIPat: Recasting Roles and Images, Stars, Awards, and Criticism 3 4 The Citation he Film Desk of the Young Critics Circle (YCC) first gave its annual citations in film achievement in 1991, a year after the YCC was Torganized by 15 reviewers and critics. In their Declaration of Principles, the members expressed the belief that cultural texts always call for active readings, “interactions” in fact among different readers who have the “unique capacities to discern, to interpret, and to reflect... evolving a dynamic discourse in which the text provokes the most imaginative ideas of our time.” The Film Desk has always committed itself to the discussion of film in the various arenas of academe and media, with the hope of fostering an alternative and emergent articulation of film critical practice, even within the severely debilitating culture of “awards.” binigay ng Film Desk ng Young Critics Circle (YCC) ang unang taunang pagkilala nito sa kahusayan sa pelikula noong 1991, ang taon pagkaraang maitatag ang YCC ng labinlimang tagapagrebyu at kritiko. Sa kanilang IDeklarasyon ng mga Prinsipyo, ipinahayag ng mga miyembro ang paniniwala na laging bukas ang mga tekstong kultural sa aktibong pagbasa, sa “mga interaksiyon” ng iba’t ibang mambabasa na may “natatanging kakayahan para sumipat, magbigay-kahulugan, at mag-isip .. -

Biblioteca “A
DVD Biblioteca “A. Palazzeschi” Archivio dei DVD posseduti ordinati per Titolo D-G per maggiori informazioni consulta il CATALOGO della Biblioteca http://catalogo.po- net.prato.it/easyweb/w2002/index.php?scelta=campi&biblio=CAR&lang= Dannati di Varsavia (I) Regia Andrzej Wajda Paese, Anno Polonia, 1957 Principali interpreti Wienczyslaw Glinski, Teresa Izewska, Tadeusz Janczar, Emil Karzwicz Genere Guerra Nel settembre del 1944, con la forza della disperazione, Varsavia insorge contro gli occupanti tedeschi, che contrattaccano con tutto il peso della loro struttura militare. Un gruppo di patrioti cerca di sfuggire all'accerchiamento tedesco attraverso le fogne ed è una terribile odissea che si carica progressivamente di toni da tragedia, man mano che le fila di questi ardimentosi si assottigliano. Un celebre, cupo capolavoro di Wajda per ricordare un episodio autentico di disperato eroismo. Una narrazione scarna e vigorosa che conferisce al film una forza sconvolgente, quasi un drammatico documentario intriso del sapore della morte Da qui all’eternità Regia Fred Zinnemann Paese, Anno Stati Uniti, 1953 Principali interpreti Burt Lancaster; Montgomery Clift; Deborah Kerr; Frank Sinatra; Donna Reed; Ernest Borgnine; Philip Ober; Mickey Shaughnessy; Claude Akins; Jack Warden; Ken Miller; Joan Shawlee; Tim Ryan; Harry Bellaver; Joseph Sargeant Genere Guerra Nell'estate del 1941, in un reparto americano di stanza alle Hawaii giunge un giovane soldato, ex pugile che non vuole più combattere perché in passato ha accecato con un pugno un suo avversario. Per farlo tornare sul ring, il capitano lo sottopone ad ogni tipo di vessazione, accusandolo di codardia. Quando però un suo amico è picchiato a morte, il soldato reagisce uccidendo a sua volta il colpevole.