Der Oboist Des Königs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Musiker-Lexikon Des Herzogtums Sachsen-Meiningen (1680-1918)
Maren Goltz Musiker-Lexikon des Herzogtums Sachsen-Meiningen (1680 - 1918) Meiningen 2012 Impressum urn:nbn:de:gbv:547-201200041 Titelbild Karl Piening mit Fritz Steinbach und Carl Wendling vor dem Meininger Theater, Photographie, undatiert, Meininger Museen B 617 2 Vorwort Das Herzogtum Sachsen-Meiningen (1680–1918) besitzt in kultureller Hinsicht eine Sonderstellung. Persönlichkeiten wie Hans von Bülow, Johannes Brahms, Richard Strauss, Fritz Steinbach und Max Reger verankerten es in der europäischen Musikgeschichte und verhalfen ihm zu einem exzellenten Ruf unter Musikern, Musikinteressierten und Gelehrten. Doch die Musikgeschichte dieser Region lässt sich nicht allein auf das Werk einzelner Lichtgestalten reduzieren. Zu bedeutsam und nachhaltig sind die komplexen Verflechtungen, welche die als überlieferungswürdig angesehenen Höchstleistungen erst ermöglichten. Trotz der Bedeutung des Herzogtums für die europäische Musikgeschichte und einer erstaunlichen Quellendichte standen bislang immer nur bestimmte Aspekte im Blickpunkt der Forschung. Einzelne Musiker bzw. Ensembles oder zeitliche bzw. regionale Fragestellungen beleuchten die Monographien „Die Herzogliche Hofkapelle in Meiningen“ (Mühlfeld, Meiningen 1910), „Hildburghäuser Musiker“ (Ullrich, Hildburghausen 2003), „Musiker und Monarchen in Meiningen 1680–1763“ (Erck/Schneider, Meiningen 2006) oder „Der Brahms- Klarinettist Richard Mühlfeld“ (Goltz/Müller, Balve 2007). Mit dem vorliegenden „Musiker-Lexikon des Herzogtums Sachsen-Meiningen“ wird erstmals der Versuch unternommen, -

JOHANN SEBASTIAN BACH an Italian Journey
JOHANN SEBASTIAN BACH an italian journey The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust TRACKLIST P. 2 ENGLISH P. 4 FRANÇAIS P. 9 ITALIANO P. 14 A 443 2 Menu JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750 AN ITALIAN JOURNEY Concerto in D major, BWV 972, after the Violin Concerto, Op. 3 No. 9 (RV 230) by Antonio Vivaldi 1 [Allegro] 2’12 2 Larghetto 2’37 3 Allegro 2’24 Fantasia and fugue in A minor, BWV 904 4 Fantasia 3’31 5 Fuga 5’16 Concerto in D minor, BWV 974, after the Oboe Concerto, S D935 by Alessandro Marcello 6 [Andante spiccato] 3’12 7 Adagio 4’22 8 Presto 4’05 Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo in B-flat major, BWV 992 9 Arioso: Adagio. Ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten. 2’16 10 Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen. 1’36 11 Adagiosissimo. Ist ein allgemeines Lamento der Freunde. 3’16 12 Allhier kommen die Freunde (weil sie doch sehen, dass es anders nicht sein kann) und nehmen Aschied. 1’02 13 Aria di Postiglione. Allegro poco. 1’28 14 Fuga all’imitatione di Posta. 2’56 Aria variata alla maniera italiana in A minor, BWV 989 15 Aria 2’22 16 Variatio 1. Largo 2’12 17 Variatio 2 1’55 18 Variatio 3 1’54 19 Variatio 4. Allegro 1’11 20 Variatio 5. Un poco Allegro 1’16 21 Variatio 6. -

1. Die Musikerfamilie Bach Kat. 1: "Ursprung Der Musicalisch-Bachischen Familie", Sog. Genealogie, Wahrscheinlich
Jens Ph. Wilhelm, "Dieß wunderbarste Räthsel aller Zeiten" (R. Wagner): Johann Sebastian Bach 1 Johann Sebastian Bachs Herkunft, Leben, Werk und Nachwirken (Katalogteil) - Auszug aus dem Katalog zu der Mannheimer Ausstellung des Bachhauses Eisenach (25.2.-26.3.2000) - 1. Die Musikerfamilie Bach Kat. 1: "Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie", sog. Genealogie, wahrscheinlich von Johann Sebastian Bach Ende 1735 verfaßt, hier in der Abschrift Anna Carolina Philippina Bachs mit Zusätzen Carl Philipp Emanuel Bachs (sog. Quelle A) [Faksimile (Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. Musikabteilung mit Mendelssohn- Archiv, Mus. ms. theor. 1215) - Bachhaus Eisenach; Bachdok. I/184] S.u. Dok. 1 mit einem Auszug hieraus. - Die von Bach verfaßte Genealogie ist in drei Abschriften überliefert. Sie umfaßt über einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren biographische Angaben zu 53 Mitgliedern der Familie Bach, fast ausnahmslos Musiker. Zusammen mit dem von Bach verwahrten "Alt-Bachischen Archiv" mit Kompositionen seiner Vorfahren und Verwandten (Kat. 5) ist sie Ausdruck seines ausgeprägten Familiensinns. (Die fragmentarische Quelle C der Genealogie befindet sich übrigens im Bachhaus Eisenach [Inv. 3.1.3.5 = R 11 aF].) Kat. 2: Stammbaum der Familie Bach, nach einer Vorlage - wohl aus dem Besitz Carl Philipp Emanuel Bachs - im 18. Jahrhundert angefertigt [Faksimile (Bibliothèque Royale Bruxelles, Sammlung Johann Jacob Heinrich Westphal) - Bachhaus Eisenach] Die Genealogie (Kat. 1) und der nach ihr angefertigte Stammbaum dienten neben dem sog. Nekrolog (Kat. 63) dem ersten Bachbiographen Johann Nikolaus Forkel als Quellen für seine Schrift "Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke" (Kat. 89). Kat. 2a: Stammbaum der Familie Bach, hrsg. vom Böhnerverein zu Gotha [Faksimile Eisenach 1999 (Bachhaus Eisenach) - Privatbesitz] Kat. -

5080 Booklet:Layout 1 16.05.2011 12:56 Uhr Seite 1
5080 booklet:Layout 1 16.05.2011 12:56 Uhr Seite 1 JOHANN LUDWIG BACH (1677-1731) CD 1 Trauermusik · Funeral Music für Soli, zwei vierstimmige Chöre, 3 Flöten, 2 Oboen, Fagott, 3 Trompeten, Pauken, Streicher und Basso continuo for soli, two four-part choirs, 3 flutes, 2 oboes, bassoon, 3 trumpets, timpani, strings and continuo PRIMA PARS [1] "O Herr, ich bin dein Knecht" (Chor/ chorus) ……………………………………………………………………. 3:20 [2] REZITATIV / RECITATIVE: "Du Gottes Ebenbild“ (Sopran / soprano) ………………………………….. 0:46 [3] ARIE / ARIA: "Ach ja, die Ketten (Sopran / soprano) …………………………………………………………… 3:30 [4] REZITATIV / RECITATIVE: "Dein Will kann nicht das...“ (Alt / alto) ………………………………….. 0:54 [5] ARIE / ARIA: "O Herr, ich bin dein Knecht" (Alt / alto) ……………………………………………………. 2:54 [6] REZITATIV / RECITATIVE.: "So kannst du aus dem Diensthaus“ (Tenor) ………………………… 1:11 [7] ARIE / ARIA: "Ob gleich aller Treiber Wut" (Tenor) …………………………………………………………. 3:51 [8] REZITATIV / RECITATIVE: "Ja, der, dem alle Macht“ (Bass) ……………………………………………. 1:02 [9] "Meine Bande sind zurissen“ (Chor/ chorus) ……………………………………………………………………. 7:54 SECUNDA PARS [10] DUETT - ARIE/ DUET - ARIA: "Ich suche nur das Himmelleben" …………………………………. 2:48 (Sopran - Alt / soprano - alto; Bass) [11] CHORAL / CHORALE: "Herr Jesu Christ" …………………………………………………………………………1:36 [12] DUETT / DUET: "Drum will ich auch Dankopfer bringen" (Alt / alto - Tenor) …………………… 1:50 [13] ARIE / ARIA: „Das, was ich meinem Gott versprochen" (Bass) ……………………………………… 1:21 [14] REPETITION CHORAL / CHORALE: "Herr Jesu Christ" …………………………………………………… -

Klarheit Und Transparenz
harmonia mundi magazin RIAS Kammerchor Klarheit und Transparenz II/2011 C RSD Radio Stephansdom.pdf 11.08.2009 12:57:15 Uhr M Y CM MY CY CMY K Johann Ludwig BACH (1677-1731) Trauermusik für Herzog Ernst-Ludwig I. von Sachsen-Meiningen Anna Prohaska (Sopran), Ivonne Fuchs (Alt), Maximilian Schmitt (Tenor), Andreas Wolf (Bass), RIAS Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin, Leitung: Hans-Christoph Rademann HMC 902080 (T01) Chefdirigent Hans-Christoph Rademann macht aus der »Trauermusik« ein Freudenfest für die Ohren Fotos: Matthias Heyde Der Vetter aus Meiningen Zu den wenigen überlieferten Werken von Johann Ludwig Bach gehört diese Johann Sebastian Bach hielt seinen repräsentative Trauermusik, die Würde und Innigkeit vereint. Hans Christoph Meininger Vetter in hohen Ehren, Rademann macht mit einem hochkarätigen Solistenquartett, dem RIAS seine Musikaliensammlung enthielt 18 Kammerchor und der Akademie für Alte Musik Berlin deutlich, warum Johann Kantaten von Johann Ludwig Bach. Sebastian Bach die Musik seines entfernten Meininger Vetters hoch schätzte. Damit wird Johann Sebastian zur wich- tigsten Überlieferungsquelle für den Die Bachs waren eine weit verzweig- geboren, trat er nach seiner musika- »Meininger Bach«, haben sich doch te Musikerdynastie. Sie führten ihre lischen Ausbildung durch den Vater darüber hinaus nur diese groß dimen- Herkunft auf Veit Bach zurück, einen und Absolvierung des Gymnasiums sionierte Trauermusik, einige weite- Bäcker aus Ungarn, der als verfolg- in Gotha im Alter von 22 Jahren in re Kantaten und Kantatenfragmente, ter Lutheraner in Thüringen Zuflucht die Hofkapelle des Herzogs von eine Messe, einige Motetten und eine fand. Schon eine Generation später war Sachsen-Meiningen ein. Vom einfa- Orchesterouvertüre von seiner Hand die Musik Familienprofession, und sie chen Musiker stieg er zunächst zum erhalten. -
![Oberti-L-K01c[Arcana-CD-Booklet].Pdf](https://docslib.b-cdn.net/cover/8234/oberti-l-k01c-arcana-cd-booklet-pdf-3038234.webp)
Oberti-L-K01c[Arcana-CD-Booklet].Pdf
JOHANN SEBASTIAN BACH an italian journey The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust TRACKLIST P. 2 ENGLISH P. 4 FRANÇAIS P. 9 ITALIANO P. 14 A 443 2 Menu JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750 AN ITALIAN JOURNEY Concerto in D major, BWV 972, after the Violin Concerto, Op. 3 No. 9 (RV 230) by Antonio Vivaldi 1 [Allegro] 2’12 2 Larghetto 2’37 3 Allegro 2’24 Fantasia and fugue in A minor, BWV 904 4 Fantasia 3’31 5 Fuga 5’16 Concerto in D minor, BWV 974, after the Oboe Concerto, S D935 by Alessandro Marcello 6 [Andante spiccato] 3’12 7 Adagio 4’22 8 Presto 4’05 Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo in B-flat major, BWV 992 9 Arioso: Adagio. Ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten. 2’16 10 Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen. 1’36 11 Adagiosissimo. Ist ein allgemeines Lamento der Freunde. 3’16 12 Allhier kommen die Freunde (weil sie doch sehen, dass es anders nicht sein kann) und nehmen Aschied. 1’02 13 Aria di Postiglione. Allegro poco. 1’28 14 Fuga all’imitatione di Posta. 2’56 Aria variata alla maniera italiana in A minor, BWV 989 15 Aria 2’22 16 Variatio 1. Largo 2’12 17 Variatio 2 1’55 18 Variatio 3 1’54 19 Variatio 4. Allegro 1’11 20 Variatio 5. Un poco Allegro 1’16 21 Variatio 6. -

2015-04-11 Duyschot Nieuwsbrief 60
www.duyschot.nl Secretariaat: Van Polanenstraat 6, 3341GP Hendrik‐Ido‐Ambacht, Tel. 078—681 9031, [email protected] april 2014 Nieuwsbrief Nummer 60 Kamerkoor Basiliuscollege laat muzikale Zaterdag 25 april 2014 16.00 uur veelzijdigheid van de familie Bach horen Herv. Dorpskerk, Kerkplein 13, Hendrik-Ido-Ambacht € 10,00 CJP en 65+: € 9,00. Tot 18 jaar: gratis toegang. Abonnementen Tijdens het concert van 25 april wordt het programma voor het nieuwe seizoen bekend ge‐ maakt. Dat seizoen telt één con‐ cert meer dan dit jaar, nl. acht. Bij die gelegenheid kunt u al een seizoenkaart bestellen voor € 50,00 . 65+‐ers betalen €45,00. 1. Er ligt een intekenlijst bij de Stond op 21 maart 2015 Johann Inhoud kassa. Het geld kunt u overma‐ Sebasan Bach in het middelpunt ken naar rekeningnummer van de belangstelling, jdens het 2. Programma Bank: NL25RABO0161074022 komende concert wordt de kring 3. Informae over de uitvoeren- U krijgt dan uw seizoenkaart van Bach‐componisten ruimer ge‐ den thuisbezorgd. trokken. De familie telde meer ta‐ 5. Familiestamboom van de 2. Telefonisch kunt u de sei‐ lent op muzikaal gebied. familie Bach zoenkaart bestellen bij ons se‐ In deze uitgave is te zien hoe een 6. Foto-impressie van het con- cretariaat. Uw kaart ligt dan ge‐ deel van de familie in elkaar stak. cert van Linker en reed bij de kassa op 3 oktober. Hierdoor wordt duidelijk hoe de Boermistrova 3. Tijdens de eerste twee con‐ verschillende Bach‐familieleden van 8. Bach-familieleden van wie certen bestaat de mogelijkheid wie een muziekstuk wordt uitge‐ werk wordt uitgevoerd de kaart bij de kassa aan te voerd, zich tot elkaar verhouden. -
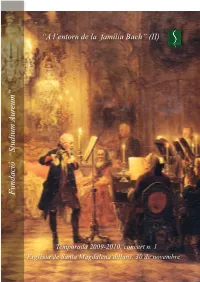
Programa N 1-2009
“A l’entorn de la família Bach” (II) Fundació “Studium Aureum” “Studium Fundació Temporada 2009-2010, concert n. 1 Església de Santa Magdalena dilluns, 30 de novembre A l’entorn de la família Bach La família Als ducats de Turingia i Saxònia durant els segles XVI al XVIII la palabra Bach era utilitzada com a sinònim de l’ofici dels músics que treballaben a les esglésies, és a dir, organistes, cantors o kapellmeisters. Tan populars i abundants foren els integrants de la família dels Bach que desenvoluparen aquesta tasca, que així anomenaren a aquesta feina encara que no fos un Bach el que la realitzàs. La família de la qual provenia Johann Sebastian Bach 1685-1750, fou una saga de músics que va dominar l’art de la composició i la interpretació al barroc i part del classicisme. Podem contabilitzar uns 70 membres de la família dedicats a la música amb una més que raonable notorietat. Per aprofundir en el tema, ens hem de remetre a la genealogia que es remunta a Hans Bach el 1561 en Wechmar, Gaspar Bach i Veit Bach mort el 1610 foren els primers d’aquesta família. Johann Ambrosius Bach 1645-1695 Els Bach visqueren als ducats de Turíngia, Saxònia- Weimar-Eisenach, Saxònia-Coburgo-Gotha i Saxònia- Meiningen i al Principat de Schwarburg-Árnstadt, on el Així es creà l’arxiu Bach del qual en Carl Philip luteranisme era la religió oficial i com que la música era Enmanuel, fill de Johann Sebastian, en tenia una bona un part molt important de la litúrgia, els llocs de feina part. -

Primera Hoja Teresa Aledo
UNIVERSIDAD DE MURCIA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO La Palabra a Través del Prisma Musical de Johann Sebastian Bach. Análisis de sus Dos Grandes Obras Teológicas. Dña. Teresa Aledo Villodre 2019 UNIVERSIDAD DE MURCIA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO La Palabra a través del prisma musical de Johann Sebastian Bach. Análisis de sus dos grandes obras teológicas. Teresa Aledo Villodre 2019 UNIVERSIDAD DE MURCIA INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA Programa de Doctorado en Artes y Humanidades Línea de Investigación en Teología La Palabra a través del prisma musical de Johann Sebastian Bach. Análisis de sus dos grandes obras teológicas. Director: José Antonio Molina Gómez y Arnau Reynés Florit Teresa Aledo Villodre 2019 Para todos aquellos que son capaces de ver sin mirar, de sentir sin ver, de intuir. ÍNDICE 1. Introducción .................................................................................................................. 1 2. Contexto bibliográfico referente a Johann Sebastian Bach .......................................... 4 3. La importancia de la música en la liturgia luterana .................................................... 21 3.1 Relación entre música y liturgia desde Martin Lutero a Johann Sebastian Bach . 22 3.2 Situación del barroco musical ............................................................................... 39 4. ¿Quién fue J. S. Bach? ................................................................................................ 44 4.1. La familia Bach ................................................................................................... -
Bach Notes No. 3
No. 3 Spring 2005 BACH NOTES THE NEWSLETTER OF THE AMERICAN BACH SOCIETY DID BACH PERFORM SACRED MUSIC BY JOHANN MATTHESON IN LEIPZIG? STEFFEN VOSS Unlike Bach’s first two Leipzig cantata cycles, of 1723-24 and 1724-25, which include a sacred can- tata for almost every occasion of the liturgical year, the third cycle, of 1725-27, contains numerous, substantial breaks in the continuity.1 The first of these breaks occurs at the very beginning of the cycle, between the concluding work of the second cycle, the 1725 Trinity cantata Es ist ein trotzig und verzagt Ding, BWV 176, to a text by Mariane von Ziegler, and the first known work of this cycle, Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 168, for the ninth Sunday after Trinity. Some light was shed on the identity of the cantatas that preceded Tue Rechnung! Donnerwort by Wolf Hobohm’s discovery in the Saltykov-Shtshedrin The remaining text from this printed col- Library in Leningrad (today, the Russian lection, for Visitation, is an anonymous IN THIS ISSUE: National Library, St. Petersburg) of a 1725 poetic paraphrase of the Magnificat, the PAGE Texte zur Leipziger Kirchen-Music forfor Virgin Mary’s hymn of praise to God from the third, fifth, and sixth Sundays after Luke 1: 46-55, which forms the central 1. Did Bach Perform Sacred Music Trinity and for the feasts of St. John’s and part of the Gospel associated with this by Johann Mattheson in Leipzig? by Steffen Voss Visitation.2 These five texts represent the feast.4 Because the paraphrase preserves complete repertory of church cantatas per- the original Lutheran translation in the 6. -

Dorothea Schröder Johann Sebastian Bach
Unverkäufliche Leseprobe Dorothea Schröder Johann Sebastian Bach 128 Seiten, Paperback ISBN: 978-3-406-62227-4 Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.chbeck.de/8550522 © Verlag C.H.Beck oHG, München 1. Kindheit in Eisenach: 1685–1695 Johann Sebastian Bach gehörte, wie Carl Philipp Emanuel Bach im Nekrolog hervorhob, «zu einem Geschlechte, welchem Lie- be und Geschicklichkeit zur Musick, gleichsam als ein allgemei- nes Geschenck, für alle seine Mitglieder, von der Natur mitge- theilet zu seyn scheinen». In der Tat ist der Stammbaum der Fa- milie Bach der imposanteste, den es in der Musikgeschichte Europas gibt: Er erstreckt sich über acht Generationen vom 16. Jahrhundert bis ins Jahr 1840, also über etwa 300 Jahre, mit sechsundachtzig gezählten Personen, von denen nur neun Nicht-Musiker waren. Dabei bleibt das Gesamtbild der Familie jedoch unvollständig, denn der offi zielle Stammbaum nennt nur genealogisch und musikhistorisch wichtige Männer. Verwand- te, die andere Berufe ergriffen, fehlen ebenso wie alle Frauen, so dass Heiratsverbindungen mit anderen Musikerfamilien nicht sichtbar werden. Als Rechtfertigung für diese Auslassungen kann nur die Tatsache gelten, dass eine vollständige Darstellung die üblichen Druckformate sprengen würde. Auch müsste ein kompletter Stammbaum bis in unsere Zeit reichen: Noch heute leben Nachkommen der Bach-Familie in Deutschland. Sie füh- ren sich allerdings nicht auf Johann Sebastian, sondern auf sei- nen entfernten Vetter Johann Ludwig Bach (1677–1731) aus der Meininger Linie zurück. Im Jahr 1685, dem Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach, waren acht Mitglieder seiner Familie als Organisten, Kantoren oder Hofmusiker in der Region zwischen Eisenach, Erfurt und Meiningen tätig. Mit der neuen, ab etwa 1670 geborenen Gene- ration verdoppelte sich die Zahl: Um 1705 lassen sich sechzehn Verwandte in Musikerberufen nachweisen, die über Thüringen hinaus auch in Braunschweig und Schweinfurt ansässig wur- den. -

BOSTON SY/APHONY Oratestra For,Classicat, Hoyic I Rotnri IN% • HU IC
BOSTON SY/APHONY oRatESTRA for,CLassicAt, Hoyic I rotnri IN% • HU IC Individuality in Playing. Every one can play the JEW-IAN, but no two alike. Some play with more expression than others, even rendering Symphonies or Wagnerian Operas with better effect than the average orchestra. With an -EOLIAN in the home, the standard musical works are as available as the books of your library. In either case it is simply a question of reading or interpretation. DESCRIPTION IS USELESS. ONE MUST SEE THE IEOLIAN TO UNDERSTAND AND APPRECIATE IT. Mme. MELBA. "When I first heard of the iEOLIAN, I was unable to understand how a musical instrument requiring no technical knowledge on the part of the performer could be artistic from the musician's standpoint. I do not think it possible for any one to un- derstand it unless they do as I did,— see it and hear it played. I am sure that every one that does will join me in a hearty indorsement of your truly wonderful instrument." We invite all music lovers to call and hear the /EOLIAN. illasonVtanilin Sole Agents, 146 BOYLSTON STREET, . BOSTON. Boston Music Hall, Boston. Symphony FOURTEENTH SEASON, sj Orchestra 1894-95. EMIL PAUR, Conductor. PROGRAMME OF THE \6TH REHEARSAL AND CONCERT WITH HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NOTES BY WILLIAM F. APTHORP. Friday Afternoon, December 21, At 2.30 o'clock. Saturday Evening, December 22, At 8 o'clock. PUBLISHED BY C. A. ELLIS, MANAGER. (321) lliason&I nal A JUST VERDICT. New York Musical Courier, October 31, 1894. SUCCESS OF THE STRINGER.