VORWORT 1. Was Heißt Hier Folk?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Swedish Folk Music
Ronström Owe 1998: Swedish folk music. Unpublished. Swedish folk music Originally written for Encyclopaedia of world music. By Owe Ronström 1. Concepts, terminology. In Sweden, the term " folkmusik " (folk music) usually refers to orally transmitted music of the rural classes in "the old peasant society", as the Swedish expression goes. " Populärmusik " ("popular music") usually refers to "modern" music created foremost for a city audience. As a result of the interchange between these two emerged what may be defined as a "city folklore", which around 1920 was coined "gammeldans " ("old time dance music"). During the last few decades the term " folklig musik " ("folkish music") has become used as an umbrella term for folk music, gammeldans and some other forms of popular music. In the 1990s "ethnic music", and "world music" have been introduced, most often for modernised forms of non-Swedish folk and popular music. 2. Construction of a national Swedish folk music. Swedish folk music is a composite of a large number of heterogeneous styles and genres, accumulated throughout the centuries. In retrospect, however, these diverse traditions, genres, forms and styles, may seem as a more or less homogenous mass, especially in comparison to today's musical diversity. But to a large extent this homogeneity is a result of powerful ideological filtering processes, by which the heterogeneity of the musical traditions of the rural classes has become seriously reduced. The homogenising of Swedish folk music started already in the late 1800th century, with the introduction of national-romantic ideas from German and French intellectuals, such as the notion of a "folk", with a specifically Swedish cultural tradition. -

Download PDF Booklet
“I am one of the last of a small tribe of troubadours who still believe that life is a beautiful and exciting journey with a purpose and grace well worth singing about.” E Y Harburg Purpose + Grace started as a list of songs and a list of possible guests. It is a wide mixture of material, from a traditional song I first heard 50 years ago, other songs that have been with me for decades, waiting to be arranged, to new original songs. You stand in a long line when you perform songs like this, you honour the ancestors, but hopefully the songs become, if only briefly your own, or a part of you. To call on my friends and peers to make this recording has been a great pleasure. Turning the two lists into a coherent whole was joyous. On previous recordings I’ve invited guest musicians to play their instruments, here, I asked singers for their unique contributions to these songs. Accompanying song has always been my favourite occupation, so it made perfect sense to have vocal and instrumental collaborations. In 1976 I had just released my first album and had been picked up by a heavy, old school music business manager whose avowed intent was to make me a star. I was not averse to the concept, and went straight from small folk clubs to opening shows for Steeleye Span at the biggest halls in the country. Early the next year June Tabor asked me if I would accompany her on tour. I was ecstatic and duly reported to my manager, who told me I was a star and didn’t play for other people. -

Fingerstyle Guitar Solos
Fingerstyle Guitar Solos from the playing of DaveyGraham, Blind Blake, Stefan Grossman Bert Janschand John Renbourn using standardtuning transcribed by Peter Billam and some pieces by Peter Billam ©Peter J Billam, 2017 This score is offered under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence; see creativecommons.org This edition 7 September 2021. www.pjb.com.au Finger-style Folk-guitar Instrumentals These scores are something I always wished I had when I was fingerpicking steel-strung guitars in the the folk clubs of London in the late 1960s. Included are instrumentals for solo guitar,all in standard tuning, including a couple of my own, but mostly from the early albums of Davey Graham, Stefan Grossman, Bert Jansch and John Renbourn. Everyone trying to play the folk guitar must own those albums ! not to mention those by Al Stewart, John Martyn, RoyHarper,Dando Shaft, the Incredible String Band . it was a moment of great creative flowering. Theyplayed often with a Capo on second or third fret, and mostly in triplet-rhythm, which I have notated in 12/16 and 9/16 to makethe beats clearer by grouping them under the same beam. An ascii-tab tablature edition of these pieces is also available. Davey Graham was playing jazz standards - tune, chords and bass - just as a piano trio could. And not so much by brute virtuosity,asbyintelligence: by letting the arrangement growout from the guitar.Just consult Cry Me a River on youtube to see hownaturally the playing lies on Davey’s six strings. Blind Blake, star of Piedmont blues, recorded more than 100 sides in Chicago in 1927-1932, and was one of the great influences on Gary Davis. -

01539 725133
Sep - Dec 2017 breweryarts.co.uk | 01539 725133 NEW! Sound of the Sirens - Thu 7 Dec 01 Sep - Dec 2017 Box Office: 01539 725133 For full listings and to book online: breweryarts.co.uk WELCOME TO A NEW! SEASON AT THE BREWERY Welcome to The Brewery, NEW Website South Lakeland’s home of culture and entertainment! We are pleased to announce that we are currently developing a new Not only is this autumn our website which is scheduled to go biggest season, we’ve worked live early in the autumn. hard to bring you an exciting The new site will provide visitors with a smooth selection of brand new bands, booking process and up-to-date information artists and shows and we’ll be about everything going on at the Brewery and telling you a bit more about it will also be fully compatible with mobile them in this brochure. devices, phones and tablets. Stay tuned for announcements… exciting times! Take a look at all the great stuff coming up! We’re very excited NEW Work and are sure you will be too! For the autumn, we have commissioned three pieces of dance as part of a new dance project. Entitled Journey, the event will take over all of The Brewery’s main spaces for a day in September during which visitors can experience a broad range of styles from clogging to popping! See page 15 for details! Follow us on twitter: @BACKendal | facebook: facebook.com/breweryartscentre Welcome 02 NEW Classes NEW Menu The Brewery is known Our Head Chef Mark for its inspiring and Robson has been busy diverse classes and sourcing the best local workshops for young ingredients to add a new people and adults. -

Youth Folk Opportunities Around England 2020
Youth Folk Opportunities around England 2020 Directory collated and produced by the English Folk Dance and Song Society. This directory is produced as part of the English Folk Dance and Song Society’s National Youth Folk Ensemble programme, which aims to promote, develop and link youth folk music activities across England. There are lots of ways to get involved in folk music through a wide range of organisations in England. Here we share a selection of regional and national opportunities for young people who play or are interested in exploring folk and traditional music. These include folk bands, summer schools, competitions, courses, bursaries, and creative learning projects. If you would like to add to this directory in the future, or if you’re interested in finding out more about youth folk music, please contact [email protected] You can download a PDF of this directory from efdss.org/youth-folk-opportunities National pages 3–5 London pages 5–6 North East page 6–7 North West page 7 South East page 8 South West pages 8–9 West Midlands page 9 Yorkshire and the Humber pages 9–10 These listings were compiled before the Coronavirus pandemic. Since then, many events have been postponed or cancelled. Please contact the organisations directly to find out more The English Folk Dance and Song Society has compiled these listings in good faith. However it cannot guarantee the accuracy of any information listed here, or the quality and safety of the activities. Please contact individual organisations for information about their programmes and safeguarding policies. EFDSS is the national folk arts development organisation for England. -

Fmqautumn 2016 3 FMQ :: Autumn 2016
Olavi Louhivuori Physical and Gender equality : : p. 6 cultural in music environments – unfinished of music business? : : p. 12–43 : : p. 44–53 Finnish Music Quarterly FMQAutumn 2016 Contents :: EditorialBY ANU AHOLA Autumn 2016 3 3 Editorial 4 News :: FMQ 6 Beyond genre BY Wif Stenger on Olavi Louhivuori Aural landscapes, sonic mindscapes AUTUMN 12 The voice of freedom BY Andrew Mellor on Outi Tarkiainen 2016 14 Collective resonance BY Merja Hottinen on Nathan Riki Thomson The foundation of every culture consists of the natural environment and the customs and beliefs of the community living in it. These basic elements 18 Spaces and pigeonholes BY Hanna Isolammi shape each other constantly, sometimes in surprising ways. In this issue Jussi Puikkonen on Susanna Mälkki we explore the relationship between music and environment, both natural and cultural. What traces, influences and meanings of the environment do 20 The North in music BY Andrew Mellor the people who create, consume and study music find in it today? 24 Natural born preachers BY Janne Flinkkilä This question prompted further questions: How does a language envi- on Radiopuhelimet ronment manifest itself in music? Why does performing a concert in the natural environment seem to enhance the experience? And what about 26 10 Finnish songs about and inspired by nature BY Matti Nives the evolution of music: is music essential for human beings, biologically speaking? 28 Taking Note: Naturally good music BY Juha Torvinen Although definitive answers cannot be found for all these questions, 30 Nature’s concert halls BY Heidi Horila it is obvious that creating and experiencing music are always affected by on the force of nature in Finnish music events nature, by nurture and by the culture we live in. -

Chiltina Clarion 2004
2 o o 4 Current contents: Page 2 Editorial Page 4 Harry Scurfields Chiltina Workshop/ Geoff Thorp Page 8 Anglos in Bristol / Jenny Cox Page 12 Wheatstone Bicentennial Concert / David Lee Page 15 Folk Jottings / David Lee Page 17 Cecil Sharp Centennial Festival/ Geoff Thorp Page 19 Concertinas in Hungary/ Jane Bird Page 21 Giving up "Angling" / Rob in Tims Page 27 Kilve Autumn Concertina Weekend?Martin Henshaw Page 30 So you want to participate in Folk Sesslons/ Geoff Thorp Page 32 Son Accompaniment / Martin Henshaw Page 41 Stop Press: Song Accompaniment for English Concertina Dick Miles Page 44 Visit to Sotherbys/ Horniman / Martin Henshaw Page 47 Tailpiece / Editor Page 48 Bo lton English Concert ina.,. Band Pic. Jenny Cox Editorial .. off at the terminal - one colleague waS kind enough to gi ve me a li st of things Ok - it's late ... Okl Okl - look time to say and do if the boss caught me passes - and as you get older yo u stop asleep at the desk - of which my fa noticing that a little more has slipped vourite was simply to sit up and soya out of the door. I know I'm sitting very pious "AM EN!". though I don't here with apparently all the time in the think I ever foo led anyone! world to get all these things done - I mean - that IS what being retired is But how time does fly - the mirror supposed to mean isn't it? Eh? Putting starts to tell an unpalatable truth - the feet up , playing gentle lulling melo and the children are suddenly older dies on the leather ferret - reading and wiser. -

The Folk Club of Reston-Herndon Preserving the Traditions of Folk Music, Folk Lore, and Gentle Folk Ways Volume 28, Issue 7 July 2012
The Folk Club of Reston-Herndon Preserving the traditions of Folk Music, Folk Lore, and Gentle Folk Ways www.RestonHerndonFolkClub.com Volume 28, Issue 7 July 2012 July 10 Showcase – Scott Malyszka & Friends When I was a spiritual person in my younger days, I loved a good sermon. Now you ask various church people what makes a good sermon, and you'll have trouble getting a lot of agreement. Some people want to hear comfortable, familiar platitudes, and some like loud shouting and stomping around. Others expect the preacher to give a deep academic exposition of a text or topic. I knew one strange guy who would say, "If I don't feel guilty and ashamed after a sermon, then that preacher isn't doing his job." Whoa, yikes! I always felt that a good sermon simply meant telling a good story. When a person could stand in front of an audience and paint stories in their imaginations, well that's what I liked. And when I had the task of delivering a sermon, I tried to put together twenty minutes of good stories. I modeled my sermons on Garrison Keeler and John Steinbeck rather than Billy Graham or Jimmy Swaggart, the most popular preachers back then. After many years as a church person I came to the cynical conclusion that most people go to church to see their friends and to be entertained by the sermon and the music. I'm not a spiritual person now, but I do have a great appreciation for friends, stories, and music. I'm always finding intriguing new melodies from fiddle tunes and songs, and writing my own songs is my way of making up stories today. -

Dartington International Summer School & Festival
Dartington International Summer School & Festival A Music School by Day, A Concert Hall by Night 29 Jul - 26 Aug Welcome It’s an enormous pleasure to welcome you to Dartington International Summer School & Festival. Dartington is a place of shimmering beauty, and its world-famous Summer School is for everyone: for professional musicians and music students, for people who love to listen, and for people who want to debate ideas. The 2017 programme engages with music reflecting migration and exile, ancient and new, and complexities of identity, nation and revolution. Play in a brass ensemble, and learn about Middle Eastern and Brazilian music. Experience everything from medieval and renaissance music to salsa and jazz. Listen to legendary pianist Alfred Brendel on Schubert; Stories in Transit hosted by Marina Warner; and folk sessions with Martin and Eliza Carthy. There are poetry and multimedia courses, yoga and dance, lectures and films. Dartington hosts over ninety public concerts and events throughout August. Visit the beautiful gardens, relax with a drink or a meal, and immerse yourself in world-class performances, from afternoon to late night; some of the most celebrated musicians, writers and thinkers will be here. On April 28th we present our second Party in the Town, happening all over Totnes, and collaborating with local artists and young people. Take a look on the website for details of this exciting event. Dartington International Summer School has expanded into a fully-fledged, exuberant festival, and gets more action-packed every year. I look forward to welcoming you to a wonderful summer of music, arts and creativity! Joanna MacGregor, Artistic Director Thank you to our current supporters Bursary awards for outstanding students Andor Charitable Trust, Anonymous, John Ashton Thomas, Barbara Whatmore Charitable Many of our current supporters fund bursaries. -

The Newsletter of Readifolk
The Newsletter of Rea difolk Reading's folk song and music club Nights. We work on the assumption that you are not all on holiday at the same time, so do come along and support us whenever you can. To paraphrase that well known call of Lord Kitchener – ‘Your Folk Club Needs You’. The charitable members of Readifolk were very busy during June. Morag and Annie organised a whole day folk event, Folk4Afrika, to raise funds for a charity helping street children in Ghana. A large group of Readifolk members helped in running the event and many performed in the afternoon children’s session and in the evening concert. Readifolk was again out in force at the Boars Bridge Charity Festival which was in support of the MS Society. Well done to all who took part in these events. Looking back over the last quarter we recall some really memorable evenings. A glance through the independent reviews Readifolk is going on in this issue will confirm the quality of the performers that we have air – well into the ethernet actually. Yes, we have been invited by booked. As usual, you will find on the back page our programme Reading Community Radio to produce a regular weekly folk of events for the next quarter, July – September. Unlike many music programme called the Readifolk Hour. This will include other folk clubs, Readifolk meets throughout the summer with our music, news and comments, produced and presented by a team usual mix of excellent Guest Nights and Singers and Theme of Readifolk enthusiasts. We already have several programmes ‘in the can’ which we are sure you will find enjoyable and worth listening to, and will help to promote the club and its activities. -
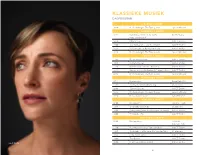
W4903 Woordfees Gids.Indb
KLASSIEKE MUSIEK DAGPROGRAM VRYDAG 2 Maart 20:30 Die feëkoningin | The Fairy Queen Spier Amfiteater SATERDAG 3 Maart 10:15 Familiedag: Pieter en die wolf | Coetzenburg Peter and the Wolf 14:30 Chiaroscuro kykNET Fismer 15:00 Suid Afrikaanse soprane: Heldinne kykNET Endler 20:00 US Camerata eer Bennie van Eeden kykNET Endler 20:30 Die feëkoningin | The Fairy Queen Spier Amfiteater SONDAG 4 Maart 11:00 Die soldaat se storie kykNET Fismer 15:00 Signum Quartet kykNET Endler 17:30 Vivaldi’s Four Seasons – Revisited kykNET Fismer 20:00 Universiteit van Stellenbosch Simfonieorkes kykNET Endler 20:30 Die feëkoningin | The Fairy Queen Spier Amfiteater MAANDAG 5 Maart 07:00 Khoi’npsalms Rynse Kerk VGK 13:15 Orrelweek: Winand Grundling Moederkerk 20:00 Signum Quartet kykNET Endler 20:30 Die feëkoningin | The Fairy Queen Spier Amfiteater 20:30 Die soldaat se storie kykNET Fismer DINSDAG 6 Maart 07:00 Khoi’npsalms VGK Cloetesville 13:15 Orrelweek: Mario Nell Moederkerk 14:00 Amici String Quartet and Morgan Szymanski kykNET Fismer 20:00 Tim Kliphuis Trio kykNET Endler WOENSDAG 7 Maart 07:00 Khoi’npsalms St. Mark’s Katolieke Kerk 12:30 Die Winterreise deur Franz Schubert kykNET Fismer 13:15 Orrelweek: Eon Malan en Christopher Petri Moederkerk 18:00 Cello meets Dance kykNET Endler 18:00 Two Guitars kykNET Fismer Liesl Stoltz 20:00 Ben Capps & Bryan Wallick kykNET Endler 162 163 KLASSIEKE MUSIEK DONDERDAG 8 MAART AFRICAN EXPLORATIONS 07:00 Khoi’npsalms Moederkerk Stoltz Produksies Met: Liesl Stoltz (fluit), Peter Martens (tjello) en José Dias (klavier) 13:15 Orrelweek: Grant Bräsler Moederkerk 13:15 Stellenbosch Universiteitskoor kykNET Endler In 2011 het Liesl Stoltz begin met ’n post-doktorale projek om Suid-Afrikaanse kunsmusiek- komponiste en veral hul fl uitkomposisies te bevorder. -

Daithi Sproule Knows How to Make a Guitar Sing: His New CD Features
Daithi Sproule Knows How to Skara Brae originally formed during 1969- Make a Guitar Sing: His New CD 70 and released their self-titled debut on Features 13 of His Own Tunes the Gael-Linn label in 1971. (Shanachie reissued it stateside on LP in 1983.) The performance that the reunited quartet CEOL gave in 1997 in Donegal provided, at long last, the impetus for a 1998 CD reissue on By Earle Hitchner Gael-Linn of "Skara Brae," buttressed by two songs not on the original LP. [Published on July 9, 2008, in the IRISH ECHO newspaper, New York But in many critical discussions of City. Copyright (c) Earle Hitchner. All such groups as Skara Brae, Bowhand (with fiddler James Kelly and Offaly rights reserved. Reprinted by accordionist Paddy O'Brien), Trian (with permission of author.] fiddler Liz Carroll and accordionist Billy McComiskey), and Altan, the contributions of member Daithi Sproule tend to get short All longtime Irish traditional music shrift. Even Sproule's fine solo debut in fans have a wish list for reunions, and 1995, "A Heart Made of Glass," seemed to mine once included Planxty, the Bothy draw scant attention. Band, and Skara Brae. Also consider Trian's debut album In 2004 the original Planxty lineup in 1992. The praise heaped on its of Christy Moore, Liam O'Flynn, Andy impressive instrumental playing was Irvine, and Donal Lunny got together deserved, but suffering from a bit of critical again for a dozen concerts. neglect were Sproule's exceptional singing and guitar setting of "Captain Thompson." At Dublin's Vicar Street on May And on "Trian II" in 1995, Sproule tenderly 24, 2007, the Bothy Band reunited, except covered "The Death of Queen Jane," a for one member, singer-guitarist Micheal song he wrote the melody for and earlier O Domhnaill.