Behinderung Und Gesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

H-Diplo ROUNDTABLE XXI-14
H-Diplo ROUNDTABLE XXI-14 Edith Sheffer, Asperger’s Children: The Origins of Autism in Nazi Vienna. New York: W.W. Norton, 2018. ISBN: 9780393609646. 15 November 2019 | https://hdiplo.org/to/RT21-14 Roundtable Editors: Daniel Steinmetz-Jenkins and Diane Labrosse | Production Editor: George Fujii Contents Introduction by Benjamin P. Hein, Brown University, Samuel Clowes Huneke, George Mason University, and Michelle Lynn Kahn, University of Richmond .........................................................................................................................................................................................................2 Review by Kathryn Brackney, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies ............................................................................................5 Review by David Freis, University of Münster .......................................................................................................................................................................8 Review by Dagmar Herzog, Graduate Center, City University of New York .................................................................................................... 11 Response by Edith Sheffer, University of California, Berkeley ................................................................................................................................... 14 H-Diplo Roundtable XXI-14 Introduction by Benjamin P. Hein, Brown University, Samuel Clowes Huneke, George Mason University, and Michelle Lynn Kahn, -

Hans Asperger, National Socialism, and “Race Hygiene” in Nazi-Era Vienna Herwig Czech
Czech Molecular Autism _#####################_ https://doi.org/10.1186/s13229-018-0208-6 RESEARCH Open Access Hans Asperger, National Socialism, and “race hygiene” in Nazi-era Vienna Herwig Czech Abstract Background: Hans Asperger (1906–1980) first designated a group of children with distinct psychological characteristics as ‘autistic psychopaths’ in 1938, several years before Leo Kanner’s famous 1943 paper on autism. In 1944, Asperger published a comprehensive study on the topic (submitted to Vienna University in 1942 as his postdoctoral thesis), which would only find international acknowledgement in the 1980s. From then on, the eponym ‘Asperger’s syndrome’ increasingly gained currency in recognition of his outstanding contribution to the conceptualization of the condition. At the time, the fact that Asperger had spent pivotal years of his career in Nazi Vienna caused some controversy regarding his potential ties to National Socialism and its race hygiene policies. Documentary evidence was scarce, however, and over time a narrative of Asperger as an active opponent of National Socialism took hold. The main goal of this paper is to re-evaluate this narrative, which is based to a large extent on statements made by Asperger himself and on a small segment of his published work. Methods: Drawing on a vast array of contemporary publications and previously unexplored archival documents (including Asperger’s personnel files and the clinical assessments he wrote on his patients), this paper offers a critical examination of Asperger’s life, politics, and career before and during the Nazi period in Austria. Results: Asperger managed to accommodate himself to the Nazi regime and was rewarded for his affirmations of loyalty with career opportunities. -

Leben Und Werk Des Jüdischen Wissenschaftlers Und Kinderarztes Erich Benjamin
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München (Vorstand: Univ.-Prof. Dr. J. C. Wilmanns) Leben und Werk des jüdischen Wissenschaftlers und Kinderarztes Erich Benjamin * 1880 in Berlin † 1943 in Baltimore Susanne Oechsle Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Medizin genehmigten Dissertation. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. D. Neumeier Prüfer der Dissertation: 1. Univ.-Prof. Dr. J. C. Wilmanns 2. Univ.-Prof. Dr. A. Neiß 3. Univ.-Prof. Dr. W. Arnold Die Dissertation wurde am 30.06.2003 bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät für Medizin am 17.03.2004 angenommen. III Je weiser und besser ein Mensch ist, umso mehr Gutes bemerkt er in den Menschen. B. Pascal Diese Arbeit widme ich meiner lieben Schwester Sabine. V Abbildung 1: Erich Benjamin, etwa Mitte der 1930er Jahre. Quelle: Jäckle (1988) S. 52. Verzeichnisse VII Inhaltsverzeichnis I. Einleitung.......................................................................................................... 1 II. Quellenlage....................................................................................................... 3 1. Stand der Forschung.................................................................................... 3 2. Spurensuche ................................................................................................ 3 2.1 Spuren zu Benjamins beruflichem Werdegang .......................................................... -

'Non-Complicit: Revisiting Hans Asperger's Career in Nazi-Era Vienna'
Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49:3883–3887 https://doi.org/10.1007/s10803-019-04106-w RESPONSE Response to ‘Non‑complicit: Revisiting Hans Asperger’s Career in Nazi‑era Vienna’ Herwig Czech1,2 Published online: 13 June 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In her recent paper ‘Non-complicit: Revisiting Hans Asperger’s Career in Nazi-era Vienna,’ Dean Falk claims to refute what she calls ‘allegations’ about Hans Asperger’s role during National Socialism documented in my 2018 paper ‘Hans Asperger, National Socialism, and “race hygiene” in Nazi-era Vienna’ and Edith Shefer’s book ‘Asperger’s Children.’ Falk’s paper, which relies heavily on online translation software, does not contain a single relevant piece of new evidence, but abounds with mistranslations, misrepresentations of the content of sources, and basic factual errors, and omits everything that does not support the author’s agenda of defending Hans Asperger’s record. The paper should never have passed peer review and, in view of the academic credibility of all parties concerned, it should be retracted. Keywords Asperger syndrome · Hans Asperger · National socialism · Nazi ‘euthanasia · Nazi-era Vienna · Therapeutic pedagogy (Heilpädagogik) In her paper ‘Non-complicit: Revisiting Hans Asperger’s on online translation tools), and a refusal to seriously engage Career in Nazi-era Vienna’, evolutionary anthropologist with the evidence presented in my paper by omitting every- Dean Falk claims to refute what she calls ‘allegations’ thing that does not support the author’s manifest agenda of raised against Asperger (Czech 2018; Shefer 2018) ‘with defending Hans Asperger’s record. -

AUSTRIAN STUDIES NEWSMAGAZINE Vol
THE CENTER for AUSTRIAN STUDIES AUSTRIAN STUDIES NEWSMAGAZINE Vol. 28, No. 2 • Fall 2016 In this issue: Luther exhibit at Mia • Cohen, Pinkerton retire Spring Austrian presidential election and more FALL2016TOC departments ASN News from the Center 4 Austrian Studies Graduate Student Workshop - CAS Prize Winners - Newsmagazine Gary Cohen retires - Adriatic Symposium - Edith Volume 28, No. 2 • Fall 2016 Sheffer interview - Daniel Pinkerton retires& more Designed & edited by Daniel Pinkerton Politics & Society 10 Editorial Assistants: Michaela Bunke, Elizabeth Dillenburg, Austrian spring elections - Friedrich Schneider interview and Jennifer Hammer Arts & Culture 14 ASN is published twice annually, in spring and fall, and is 2016 Salzburg Festival review; ACF exhibit: Vienna distributed free of charge to interested subscribers as a public service of the Center for Austrian Studies. Design Week Director: Howard Louthan Books: News & Reviews 16 Program Coordinator: Jennifer Hammer New books by Judson, Zahra, Deak, and Pytell - Editor: Daniel Pinkerton Hot off the Presses Send subscription requests or contributions to: Scholars & Scholarship 22 Center for Austrian Studies University of Minnesota Fulbright Austria - interview with Roberta Maierhofer - Attn: Austrian Studies Newsmagazine Contemporary Austrian Studies turns 25 - Canada’s 314 Social Sciences Building 267 19th Avenue S. migration views - ASA meets in Vienna & more Minneapolis MN 55455 Phone: 612-624-9811; fax: 612-626-9004 Website: http://www.cla.umn.edu/austrian Gathering at the Brewery Editor: [email protected] ON OUR COVER: Martin Luther’s Defense before the Diet of Worms, April 1521. Czech pamphlet, Prague 1521. CORRECTION In “Judith Eiblmayr: Design in Austria and America,” (ASN Spring 2016, beginning on p. -
Copyrighted Material
1 The Two Great Pioneers “Nothing is totally original. Everyone is influenced by what’s gone before.” (Dr. Lorna Wing in conversation with Adam Feinstein) “Whatever will they think of next?” (Reported comment by the Hollywood producer, Sam Goldwyn, on being shown an ancient sundial) The two great pioneers in the field of autism, Dr. Hans Asperger and Dr. Leo Kanner, started work in this area at roughly the same time— the 1930s. But they were very different human beings and, while their notions of the condition they first described overlapped to some extent, there are significant differences that still need exploring—and allegations of plagiarism and Nazi allegiances which also require examination. The Scottish child psychiatrist, Dr. Fred Stone, was one of the few people who met both Asperger and Kanner. Stone told me: “There couldn’t be a bigger contrast between the two men. I met Kanner in Edinburgh in the mid-1950s. He was very spruce, carefully dressed, cautious but pleasant. I liked him.”1 Stone met Hans Asperger at a conference in Vienna in the 1960s. “He was on duty ‘welcoming’ people—actually, he didn’t welcome anybody, he justCOPYRIGHTED sat there at the door of the MATERIALlecture theater. I had just heard about his syndrome from the German-speaking members of my planning committee. I could not engage him. I think that those who claim that he may have been suffering from the syndrome that would later bear his name could be right.”2 Most people who met Kanner reported on his warmth and charm. -

A History of Autism
Change V -X ie F w e D r P w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Change V -X ie F w e D r P w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Praise for A History of Autism “No one has attempted to write the history of autism so comprehen- sively before. Adam Feinstein’s highly readable but remarkably thorough book contains a treasure-trove of conversations with the scientists, clin- icians, lobbyists, and parents who have shaped the development of autism in both research and policy. The timing of this book is opportune, as the pioneer generation becomes ‘emeritus.’ History-telling is never wholly objective, but Feinstein (the science-writer, parent, and international con- ference organizer) is better placed than almost anyone to document the extraordinary changes that have happened to the autism community world- wide since the 1940s onwards. This book is an important contribution to the history of medicine and a unique resource for future generations who will build on their predecessors.” Simon Baron-Cohen, Director, Autism Research Centre, Cambridge University “The material in A History of Autism is selected and worded with such enthusiasm, such personal engagement, that it is contagious. I couldn’t stop reading. This book is a monument; a milestone that we all owe to autism’s history.” Theo Peeters, Centre for Training in Autism, Belgium “From the many years before Kanner’s 1943 description when the condition was known by other names, through all that has happened to the present time, along with a glimpse of the future, Feinstein explores the evolutionary journey of autism in an enlightened, educational, and entertaining fashion. -
Kanner, Asperger, and Frankl
AUT0010.1177/1362361316654283AutismRobison 654283research-article2016 Original Article Autism 1 –10 Kanner, Asperger, and Frankl: A third © The Author(s) 2016 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav man at the genesis of the autism diagnosis DOI: 10.1177/1362361316654283 aut.sagepub.com John E Robison Abstract Scholars have long speculated about how Kanner and Asperger’s descriptions of autistic behavior appeared just 1 year apart in America and Austria even as World War II had severed communication between the two countries. Both conspiracy and serendipity have been alleged, but a simpler explanation has now emerged. Autistic knowledge crossed the Atlantic with Georg Frankl—a previously unrecognized “man in the middle” who followed his fiancé to America. The evidence presented here fills in many blanks and suggests both Kanner and Asperger benefited from Frankl’s insight. He was a guiding force for both men: unseen until now because he left very little in the way of published papers. To the end of their lives, Kanner and Asperger described their conditions as separate and distinct. Today, they are both part of the Autism Spectrum in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). This article explains how and why Kanner and Asperger saw their descriptions as different. It makes the case that Georg Frankl helped both men see autism as we know it today and first saw the breadth of that continuum. Keywords Asperger, autism spectrum disorders, diagnosis, Frankl, Kanner, psychological theories of autism The recent publication of two popular books—Silberman’s of Affective Contact” in the American journal Nervous NeuroTribes (2015) and Donvan and Zucker’s (2016) In a Child. -

Heilpädagogik an Der Medizinischen Fakultät Der Universität Wien. Ihre Geschichte Von 1911-1985
Brezinka, Wolfgang Heilpädagogik an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Ihre Geschichte von 1911-1985 Zeitschrift für Pädagogik 43 (1997) 3, S. 395-420 Empfohlene Zitierung/ Suggested Citation: Brezinka, Wolfgang: Heilpädagogik an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Ihre Geschichte von 1911-1985 - In: Zeitschrift für Pädagogik 43 (1997) 3, S. 395-420 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-69889 in Kooperation mit / in cooperation with: http://www.juventa.de Nutzungsbedingungen Terms of use Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist using this document. ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem of this document does not include any transfer of property rights and it is Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: Auf conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und retain all copyright information and other information regarding legal sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich distribute or otherwise use the document in public. ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die By using this particular document, you accept the above-stated conditions of Nutzungsbedingungen an. -
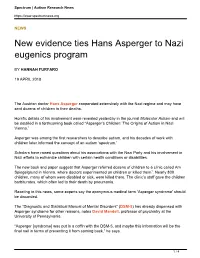
New Evidence Ties Hans Asperger to Nazi Eugenics Program
Spectrum | Autism Research News https://www.spectrumnews.org NEWS New evidence ties Hans Asperger to Nazi eugenics program BY HANNAH FURFARO 19 APRIL 2018 The Austrian doctor Hans Asperger cooperated extensively with the Nazi regime and may have sent dozens of children to their deaths. Horrific details of his involvement were revealed yesterday in the journal Molecular Autism and will be detailed in a forthcoming book called “Asperger’s Children: The Origins of Autism in Nazi Vienna.” Asperger was among the first researchers to describe autism, and his decades of work with children later informed the concept of an autism ‘spectrum.’ Scholars have raised questions about his associations with the Nazi Party and his involvement in Nazi efforts to euthanize children with certain health conditions or disabilities. The new book and paper suggest that Asperger referred dozens of children to a clinic called Am Spiegelgrund in Vienna, where doctors experimented on children or killed them1. Nearly 800 children, many of whom were disabled or sick, were killed there. The clinic’s staff gave the children barbiturates, which often led to their death by pneumonia. Reacting to this news, some experts say the eponymous medical term 'Asperger syndrome' should be discarded. The “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5) has already dispensed with Asperger syndrome for other reasons, notes David Mandell, professor of psychiatry at the University of Pennsylvania. “Asperger [syndrome] was put in a coffin with the DSM-5, and maybe this information will be the final nail in terms of preventing it from coming back,” he says. -

Anschluss 1938: Aftermath on Medicine and Society 1 3 History of Medicine
wiener klinische wochenschrift The Central European Journal of Medicine 130. Jahrgang 2018, Supplement 5 Wien Klin Wochenschr (2018) 130:S279–S341 https://doi.org/10.1007/s00508-018-1366-4 © The Author(s) 2018 “Anschluss” March 1938: Aftermath on Medicine and Society International Conference of the University of Vienna and the Medical University of Vienna, held in Vienna on 12th and 13th March 2018 Guest editors: Wolfgang Schütz, Linda Erker, Oliver Rathkolb and Harald H. Sitte With contributions from: Wolfgang Schütz, Oliver Rathkolb, Sybille Steinbacher, Carmen Birkle, Klaus Taschwer, Ilse Reiter-Zatloukal, Paul Weindling, Margit Reiter, Hemma Mayrhofer, Birgit Nemec, Georg Psota, Susanne Schuett, Michael Freissmuth, Herwig Czech, Markus Müller, Marianne Enigl, Franz Vranitzky, Gudrun Harrer, and Harald H. Sitte Correspondence: Wolfgang Schütz Cover Picture: “Günter Brus // Selbstbemalung II // 1964”, courtesy of the artist history of medicine Table of Contents Editorial: “Anschluss” 1938 – what do we still feel? S281 Wolfgang Schütz1 1. Fortified Democracy 1938/2018 S282 Oliver Rathkolb: The Neglected Factors Leading to the “Anschluss” 1938 S285 Sybille Steinbacher: Nazi German Policies of Expansion and the Response of Europe’s Great Powers S291 Marianne Enigl, Gudrun Harrer, Wolfgang Schütz, Franz Vranitzky: Panel Disussion 2. Expulsion of Excellent Scientists and Doctors S295 Carmen Birkle: Vienna as Medical Contact Zone: American Doctors in the Austrian Capital in the Late 1930s S300 Klaus Taschwer: The Medical Faculty of the -

Correction To: Hans Asperger, National Socialism, and “Race Hygiene” in Nazi‑Era Vienna Herwig Czech*
Czech Molecular Autism (2021) 12:45 https://doi.org/10.1186/s13229-021-00433-x CORRECTION Open Access Correction to: Hans Asperger, National Socialism, and “race hygiene” in Nazi-era Vienna Herwig Czech* Correction to: Molecular Autism (2018) 9:29 From Herta’s religious denomination gottgläubig (the- https:// doi. org/ 10. 1186/ s13229- 018- 0208-6 istic), it can be inferred that the family had left the Catho- Following publication of the original article [1], the lic Church under the infuence of the Nazis’ opposition author notifed about some errors in the article text, foot- to organized religion, a practice that was usually followed notes and references. Te corrected parts should be as only by a radical minority of Nazi sympathizers ([82]: follows: 281–3). Anny Wödl, a Viennese nurse, had no doubt that the Founded in 1921, the Austria-based Bund was a split-of transfer of her son Alfred to Spiegelgrund, enforced in from the Christian-German Student Union (CDSB) but early 1941 despite her resolute resistance, would mean stressed its afnities with the German Youth Movement his death ([87]: 298). as represented by the “Meißner formula,” which Asperger In November 1941, the authorities in Niederdonau 21 cited in 1974 as a guiding principle in his life [3]. (the province surrounding Vienna) noticed that patients Asperger’s political socialization in Neuland likely in the children’s ward at the Gugging psychiatric hospi- blinded him to National Socialism’s destructive character tal were not attending school, despite not having been due to an afnity with core ideological elements (see [36]: excused.106.