Schriften Des Historischen Kollegs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Making Autocrats Accountable: Interests, Priorities, and Cooperation for Regime Change
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 Making Autocrats Accountable: Interests, Priorities, and Cooperation for Regime Change Başak Taraktaş University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Political Science Commons Recommended Citation Taraktaş, Başak, "Making Autocrats Accountable: Interests, Priorities, and Cooperation for Regime Change" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2050. https://repository.upenn.edu/edissertations/2050 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/2050 For more information, please contact [email protected]. Making Autocrats Accountable: Interests, Priorities, and Cooperation for Regime Change Abstract In nearly all authoritarian regimes, democratization finds significant societal support and a number of organized opposition groups struggle for regime change. In some cases—such as in Iran in 1979— opposition groups are able to cooperate with one another and bring down authoritarianism. In others—such as the Assad regime in Syria—groups are not able to cooperate, and the ruler remains in place. Studies that apply cooperation theory on regimes predict that shared grievances about the current government and common interests in changing the existing regime foster cooperation among challengers. Yet, evidence suggests the contrary. This study examines the conditions under which diverse challengers, despite persistent divergence in their ideological preferences, are able to achieve a level of long-term cooperation that can transform the status quo. It uses the case studies of the Ottoman transition to constitutional monarchy (1876–1908) and the French transition to constitutional monarchy (1814–1830), paired according to the least similar systems design, in combination with network theory. -

Vassy Jalenques Sarl / Banque Nuger Rib : 13489 02791 14294900200 42 / Iban : Fr76 1348 9027 9114 2949 0020 042 / Bic : Bnugfr21
VASSY ■ JALENQUES Commissaires-Priseurs habilités Bibliothèque de Barante 2e vente CLERMONT-FERRAND Mardi 23, Mercredi 24 et Jeudi 25 Mars 2021 VASSY ■ JALENQUES Commissaires-Priseurs habilités Mardi 23, Mercredi 24 et Jeudi 25 MARS 2021 Hôtel des ventes de Clermont-Ferrand - 19 rue des Salins BIBLIOTHÈQUE DE BARANTE Experts spécialisés Gérard OBERLÉ & Tristan PIMPANEAU Manoir de Pron - 58340 Montigny-sur-Canne +33 (0)3 86 50 05 22 - [email protected] membres de la Compagnie Nationale des Experts VACATIONS Mardi 23 mars à 14h00 : lots 1 à 516 Mercredi 24 mars à 14h00 : lots 517 à 959 Jeudi 25 mars à 14h00 : lots 960 à 1313 EXPOSITIONS PUBLIQUES à l’Hôtel des Ventes de Clermont-Fd Vendredi 19 mars de 9h à 12h et 14h à 17h (commune aux 3 ventes) Lundi 22 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h (commune aux 3 ventes) Mardi 23 mars de 9h à 12h (uniquement pour la vente du mardi) Mercredi 24 mars de 9h à 12h (uniquement pour la vente du mercredi) Jeudi 25 mars de 9h à 12h (uniquement pour la vente du jeudi) ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES Absentee bids and telephone bids Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères téléphoniques pour les œuvres de cette vente. We will be delighted to organise telephone bidding Tél. +33 (0)4 73 93 24 24 - Fax +33 (0)4 73 35 54 34 - Email : [email protected] Frais de vente : 26,40 % TTC Consultez nos catalogues et laissez des ordres d’achat sur www.interencheres.com/63002 IMPORTANT La vente est soumise aux conditions imprimées en fin de catalogue. -

De Doctrinairen
De Doctrinairen: Een onderzoek naar politieke samenwerking in de eerste helft van de Franse negentiende eeuw Door: Niels Janssens Studentnummer: S4189086 Herkansing masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit Begeleid door: J. Rosendaal Inleverdatum: 12-06-2018 1 Inhoudsopgave: Inleiding ..................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Oprichting van de Doctrinairen en politieke activiteit in het begin van de Restauratie .............................................................................................................................. 10 Hoofdstuk 2: Complottheorieën en versplintering in de latere jaren van de Restauratie .................................................................................................................................................. 19 Hoofdstuk 3: Terugkeer in de politiek en de ‘nieuwe’ Doctrinairen .................................. 28 Conclusie ................................................................................................................................. 38 Literatuurlijst ......................................................................................................................... 40 2 Inleiding ‘Als we met een politieke partij niet een politieke organisatie, maar een systeem van gemeenschappelijke ideeën, discipline en een tactiek bedoelen, dan is het te veel om te zeggen dat deze term op de Doctrinairen toegepast kan worden.’1 In de jaren ’20 werd in zijn boek -

Jahresbericht 2010/2011 Herausgegeben Vom
1. SEPTEMBER 2010 – 31. AUGUST 2011 2011 AUGUST 31. – 2010 SEPTEMBER 1. JAHRESBERICHT JAHRESBERICHT DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT PARIS JAHRESBERICHT HÔTEL DURET-DE-CHEVRY 8, RUE DU PARC-ROYAL FR-75003 PARIS 1. SEPTEMBER 2010 – 31. AUGUST 2011 TEL. +33 (0)1 44 54 23 80 FAX +33 (0)1 42 71 56 43 WWW.DHI-PARIS.FR DAS DEUTSCHE HISTORISCHE INSTITUT PARIS IM JAHR 2010 / 2011 JAHRESBERICHT 1. SEPTEMBER 2010 – 31. AUGUST 2011 Impressum Jahresbericht 2010/2011 herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris Institut historique allemand Hôtel Duret-de-Chevry 8, rue du Parc-Royal 75003 Paris Telefon +33 (0)1 44 54 23 80 Fax +33 (0)1 42 71 56 43 E-Mail [email protected] www.dhi-paris.fr Koordination Dunja Houelleu Dr. Stefan Martens Redaktion Veronika Vollmer Manuskriptbearbeitung Dagmar Aßmann Karin Förtsch Gestaltung und Realisierung Kupferschläger Grafikdesign, Aachen Bildnachweis Alle Bilder DHIP, außer S. 7: lichtographie.de S. 51: Christian Kielmann Inhalt FORSCHUNG FÖRDERUNG UND FELLOWSHIPS Forschungsstrategie 2010/2011 ......................................................................... 9 Karl-Ferdinand-Werner-Fellowship ..................................................................... 71 Abgeschlossene Projekte ................................................................................... 12 Herbstkurs 2010 ................................................................................................. 71 Mittelalter ......................................................................................................... -

SARAH HOROWITZ FRIENDSHIP and POLITICS
FRIENDSHIP and POLITICS IN POST-REVOLUTIONARY FRANCE SARAH HOROWITZ FRIENDSHIP and POLITICS in POST- REVOLUTIONARY FRANCE FRIENDSHIP and POLITICS in POST- REVOLUTIONARY FRANCE SARAH HOROWITZ The Pennsylvania State University Press University Park, Pennsylvania Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Horowitz, Sarah, 1978– author. Friendship and politics in post-revolutionary France / Sarah Horowitz. p. cm Summary: “Explores the place of friendship in helping French society and the political system recover from the upheaval of the Revolution. Examines the interdependence of public and private in post-revolutionary France, as well as the central role of women in political reconstruction”—Provided by publisher. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-271-06192-4 (cloth : alk. paper) 1. Friendship—Political aspects—France—History—19th century. 2. France—Politics and government—19th century. 3. Political culture—France—History—19th century. 4. Politicians—France—Social life and customs—19th century. 5. Politicians—Social networks—France—History—19th century. 6. Women—Political activity—France—History—19th century. I. Title. dc252.h67 2013 306.20944'09034—dc23 2013027155 Copyright © 2013 The Pennsylvania State University All rights reserved Printed in the United States of America Published by The Pennsylvania State University Press, University Park, PA 16802-1003 The Pennsylvania State University Press is a member of the Association of American University Presses. It is the policy of The Pennsylvania State University Press to use acid- free paper. Publications on uncoated stock satisfy the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Material, ansi z39.48–1992. This book is printed on paper that contains 30% post-consumer waste. -
Étude Sur M. Le Comte De Serre
ETUDE SUR M. LE COMTE DE SERRE l'AR M. SALMON MEMBnE DE L'ACADEMIE IMPERIALE DE METZ PARIS LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie Boulevard Saint-Germain , n° 77 METZ NANCY LIBRAIRIE DE M. ALCAN LIBRAIRIE DE NICOLAS GROSJEAN Rae de la Cathédnle, n• l Place Stanislas, n• 7 -186-i- D'une simple notice, entreprise pour honorer, au sein d'une Académie , la mémoire d'un de ces amis des lettres dont ses membres actuels son, les successeurs, l'auteur de cette Étude ne saurait avoir la pré ,ention de faire un livre : en la publiant, il n'a d'autre but que de conserver , pour les historiens qui écriront la vie de M. de Serre, quelques sou venirs qui ne pouvaient être recueillis que dans les lieux où elle a commencéf, et où s'en est écoulée la partie la moins éclatante : aussi croit-il devoir laisser à cet essai la forme de l'allocution , qui en marque l'origine et qui lui servira d'excuse. C'est aux maîtres de l'art qu'il apputient de rendre les traits d'une pareille figure, et de garantir la renommée de l'homme, en inscrivant· leur nom sur le socle de sa statue. SOMMAIRE. Introduction, page 1. - Naissance de M. de Serre, p. 3. - Son édu . cation, p. 4. -Il entre à !'École d'artillerie de Metz, p. 5.-Il émigre, p. 5. -Ses distractions à la guerre, p. 6. -Il se livre exclusivement à l'étude, p. 7.-Il fait, en secret, un voyage dans sa famille et y reste, p.12. -

SELINGER-DISSERTATION-2015.Pdf
Philosophers in Parliament: The Crises of Eighteenth-Century Constitutionalism and the Nineteenth- Century Liberal Parliamentary Tradition The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Selinger, William. 2015. Philosophers in Parliament: The Crises of Eighteenth-Century Constitutionalism and the Nineteenth-Century Liberal Parliamentary Tradition. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:23845479 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Philosophers in Parliament: The Crises of Eighteenth-Century Constitutionalism and the Nineteenth-Century Liberal Parliamentary Tradition A dissertation presented by William Selinger to The Department of Government in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Political Science Harvard University Cambridge, Massachusetts September 2015 © 2015 - William Selinger All Rights Reserved. Dissertation Advisor: Professor Richard Tuck William Selinger Philosophers in Parliament: The Crises of Eighteenth-Century Constitutionalism and the Nineteenth-Century Liberal Parliamentary Tradition Abstract A crucial commitment of nineteenth-century French and English liberalism was to parliamentary government. Liberal authors including Benjamin Constant, John Stuart Mill, Francois Guizot, and Walter Bagehot all specifically advocated constitutional structures in which cabinet officials sat as legislative representatives, and required the “confidence” of the legislature to remain in office. This dissertation offers a historical account of how liberal political thinkers came to favor parliamentary government. -

Really Final Diss
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Marianne is Watching: Knowledge, Secrecy, Intelligence and the Origins of the French Surveillance State (1870–1914) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Deborah Susan Bauer 2013 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Marianne is Watching: Knowledge, Secrecy, Intelligence and the Origins of the French Surveillance State (1870–1914) by Deborah Susan Bauer Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2013 Professor Caroline Cole Ford, Chair “Marianne is Watching” presents a history of the institutionalization of professional intelligence and counterintelligence services in France from 1870 to 1914. As the practice of secret politics, once exclusive to the domain of royal authority, gave way to calls for greater transparency in the nineteenth century, the acceptable exercise of state secrecy shifted from leadership to professional surveillance teams. This process, which notably took place during a period of peace, not war, highlights the enduring tension between surveillance, secrecy and national defense within an ostensibly open, democratic society. Interrogating these concerns in the French case, the Third Republic appears as a regime that ultimately valued security over transparency and other freedoms. Led by the army’s administration, with contributions from services within the police and the Ministry of Foreign Affairs, espionage and counterespionage teams became an integral part ! ""! of the French state. They carved out important roles in determining France’s international policy, in policing domestic populations, and in regulating speech and expression. What began as a reconnaissance service to achieve military parity with enemies like Germany thus grew to be a professional domestic surveillance apparatus with considerable autonomy in identifying threats to the nation. -

Livres & Manuscrits
LIVRES & MANUSCRITS Jeudi 20 février 2020 Drouot Paris 1 CONTACTS POUR CETTE VENTE Directrice du département Administration des ventes Stockage et délivrance Sophie Perrine + 33 (0)1 41 92 06 44 Julie Sallé [email protected] [email protected] Enchères par téléphone Relations Presse Ordre d’achat Sébastien Fernandes [email protected] + 33 (0)1 47 45 93 05 [email protected] Relations acheteurs +33 (0)4 37 24 24 22 [email protected] Experts Manuscrits anciens, chartes Manuscrits & autographes & incunables, Moyen-Âge Thierry Bodin, membre du Syndicat & Renaissance français des Experts Professionnels Ariane Adeline en œuvres d’art + 33 (0)6 42 10 90 17 + 33 (0)1 45 48 25 31 [email protected] [email protected] Signalé par les initiales AA Signalé par les initiales TB Livres anciens & modernes Affiches & Papiers de collection Dominique Courvoisier Mario Mordente Expert de la Bibliothèque nationale +33 (0)1 43 36 36 98 de France et Membre du Syndicat [email protected] français des Experts Professionnels Signalé par les initiales MM en œuvres d’art + 33 (0)1 42 68 11 29 [email protected] Assisté d’Alexandre Maillard Signalé par les initiales DC Président Claude Aguttes Commissaires-priseurs habilités Associés Directeurs associés Claude Aguttes, Sophie Perrine Hugues de Chabannes, Philippine Dupré la Tour SCP Claude Aguttes Charlotte Reynier-Aguttes Commissaire-priseur suppléant Sophie Perrine Associés Valérianne Pace, Sophie Perrine Gautier Rossignol SAS CLAUDE AGUTTES (SVV 2002-209) 2 LIVRES ANCIENS ILLUSTRÉS -
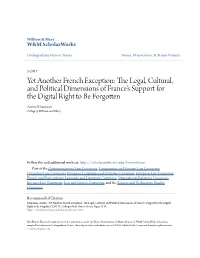
Yet Another French Exception
William & Mary W&M ScholarWorks Undergraduate Honors Theses Theses, Dissertations, & Master Projects 5-2017 Yet Another French Exception: The Legal, Cultural, and Political Dimensions of France’s Support for the Digital Right to Be Forgotten Zarine Kharazian College of William and Mary Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/honorstheses Part of the Communications Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Computer Law Commons, European Languages and Societies Commons, European Law Commons, French and Francophone Language and Literature Commons, International Relations Commons, Internet Law Commons, Law and Society Commons, and the Science and Technology Studies Commons Recommended Citation Kharazian, Zarine, "Yet Another French Exception: The Legal, Cultural, and Political Dimensions of France’s Support for the Digital Right to Be Forgotten" (2017). Undergraduate Honors Theses. Paper 1110. https://scholarworks.wm.edu/honorstheses/1110 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Undergraduate Honors Theses by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. ACKNOWLEDGEMENTS First, thank you to my thesis advisors, Professor Maryse Fauvel and Professor Michael Leruth, for supporting and challenging me. Thanks also to Professor Jaime Settle for lending a social scientist’s perspective, and to Professor Giulia Pacini for lending a cultural historian’s perspective. Second, thank you to the donors of the McCormack-Reboussin Scholarship in French & Francophone Studies for generously funding this research. Third, thank you to my parents, Armen and Christine Kharazian, for their unwavering kindness and intellectual curiosity, as well as for their unconditional love. -

Napoleonic Governance in the Netherlands and Northwest Germany Conquest, Incorporation, and Integration Martijn Van Der Burg War, Culture and Society, 1750–1850
WAR, CULTURE AND SOCIETY, 1750–1850 Napoleonic Governance in the Netherlands and Northwest Germany Conquest, Incorporation, and Integration Martijn van der Burg War, Culture and Society, 1750–1850 Series Editors Rafe Blaufarb Florida State University Tallahassee, FL, USA Alan Forrest University of York York, UK Karen Hagemann University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC, USA The series aims to the analysis of the military and war by combining politi- cal, social, cultural, art and gender history with military history. It wants to extend the scope of traditional histories of the period by discussing war and revolution across the Atlantic as well as within Europe, thereby con- tributing to a new global history of confict in the eighteenth and nine- teenth century. For more information see: wscseries.web.unc.edu More information about this series at http://www.palgrave.com/gp/series/14390 Martijn van der Burg Napoleonic Governance in the Netherlands and Northwest Germany Conquest, Incorporation, and Integration Martijn van der Burg Open University of the Netherlands Heerlen, The Netherlands ISSN 2634-6699 ISSN 2634-6702 (electronic) War, Culture and Society, 1750 –1850 ISBN 978-3-030-66657-6 ISBN 978-3-030-66658-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-66658-3 © The Author(s) 2021. This book is an open access publication. Open Access This book is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence and indicate if changes were made. -

Modèle Word Thèse Et Mémoire
Université de Montréal Luttes politiques et références contradictoires à la Révolution durant la Restauration en France, 1814-1820 par Zakaria Ennemiri Département d’histoire Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître ès Arts (M.A.) en Histoire Décembre 2017 © Zakaria Ennemiri, 2017 Résumé En 1814, une issue que personne ne pouvait prévoir ramena une dynastie balayée par les vents de l’histoire vingt-cinq années auparavant. En rentrant en France, Louis XVIII restitue leurs titres à l’ancienne noblesse d’Ancien Régime, mais « octroie » une Charte qui se voulait la garante des principes libéraux héritées de la Révolution. La « Restauration », nom donné à la réinstallation sur le trône de France de l’ancienne dynastie des Bourbons, posait pourtant de nombreuses questions. Qu’adviendrait-il de cette France nouvelle qui avait émergé avec la Révolution depuis 1789. Entre 1814 et 1820, période au cours de laquelle un programme politique libéral fut établi, les royalistes invoquèrent la Révolution et les menaces qu’elle faisait peser sur la monarchie pour le combattre. Les libéraux, pour leur part, voyaient dans leurs adversaires royalistes une vieille noblesse aigrie revenus d’un passé lointain et qui cachait mal son désir secret d’abolir la Charte et de réclamer ses anciens droits? Il sera question dans ce mémoire de la fracture qui existait entre deux élites en concurrence pour la prédominance politique et sociale. À la lumière des débats de l’époque, nous verrons comment royalistes et libéraux, les deux grands groupes politiques de la période, articulaient leur discours.