Aktueller Begriff
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Internationale Organisationen Bundesrepublik Deutschland
Internationale Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland Hinweis: Die Eintragungen wurden nach Angaben der jeweiligen Organisation gemacht. Änderungen sind daher nicht auszuschließen. Stand: Januar 2021 VEREINTE NATIONEN INTERNATIONALE FINANZ-CORPORATION DIE WELTBANKGRUPPE (IFC) - BÜRO IN DEUTSCHLAND International Finance Corporation - The World Bank Group (IFC) German Office Adresse: Bockenheimer Landstraße 43 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 743 482 40 Fax: (069) 743 482 45 E-Mail: [email protected] Internet: www.ifc.org Direktor Joannes van Bilsen Leiter INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION (ILO), VERTRETUNG IN DEUTSCHLAND International Labour Organization, Office in Germany (ILO) Adresse: Karlplatz 7 10117 Berlin Telefon: (030) 280 926 68, -69 Fax: (030) 280 464 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.ilo.org/berlin Frau Dr. Annette NIEDERFRANKE Leiterin SEKRETARIAT DES INTERNATIONALEN BERATUNGSGREMIUMS ZUR BIOLOGISCHEN VIELFALT (IPBES) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Adresse: UN Campus, Langer Eugen Platz der Vereinten Nationen 1 53113 Bonn Telefon: (0228) 815 05 70 Fax: (0228) 815 24 49 E-Mail: [email protected] Internet: www.ipbes.int Frau Dr. Anne LARIGAUDERIE Exekutivsekretärin Herr Paul LEADLEY - 2 - INTERNATIONALER SEEGERICHTSHOF (ISGH) International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) Adresse: Am Internationalen Seegerichtshof 1 22609 Hamburg Telefon: (040) 356 070 Fax: (040) 356 072 45 E-mail: [email protected] Internet: www.itlos.org Herr Albert J. -

Skills for Work and Life: Post 2015 14 - 16 October 2014, Bonn, Germany Organized By
1 Report on UNESCO-UNEVOC global forum on “Skills for work and life: post-2015” Global Forum Report Global Forum on Skills for work and life: post 2015 14 - 16 October 2014, Bonn, Germany Organized by UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training Supported by The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), in collaboration with the German Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the German National Commission for UNESCO For further information please contact: UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1 53113 Bonn, Germany Phone: +49 228 815 0100 Fax: +49 228 815 0199 [email protected] | www.unevoc.unesco.org Follow us on: facebook.com/unevoc | youtube.com/unevoc | twitter.com/unevoc Unless stated otherwise, all photos are copyright of UNESCO-UNEVOC Graphics and layout by Aldrich Mejia, Multimedia Developer and IT Support, UNESCO-UNEVOC All rights reserved © UNESCO 2015 Online: ISBN 978-92-95071-76-6 Print: ISBN 978-92-95071-75-9 Contents Acronyms and abbreviations 4 Preface 5 Executive summary 6 1. Context of the Forum 9 2. Participation, aims and issues addressed 10 2.1 Aims of the Forum 10 2.2 Issues addressed 10 2.3 Partners 12 3. Report and discussion 13 3.1 Key messages from the opening and closing sessions 13 3.2 Keynote: Progress on skills development in South Africa 18 3.3 Agency perspectives 20 3.4 UNEVOC Network perspectives 25 3.5 Promising Practices 31 4. -

Bericht Der Beauftragten Der Bundesregierung Für Den Berlin
Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich zum Sachstand der Umsetzung des Gesetzes zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands vom 26. April 1994 (Berlin/Bonn-Gesetz) – Statusbericht – Impressum Stand: Februar 2017 Hinweis: Dies ist eine Online-Publikation des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Der Vervielfältigung oder Weiterverwendung für andere Zwecke muss der Herausgeber zustimmen. Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich E-Mail: [email protected] Internet: www.bmub.bund.de Text: Stefan Süsterhenn, BMUB Alexander Becher, BMUB II Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ........................................................................................................... 1 1.1 Auftrag des Arbeitsstabes Berlin/Bonn .................................................... 1 1.2 Bisherige Berichte zur Thematik „Berlin/Bonn“ ........................................ 2 1.2.1 Teilungskostenberichte der Bundesregierung ......................................... 2 1.2.2 Weitere Berichte ...................................................................................... 2 1.3 Methodische Herangehensweise und Quellen ........................................ 3 2 Ausgangslage ................................................................................................... -

Rückkehr Ins Bonner Bundesviertel
208 BRJ 02/2014 Lakenberg, Rückkehr ins Bonner Bundesviertel Rückkehr ins Bonner Bundesviertel Rechtsanwalt Dr. Thomas Lakenberg, M.Jur. (Oxon), Bonn* Fährt man von Nordwesten kommend über die Reuterbrü- auch etwas über das Selbstverständnis jener Länder und cke in Richtung Bundeskanzlerplatz, schaut man auf drei den Zustand der jeweiligen Gesellschaft.3 Die „Grande Na- hoch in den Himmel ragende Gebäude: Den Hotelturm tion“ Frankreich hat sich nach dem Übergang von der Mo- des World Conference Center Bonn (WCCB), entworfen narchie zur Demokratie in den alten königlichen Palästen von Ruth Berktold und Marion Wicher, das Hochhaus von eingerichtet, sei es im Elysée-Palast (Staatspräsident), dem Egon Eiermann, das alle nur „Langer Eugen“ nennen, und Hôtel Bourbon (Nationalversammlung) oder dem Palais du schließlich den Post Tower von Helmut Jahn, an dessen Luxembourg (Senat). In England übernahmen Unter- und Fassade je nach Anlass und Jahreszeit der WM-Pokal oder Oberhaus schon früh selbstbewusst den Palast von West- ein Weihnachtsbaum als Lichtinstallation die Nacht er- minster, den die meisten seitdem nur noch als „Houses of leuchtet. Alle drei Gebäude stehen für tiefe Einschnitte in Parliament“ kennen. In den USA baute man vor zweihun- der (Bau-)Geschichte jenes Viertels, von dem aus fünfzig dert Jahren eine ganze Stadt von vornherein als Hauptstadt Jahre lang, von 1949 bis 1999, zunächst nur der Westen mit dem Kapitol und dem Weißen Haus als repräsentativen Deutschlands, dann das ganze Land regiert wurde: das Staatsbauten, denen der Staatsapparat bis heute treu geblie- Bonner Regierungs- oder Bundesviertel. ben ist. Fast, so scheint es, wird die Hauptstadt zum zusätz- lichen Staatssymbol, das neben Hymne, Fahne und Wappen Bis heute wird die Gegend am Rhein zwischen Südstadt, tritt, das Land und seine Staatsform repräsentiert und dem Rheinaue und der B9 so genannt, in der Bundespräsident Besucher eindrucksvoll das gar nicht geringe staatliche und Bundeskanzler sowie Bundestag und Bundesrat ihren Selbstbewusstsein demonstriert. -

Francia – Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte
Francia – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte Bd. 34/3 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. f34/3 13 Rezensionen_Anzeigen 18.04.2008 14:07 Uhr Seite 380 380 Rezensionen Unis et l’Angleterre ne résulte pas seulement d’une anglophilie, que justifierait en grande partie le souci de se ranger désormais aux côtés des »vainqueurs véritables« (p. 50). De notre point de vue, Steinkühler n’a pas assez pris en considération l’impact de la politique fran- çaise sur les positionnements et les décisions de Bonn, de même que, dans les années qui pavent le chemin vers le traité, la politique européenne du général de Gaulle n’est pas éva- luée à sa juste mesure. Ainsi la question du projet d’union politique de l’Europe et l’échec des »plans Fouchet«, en 1961/62, est mentionnée »en passant« et inexactement: il n’est pas sûr que de Gaulle ait voulu respecter les étapes déjà réalisées en matière d’intégration euro- péenne (p. 19) quand on sait qu’il tenta de réintégrer l’économie dans le domaine de la coopération intergouvernementale (plan Fouchet II). -
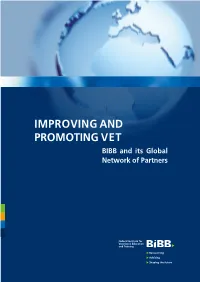
Improving and Promoting
IMPROVING AND PROMOTING VET BIBB and its Global Network of Partners Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data available in the internet at http//dnb.ddb.de. ISBN 978-3-88555-944-3 Order address Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB Federal Institute for Vocational Education and Training PO Box 201264 53142 Bonn E-Mail: [email protected] Fax: (+ 49-228) 107 2967 Order code: 09.203 © 2013 by BIBB (Federal Institute for Vocational Education and Training) Publisher: Bundesinstitut für Berufsbildung, 53142 Bonn Internet: www.bibb.de E-Mail: [email protected] Author: Hans J. Kissling Responsible for contents: Section 1.2 “International Co-operation and Advisory Services” Cover: Christiane Zay, Potsdam Typesetting: Christiane Zay, Potsdam Printing: W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld Printed in Germany ISBN 978-3-88555-944-3 IMPROVING AND PROMOTING VET BIBB and its Global Network of Partners Table of contents Preface ..................................................................................................................................................... 6 Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser President of the Federal Institute for Vocational Education and Training Partner Presentations Germany BIBB ........................................................................................................................................... 8 Australia NCVER ...................................................................................................................................... -

Transforming TVET
Transforming TVET- from idea to action One decade of UNESCO-UNEVOC Published by 14 Background and history UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training 25 UNEVOC: aims 26 Improving access to TVET UN Campus 30 Enhancing quality… Hermann-Ehlers-Str. 10 32 … and relevance 53113 Bonn Germany 35 UNEVOC: actions Tel: +49 (0) 228 815 01 00 36 Strengthening the UNEVOC Network Fax: +49 (0) 228 815 01 99 44 Knowledge sharing and online services www.unevoc.unesco.org 48 Promoting research and publications [email protected] 50 Enhancing capacity development Coordinator 55 UNEVOC: regions Alix Wurdak 56 Africa 60 Arab States Editor 64 Asia and the Pacific John Fox 68 Europe and North America 72 Latin America and the Caribbean Editorial assistance Yasmine Simillion, Artem Kovryzhenko 77 UNEVOC: themes Contents 78 TVET for sustainable development Design 82 TVET teacher education and training Christiane Marwecki 86 Youth unemployment www.cmgrafix.com 90 ICT in TVET 94 TVET in emergency situations Printing 98 Entrepreneurial learning Druckpartner Moser 102 Gender equality in TVET 106 TVET, HIV and AIDS The designations employed and the presentation 110 Public-private partnerships in TVET of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the 115 Way forward part of UNESCO concerning the legal status of 116 Third TVET Congress any country, city or area, or of its authorities, or 118 Interagency initiatives concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 120 Greetings ISBN 978-92-95071-29-2 (print) 144 UNEVOC staff ISBN 978-92-95071-30-8 (online) 148 References © UNESCO 2012 All rights reserved Annette Schavan, Federal Minister of Education and © BMBF Research contribution to improving technical and vocational education and training in UNESCO Member States. -

Between Nowhere and Everywhere: the Challenges of Placing the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
Between Nowhere and Everywhere: The Challenges of Placing the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Maud Borie Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy to the School of Environmental Sciences, University of East Anglia January 2016 This copy of the thesis has been supplied on conditions that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived from there must be in accordance with current UK copyright law. In addition, any quotation or extract must include full attribution. 1 Abstract Global Environmental Assessments (GEAs) have become influential processes in environmental governance, with the objective to gather policy-relevant knowledge on environmental issues for decision-makers. This thesis offers the first ethnographic account of the nascent Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) which, in contrast to earlier GEAs, aims to implement an inclusive model of expertise. Underlying this move are concerns regarding both the effectiveness of GEAs and their democratization. GEAs have also faced numerous criticisms for being dominated by the global North and for failing to consider the diversity of ways of making sense of global environmental change. Drawing on Science and Technology Studies and on the emerging literature on geographies of science, I view science and policy as being mutually entangled, rather than as two separate domains, and conceptualise GEAs as sites of co-production. It is important therefore to study how categories such as ‘science’, ‘policy’, ‘local’ and ‘global’ are produced and to investigate the practices and places through which knowledge is constructed as policy-relevant. -

The German Bundestag in the Reichstag Building
The German Bundestag in the Reichstag Building The German Bundestag in the Reichstag Building 6 Foreword by the President of the German Bundestag, Wolfgang Schäuble Hans Wilderotter 9 “Here beats the heart of democracy” Structure and function of the Bundestag 10 The ‘forum of the nation’: the Bundestag at the heart of the German Constitution 14 “Representatives of the whole people”: the Members of Parliament 22 “The President shall represent the Bundestag”: the President of the Bundestag, the Presidium and the Council of Elders 32 “Permanent subdivisions of the Bundestag”: the parliamentary groups 40 “Microcosms of the Chamber”: the committees 48 Strategy and scrutiny: study commissions, committees of inquiry, the Parliamentary Oversight Panel and the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces 54 “The visible hub of parliamentary business”: the plenary chamber 62 “Federal laws shall be adopted by the Bundestag”: legislation and legislative processes 76 “Establishing a united Europe”: Bundestag participation in the process of European integration Content Hans Wilderotter 83 The long road to democracy Milestones in Germany’s parliamentary history 84 “... the real school of Vormärz liberalism”: parliaments in Germany before 1848 88 “We will create a constitution for Germany”: the German National Assembly in St Paul’s Church, Frankfurt am Main 106 A “written document as the Constitution of the Prussian Kingdom”: the constituent National Assembly and the Prussian House of Representatives in Berlin 122 Democracy without parliamentarianism: -

Physical Location of the Secretariat United Nations Environment
UNITED NATIONS RC UNEP/FAO/RC/COP.1/INF/6/Add.2 Distr.: General 17 June 2004 United Nations Original: English Environment Programme Food and Agriculture Organization of the United Nations Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade Conference of the Parties First meeting Geneva, 20–24 September 2004 Item 8 (a) of the provisional agenda* Matters stipulated by the Conference of Plenipotentiaries for action by the Conference of the Parties at its first meeting: physical location of the secretariat Physical location of the secretariat Note by the secretariat The secretariat has the honour to submit to the Conference, in the annex to the present note, the document entitled: “UN-Campus in Bonn”, provided by the Government of the Federal Republic of Germany. * UNEP/FAO/RC/COP.1/1. K0471670(E) 290604 For reasons of economy, this document is printed in a limited number. Delegates are kindly requested to bring their copies to meetings and not to request additional copies. Page 2 Document for the presentation meeting UN-Campus Bonn on Thursday, 26 June 2003 Author: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) Federal Ministry for Transportation, Housing and Construction (BMVBW) Page 3 Inhalt A. Lagebeschreibung B. Neues Abgeordnetenhaus "Langer Eugen" 1. Architektur und Denkmalschutz 2. Baubeschreibung 3. Sanierungsziele 4. Termine 5. Eingangshalle 6. Büro / Flure / Foyerzonen 7. Konferenzräume 8. Restaurant / Küche 9. Haustechnik 10. IT-Technik 11. Gebäudesicherheit C. Altes Abgeordnetenhaus, Bundeshaus 1. Architektur und Denkmalschutz 2. Beschreibung der Gebäude 3. Grundrisse, Ansichten und Schnitte 4. -
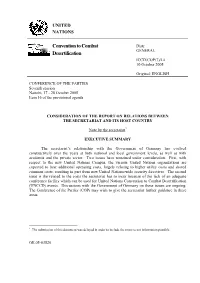
Conventiontocombat Desertification
UNITED NATIONS Convention to Combat Distr. Desertification GENERAL ICCD/COP(7)/14 10 October 2005 Original: ENGLISH CONFERENCE OF THE PARTIES Seventh session Nairobi, 17 - 28 October 2005 Item 16 of the provisional agenda CONSIDERATION OF THE REPORT ON RELATIONS BETWEEN THE SECRETARIAT AND ITS HOST COUNTRY Note by the secretariat* EXECUTIVE SUMMARY The secretariat’s relationship with the Government of Germany has evolved constructively over the years at both national and local government levels, as well as with academia and the private sector. Two issues have remained under consideration. First, with respect to the new United Nations Campus, the various United Nations organizations are expected to bear additional operating costs, largely relating to higher utility costs and shared common costs, resulting in part from new United Nations-wide security directives. The second issue is the related to the costs the secretariat has to incur because of the lack of an adequate conference facility which can be used for United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) events. Discussions with the Government of Germany on these issues are ongoing. The Conference of the Parties (COP) may wish to give the secretariat further guidance in these areas. * The submission of this document was delayed in order to include the most recent information possible. GE.05-63820 ICCD/COP(7)/14 Page 2 CONTENTS Paragraphs Page Introduction ....................................................................................................... 1 – 2 3 I. BACKGROUND OF COOPERATION WITH THE HOST COUNTRY.......................................................................................... 3 – 12 3 A. Consultations with the German authorities.................................. 3 – 9 3 B. Cooperation with the scientific community and the private sector.................................................................. 10 – 12 4 II. -

Jahresbericht0607.Pdf
UNEVOC INTERNATIONAL CENTRE for Technical and Vocational Education and Training UNESCO-UNEVOC in Action Report on Activities 2006-2007 >> Published by UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training UN Campus Hermann-Ehlers-Str. 10 53113 Bonn Germany Tel: [+49] 228 815 0100 Fax: [+49] 228 815 0199 www.unevoc.unesco.org [email protected] This report can be downloaded in PDF format from www.unevoc.unesco.org/publications >> Prepared by Maja Zarini >> Editorial Assistants: Natalia Matveeva, Clothilde Cantegreil and Susanne Taron >> Design: www.pinger-eden.de >> Printed by: www.druckerei-paffenholz.de The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, city or area, or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. © UNESCO 2008 TABLE OF CONTENTS 3 TABLE OF CONTENTS FOREWORD >> 5 INTRODUCTION >> 6 1. THE GLOBAL UNEVOC NETWORKS >> 7 1.1 The UNEVOC Network Today 8 1.2 Strengthening the UNEVOC Network 10 1.3 UNESCO-UNEVOC e-Forum and Spanish-Portuguese Forum 11 1.4 Other UNEVOC Partnerships 12 2. TVET AND EFA >> 13 2.1. Assisting countries to develop quality, accessible TVET systems 13 2.2 Promoting cross-cutting themes 22 3. TVET FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT >> 23 4. PUBLICATIONS AND INFORMATION PROGRAMME >> 30 4.1 Publications 30 4.2 UNESCO-UNEVOC on the Web 33 4.3 Information Services 34 5. INSIDE UNESCO-UNEVOC >> 35