Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Mainz-Bingen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COMMISSION DECISION of 22 August 2006 on Certain Protective Measures Against Bluetongue (Notified Under Document Number C(2006) 3849)
L 229/10EN Official Journal of the European Union 23.8.2006 COMMISSION DECISION of 22 August 2006 on certain protective measures against bluetongue (notified under document number C(2006) 3849) (Text with EEA relevance) (2006/577/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (5) For the sake of clarity and transparency and pending further epidemiological and laboratory investigations, it is appropriate to adopt at Community level disease Having regard to the Treaty establishing the European control measures concerning the movement of animals Community, of species susceptible to bluetongue and their semen, ova and embryos from the affected areas. Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable (6) In the light of the evolution of the situation and the in intra-Community trade in certain live animals and products results of the further investigations carried out, the with a view to the completion of the internal market (1) and in measures in place are to be reviewed at a meeting of particular Article 10(4) thereof, the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at the earliest opportunity. Whereas: (7) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing (1) On 17, 19 and 21 August 2006 respectively, the Neth- Committee on the Food Chain and Animal Health, erlands, Belgium and Germany informed the Commission of a number of suspected clinical cases of bluetongue in sheep and cattle holdings in areas in the Netherlands, Belgium and Germany located in a radius of 50 km HAS ADOPTED THIS DECISION: from Kerkrade, the Netherlands, where the first suspected case was notified. -

Bürgergenossenschaft Rheinhessen Eg – Regenerative Energie Für Die Region
Bürgergenossenschaft Rheinhessen eG – regenerative Energie für die Region Randbedingungen für eine zukünftige Energieversorgung • Primärenergieträger Erdöl, Uran, Erdgas und Kohle endlich, zudem: (zunehmende) Abhängigkeit von Importen nicht wünschenswert • Klimawandel hauptsächlich durch Nutzung fossiler Brennstoffe • Atomkraft ist keine Zukunftslösung (u.a. Sicherheits- und Endlagerfrage) => Die Energiewelt muss grüner und intelligenter werden! 1 Gesellschaftspolitische Randbedingung Rekommunalisierung der Energienetze und energieautarkere Kommunen liegen voll im Trend Energielandschaft Morbach, „Schönauer Stromrebellen“, Bioenergiedorf Jühnde (Niedersachen) und viele andere mehr! Die Lösung: Ausbau der regenerativen Energieerzeugung unter Berücksichtigung örtlicher Möglichkeiten! 2 Die Chance: Ausbau der regenerativen Energieerzeugung unter Berücksichtigung örtlicher Möglichkeiten durch die Bevölkerung vor Ort selbst! Bürgergenossenschaft Rheinhessen eG - regenerative Energie für die Region Die Bürgergenossenschaft Rheinhessen eG Gründung: 19. November 2009 (Datum der Eintragung in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Mainz) Sitz: Gensingen (Rheinhessen) Zahl der Mitglieder: 125 (Stand: 31.01.2016), Tendenz: zunehmend! Vorstandsvorsitzender: Armin Brendel (Ortsbürgermeister Gensingen) Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ralf Simon (FH Bingen) 3 Die Bürgergenossenschaft Rheinhessen eG - Ziele • „von uns für uns“: Interessierte Bürger sollen die Möglichkeit erhalten, sich aktiv an einer umweltfreundlichen Energieversorgung für -

15/3941 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 15/ 15. Wahlperiode 3941 29. 10. 2009 Kleine Anfrage der Abgeordneten Dorothea Schäfer und Thomas Günther (CDU) und Antwort des Ministeriums der Finanzen Maßnahmen des Konjunkturpakets im Landkreis Mainz-Bingen Die Kleine Anfrage 2485 vom 6. Oktober 2009 hat folgenden Wortlaut: Wir fragen die Landesregierung: 1. Welche vorgeschlagenen Projekte des Landkreises Mainz-Bingen wurden als förderungswürdig im Sinne des Konjunkturpakets II positiv beschieden? 2. Welche Summe fließt jeweils den einzelnen Projekten aus den Mitteln des Konjunkturpakets II zu? 3. Welchen Anteil bringen die kommunalen Gebietskörperschaften des Landkreises Mainz-Bingen am Gesamtvolumen der je- weiligen Projekte auf? 4. Sind der Landesregierung Projekte bekannt, bei denen die jeweilige Gebietskörperschaft ihren Anteil nicht vollständig erbringen konnte? 5. Wenn ja, wie reagierte die Landesregierung auf solche Fälle? 6. In welchem Stadium befinden sich die bewilligten Projekte derzeit? 7. Sind der Landesregierung Verzögerungen bei der Auftragsvergabe bekannt? Wenn ja, welche und warum? Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Oktober 2009 wie folgt beantwortet: Die Antworten auf alle sieben Fragen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht, in der das Ergebnis der Datenbankabfrage und einer entsprechenden Ressortumfrage dargestellt ist. Informationen zu den Fragen 1 und 2 enthält darüber hinaus auch die Synopse aller geförderten bzw. zur Förderung vorgesehenen Projekte, die -
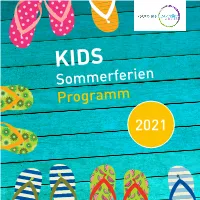
Sommerferienprogramm 2021.Pdf
KIDS Sommerferien 1 Programm 2021 Klaus Penzer Stefan Herte Bürgermeister der Beigeordneter Verbandsgemeinde Rhein-Selz Liebe Kinder, liebe Eltern, 1 das Coronavirus hatte uns nun lange genug fest im Griff Trotz COVID-19 haben wir es geschafft, auch dieses Mal und uns, mit all seinen Einschränkungen, vor neue und ein spannendes und buntes Programmangebot auf die noch nie da gewesene Herausforderungen gestellt. Doch Beine zu stellen, welches euch viel Freude und den Weg nach einer so langen und turbulenten Zeit schöpfen wir in die „Normalität“ bereiten soll. nun endlich wieder Hoffnung! Wir wünschen uns, dass Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird somit erneut das gemeinsame Toben, Spielen und Lernen schon bald ihr Versprechen halten und eines ihrer größten Ziele wieder uneingeschränkt möglich sein wird und unser verwirklichen können: „Kein Ferientag ohne Betreuung!“ Alltag schon bald wieder all die schönen und gemein- Wir werden alle sechs Ferienwochen mit eigenen Pro- schaftlichen Momente zulässt. grammen in Guntersblum, Dolgesheim und – mit einem Und so haben wir uns voller Zuversicht und Vorfreude riesengroßen Highlight – in Oppenheim vertreten sein. dazu entschieden, die alljährlichen VG-Sommerferien, Denn nicht nur für alleinerziehende oder berufstätige so gewohnt wie eben nur möglich, stattfinden zu lassen. Eltern sind diese sechs Wochen schulfreie Zeit eine gro- Natürlich werden auch wir uns an bestimmte Hygiene- ße Herausforderung. Auch unsere Kinder brauchen den schutz-Richtlinien halten müssen. Doch lassen wir uns Kontakt, den Austausch und die Abwechslung mit und davon nicht abschrecken und freuen uns schon heute zur Außenwelt – dies wissen wir nun besser als je zuvor. darauf, gemeinsam mit euch wieder Neues zu entde- In diesem Sinne wünschen wir allen Kindern, Jugend- cken, kleine und große Abenteuer zu erleben und eine lichen, Eltern und Lehrern eine schöne und erholsame unvergessliche Ferienzeit zu verbringen! Ferienzeit und viel Spaß beim Sommerferienprogramm Die Erstellung und Durchführung der jährlichen Ferien- in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. -

Flurbereinigungsbeschluss.Pdf
Rheinland-Pfalz Simmern, 20.12.2012 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Postfach 02 25, 55462 Simmern Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Schloßplatz 10, 55469 Simmern Abteilung Landentwicklung und Ländliche Boden- Telefon: 06761/9402-39 ordnung Telefax: 06761/9402-75 Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren E-Mail: Landentwicklung- Diebachtal - Wald [email protected] Internet: www.dlr-rnh.rlp.de Az. 61194 H.A. 2.3 Flurbereinigungsbeschluss I. Anordnung 1. Anordnung der vereinfachten Flurbereinigung nach § 86 Abs. 1 Nrn. 1 - 4 Flurbe- reinigungsgesetz (FlurbG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) Hiermit wird für die nachstehend näher bezeichneten Teile der Gemarkungen Bacharach, Manubach, Oberdiebach und Oberheimbach das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Diebachtal - Wald angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen des Na- turschutzes, der Landschaftspflege, der Agrarstrukturverbesserung und Gestaltung des Landschaftsbildes, der naturnahen Entwicklung von Gewässern zu ermöglichen und aus- zuführen, um Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu beseitigen, die durch Herstel- lung, Änderung oder Beseitigung von Infrastrukturanlagen oder durch ähnliche Maßnah- men entstehen oder entstanden sind und um Landnutzungskonflikte aufzulösen. 2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes Das Flurbereinigungsgebiet, dem die nachstehend aufgeführten Flurstücke unterliegen, -

Kreis Mainz-Bingen Denkmalverzeichnis Kreis Mainz-Bingen Grundlage Des Denkmalverzeichnisses Ist
Kreis Mainz-Bingen Denkmalverzeichnis Kreis Mainz-Bingen Grundlage des Denkmalverzeichnisses ist Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz - Kreis Mainz Bingen- Band. 18.1 „Städte Bingen und Ingelheim, Gemeinde Budenheim, Verbandsgemeinden Gau- Algesheim, Heidesheim, Rhein-Nahe, Sprendlingen-Gensingen“ (2007) Band 18.2 „Verbandsgemeinden Bodenheim, Guntersblum, Nieder-Olm“ (2011) Band 18.3 „Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim“ (2011) In das Verzeichnis sind alle uns zugegangenen Informationen über Anschriftenänderungen, Abbrüche, "neue" Denkmäler etc. eingeflossen. Allerdings können insbesondere Anschriften im Einzelfall veraltet bzw. nicht mehr zutreffend sein; Hinweise und Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht. An der Aktualisierung der Daten wird ständig gearbeitet; überarbeitete Seiten sind am aktualisierten Datum erkennbar. Innerhalb des Kreises wird im Ortsalphabet und darunter straßenweise nach dem Alphabet geordnet. Herausragende Denkmälergruppen, wie Kirchen, Stadtbefestigungen, historische Ortskerne, sind – wie in der „Denkmaltopographie“ - dem Straßenalphabet vorangestellt. Denkmäler außerhalb der Ortslage folgen unter der Überschrift "Gemarkung. Die der Fachbehörde bekannten archäologischen Fundstellen sind wegen ihrer Gefährdung in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt. Der Schutz der unbeweglichen Kulturdenkmäler entsteht bereits durch das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen des § 3 Denkmalschutzgesetz (DSchG) und ist nicht von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig, d.h. -

Ministerium Für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschft Und Weinbau Stiftstr. 9 55116 Mainz
Autobahnanschl. Mz.-Mombach Schiersteiner Brücke Rheinallee Zeichenerklärung W allaustraße Kaisertor Rhein DB Hauptbahnhof So finden Sie uns: Frauenlobstraße Rheinallee S S-Bahn Greif P Kaiserstraße fenklaustr Taxi Taxistand Forsterstraße Christus Adam-Karillon-Straße Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Kirche . H Bushaltestelle Hindenburgstraße Rheinufer Landwirtschft und Weinbau Ernst-Ludwig- Köln-Frankfurt-Kassel Kurfürstl. (Wiesbadener Kreuz) Parkplatz Stiftstr. 9 P von-Isenburg-StrSchloß H Kaiser- Hindenb. Str P Parkhaus/ Friedrich- . 55116 Mainz platz Str. P Landtag H Peter-Altmeier-Allee Tiefgarage Diether- Platz der Hauptverkehrswege Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, . Landwirtschaft und Weinbau Leibnizstr Mainzer P Theodor-Heuss-Brücke Busverbindungen von Mainz Hbf Richtung Bauhofstraße: Republik Bauhofstraße . Linie: 6 Richtung Wiesbaden bis Haltestelle Bauhofstr. Stiftsstr Landesbank LRP, St. Peter Schieß - gartenstr H Linie: 65 Richtung Weisenau Haltestelle Bauhofstr. Landesbank LRP Bleiche -str. Eltzer Große Bleiche Fußweg von Mainz Hbf.: Boppstraße H Mitternacht Zeughausg Adam-Karillon-Straße Mitternachts Hof Brücken Kaiser-Wilhelm-Ring Flachs platz Ca. 10 Minuten über die Bahnhofstraße, Kaiserstr. Bauhofstr. Landes- Peters markt- Autobahn- Heidelbergerfaßgasse .museum str. str anschl. Hintere Reichklara Mz.-Mombach Rhabanusstr Kaiser- straße/ B 40 Löwen Bauerngasse P . MULEWF, Abt. 7 Frauenlobstraße Neubrunnenstraße eteng. g. Löhrstraße . H . Karmeliterstr hofstr Flachs Rheinstraße Wiesbaden markt = Ausschnitt siehe rechts Taxi Klarastraße . H Mainz Margar Christo Zanggasse fsg. Köln-Frankfurt H Innenstadt . Christofsstr Lotharstr Schusterstr (Wiesbadener Kreuz) H Hintere Bahn- Mombacher Straße g-Str Rathaus hofs- Schottstr . Römer- W.-Mainzer Str. S platz Schiersteiner Kreuz Emmeransstraße A 66 Taxi pass. P H str. Bahn Kolpin hofstr Große Bleiche Stadthaus- . DB Quintinsstraße Autobahnanschl. Wiesbaden-Erbenheim . Mittlere Bleiche Um Steingasse (W H bach Am Brand Am eisenauerMz.-W Brücke) Parcus straße Münster Kronberger . -
Bebauungsplan "Ortskern Harxheim, Westlicher Teil" (1. Änderung)
C2 Geltungsbereich A Geltungsbereich B Geltungsbereich C 3,0 Maßzahlen (Angabe in Meter) MD a Art der baul. Nutzung / Bauweise Stellung der baulichen Anlagen (Hauptfirstrichtung) MD g g MD ED MD C1 GRZ TH GRZ TH GRZ Grundflächenzahl (GRZ) / max. Traufhöhe (TH) LPB V TH GRZ TH 0,3 7,50 m 0,4 7,50 m Grenze der Lärmpegelbereiche gemäß Anhang 6 des schall- 0,6 7,5 m MD E LPB IV technischen Gutachtens (siehe textliche Festsetzung I.1.14.1) 0,75 7,50 m II II max. Zahl der Vollgeschosse II GRZ TH II 54 dB-Grenze gemäß Anhang 3.1 des schalltechnischen 0,3 10,0 m 54 dB EG Gutachtens (siehe textliche Festsetzung I.1.14.2) 5 II , 0 4 , 0 1. Art der baulichen Nutzung 60 dB-Grenze gemäß Anhang 3.1 des schalltechnischen 5 60 dB , 0 Gutachtens (siehe textliche Festsetzung I.1.14.3) rkante MD Dorfgebiete (§ 5 BauNVO) sse ä V w G freizuhaltende Sichtfelder gemäß RAS-K e V G I B O P . B L 1 P G B L E 2. Maß der baulichen Nutzung D d 4 B 5 d 4 Vorhandene Gebäude laut Liegenschaftskataster 5 z.B. GRZ 0,4 Grundflächenzahl ,0 3 G z.B. TH 7,50 m Traufhöhe als Höchstmaß in m 1 O . 8 2 II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß , B 0 d B d 4 5 0 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen Ausbau der L425 (Abgrenzung der Verkehrsflächen) 6 z.B. V E Einzelhäuser zulässig Ausbau der L425 (Böschungen) ,5 14 1 a Abweichende Bauweise gemäß textlicher Festsetzung Ziffer I.1.3.3. -

Kvhs-Mainz-Bingen-Programm-1-2019.Pdf
KVHS ZENTRALE VHS BODENHEIM VHS BUDENHEIM VHS DIENHEIM VHS ESSENHEIM VHS GAU-ALGESHEIM / APPENHEIM / OBER-HILBERSHEIM VHS GENSINGEN / ASPISHEIM / GROLSHEIM / HORRWEILER VHS GUNTERSBLUM / BERGGEMEINDEN VHS HARXHEIM/ 1/2019 GAU-BISCHOFSHEIM / LÖRZWEILER / MOMMENHEIM PROGRAMM VHS HEIDESHEIM VHS NACKENHEIM VHS NIEDER-OLM 1/2019 VHS NIERSTEIN VHS OBER-OLM VHS OCKENHEIM ROGRAMM VHS OPPENHEIM P VHS SPRENDLINGEN VHS STADECKEN-ELSHEIM / JUGENHEIM VHS UNDENHEIM VHS WALDALGESHEIM VHS ZORNHEIM Kreisvolkshochschule Tel. 06132 787-7102 Mainz-Bingen e.V. Fax 06132 787-7199 Konrad-Adenauer-Straße 3 [email protected] 55218 Ingelheim www.kvhs-mainz-bingen.de MAINZ-BINGEN KREISVOLKSHOCHSCHULE www.kvhs-mainz-bingen.de VORWORT Das Logo der Volkshochschulen weist 2019 auf ein besonderes Datum hin. Vor 100 Jahren wurden in Artikel 148 der Weimarer Verfassung alle staatlichen Ebenen aufgefordert, das Volksbil- dungswesen einschließlich der Volkshochschulen zu fördern. Das Jahr 1919 setzt also den Grundstein für die Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung. „Wissen teilen“ ist das Logo 2019 über- vorbereitet, so dass sie in der Lage sind, wichtige Brückenfunktion. Das Handwerks- schrieben, das heute so aktuell wie damals auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. zeug hierzu vermittelt ebenfalls die KVHS. die Bedeutung der Weiterbildung be- Nachholende Schulabschlüsse spielen schreibt. Nur die Themen haben sich dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Und zu alle dem steht 2019 ein weiteres verändert. Geblieben ist die gesellschafts- Jubiläum an: Der Landkreis Mainz-Bingen politische Dimension der Weiterbildung, Nach wie vor im Fokus der Arbeit der wird 50 Jahre alt. Am Jubiläumsprogramm die insbesondere in Zeiten von Umbrüchen Kreisvolkshochschule steht die Berufsqua- beteiligt sich auch die KVHS und lädt gefragter ist denn je. -

Meter 0 5000 10000 15000
Bausendorf Reil MichelbachNeuerkirch Benzweiler Manubach Bengel Wueschheim Niederkumbd Neuerburg Pleizenhausen Mombach Kinderbeuern Oberdiebach Burg Zell Niederheimbach Budenheim Peterswald Moerschbach Oberheimbach Loeffelscheid Kuelz Wahlbach Dichtelbach Kappel Reich Kaimt Trechtingshausen 10% Kuembdchen Altweidelbach Kleinweidelbach Uerzig Kroev Heidesheim Bombogen Rheinboellen Gonsenheim Mainz Biebern Fronhofen Kinheim Roedelhausen Reckershausen Keidelheim Schnorbach der bisher mit Langzeitmessungen beobachteten Altlay Belg Kludenbach Erden Briedel Simmern niedrigstenFrei-Weinheim mittleren Radonaktivitätskonzentrationen Loesnich Todenroth Mutterschied Ellern Daxweiler Nannhausen Weiler Finthen Wuerrich in derNieder-Ingelheim jeweiligen stratigraphischen Einheit Enkirch Heinzenbach Zeltingen-Rachtig Metzenhausen Unzenberg Nickweiler Wolf Weisenau Schwarzen ergaben Maximalwerte von ... Bretzenheim Hahn Wackernheim Drais Platten Ohlweiler Waldalgesheim Bingerbrueck Traben Bingen Gaulsheim Seibersbach Warmsroth Raversbeuren Oberkostenz Schoenborn Argenthal Kempten Starkenburg Baerenbach Holzbach Radonvorsorgegebiet(sklasse) 0 < 20 KBq/m3 Wehlen Ober-Ingelheim Marienborn Kirchberg Oppertshausen Wald-Erbach Niederkostenz Roedern Belgweiler Gau-Algesheim Hechtsheim Lautzenhausen Doerrebach Buedesheim > 20 - 40 KBq/m3 Maring-Noviand Graach Roth Radonvorsorgegebiet(sklasse) 1 Loetzbeuren Riesweiler Genheim Muenster-Sarmsheim Gross-Winternheim Trarbach Ockenheim Sohren Maitzborn Tiefenbach Lieser Klein-Winternheim3 Irmenach Ravengiersburg Stromberg -

Osterferien 2021 in Der VG Bodenheim ______
Osterferien 2021 in der VG Bodenheim ________________________________________________________________________ Ferienspaß trotz Corona In eintönigen Zeiten ist ein buntes Ferienprogramm besonders wichtig! Aber wie die Lage an Ostern sein wird, wissen wir zur Zeit noch nicht. Daher haben wir beides vorbereitet: Online- und Präsenzveranstaltungen. Letztere finden natürlich nur statt, wenn die dann geltenden Coronabestimmungen es zulassen. Also: Schau’mer mal! Melde dich einfach für deine Lieblingsveranstaltungen an – online wie in echt winkt eine Menge Spaß. Nr. 1 ZAUBERN Mo. 29.3. und Di. 30.3., jeweils 9:00 bis 12:00 Uhr im VG-Jugendbüro, Nackenheim; ab 8 Jahren; 20,-€ (Daniel de Groot) Mit viel Spaß, Fingerspitzengefühl und etwas Übung erlernen wir verblüffende Tricks und werden zu wahren Magiern! Nr. 2 FORSCHERTAG: EIEIEI - I Mo. 29.3., 9:30 bis 13:00 Uhr im Jugendtreff Gau-Bischofsheim; 6-10 Jahre; 8,-€ (Die Knallfroschakademie) Eier sind faszinierende Werke der Natur. Wir machen spannende Experimente rund ums Ei und lernen viel Neues! Nr. 3 ONLINE BALLONTIERE & LUFTBALLON-KUNSTWERKE Mo. 29.3., 10:00 bis 12:00 Uhr; 8-12 Jahre; 15,-€ (Rolls-Toys – Hagen Büchner) In diesem Onlinekurs drehen wir aus Luftballons Kunstwerke. Hund, Teddybär oder Hubschrauber? Vieles ist möglich! Nr. 4 SELBSTBEHAUPTUNG & SELBSTVERTEIDIGUNG Mo. 29.3. bis Do. 1.4., jew. 11:30 bis 13:00 Uhr, Sporthalle Gau-Bischofsheim / Do. 1.4., 16:00 bis 17:30 Uhr, Undenheim; 6-12 Jahre; 60,-€ (AITASPORTS) In diesem Kurs lernst du, dein Selbstvertrauen zu stärken, Gefahren richtig einzuschätzen und dich im Notfall zu verteidigen. Nr. 5 FORSCHERTAG: EIEIEI - II Mo. 29.3., 14:00 bis 17:30 Uhr im Jugendtreff Gau-Bischofsheim; 6-10 Jahre; 8,-€ (Die Knallfroschakademie) Eier sind faszinierende Werke der Natur. -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1.