Katalog Nr. 43
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dueling, Honor and Sensibility in Eighteenth-Century Spanish Sentimental Comedies
University of Kentucky UKnowledge University of Kentucky Doctoral Dissertations Graduate School 2010 DUELING, HONOR AND SENSIBILITY IN EIGHTEENTH-CENTURY SPANISH SENTIMENTAL COMEDIES Kristie Bulleit Niemeier University of Kentucky, [email protected] Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Niemeier, Kristie Bulleit, "DUELING, HONOR AND SENSIBILITY IN EIGHTEENTH-CENTURY SPANISH SENTIMENTAL COMEDIES" (2010). University of Kentucky Doctoral Dissertations. 12. https://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/12 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in University of Kentucky Doctoral Dissertations by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. ABSTRACT OF DISSERTATION Kristie Bulleit Niemeier The Graduate School University of Kentucky 2010 DUELING, HONOR AND SENSIBILITY IN EIGHTEENTH-CENTURY SPANISH SENTIMENTAL COMEDIES _________________________________________________ ABSTRACT OF DISSERTATION _________________________________________________ A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the University of Kentucky By Kristie Bulleit Niemeier Lexington, Kentucky Director: Dr. Ana Rueda, Professor of Spanish Literature Lexington, Kentucky 2010 Copyright © Kristie Bulleit Niemeier 2010 ABSTRACT OF DISSERTATION DUELING, HONOR AND -

Saraband for Dead Lovers
Saraband for Dead Lovers By Helen de Guerry Simpson Saraband for Dead Lovers I - DUCHESS SOPHIA "I send with all speed," wrote Elizabeth-Charlotte, Duchesse d'Orléans, tucked away in her little room surrounded by portraits of ancestors, "to wish you, my dearest aunt and Serene Highness, joy of the recent betrothal. It will redound to the happiness of Hanover and Zelle. It links two dominions which have long possessed for each other the affection natural to neighbours, but which now may justly embrace as allies. It appears to me that no arrangement could well be more suitable, and I offer to the high contracting parties my sincerest wishes for a continuance of their happiness." The Duchess smiled grimly, dashed her quill into the ink, and proceeded in a more homely manner. "Civilities apart, What in heaven's name is the Duke of Hanover about? This little Sophie-Dorothée will never do; she is not even legitimate, and as for her mother, you know as well as I do that Eléonore d'Olbreuse is nothing better than a French she-poodle to whom uncle George William of Zelle treated himself when he was younger, I will not say more foolish, and has never been able to get rid of since. What, with all respect, was your husband thinking of to bring French blood into a decent German family, and connected with the English throne, too! In brief, my dearest aunt, all this is a mystery to me. I can only presume that it was concluded over your head, and that money played the chief role. -

1822: Cain; Conflict with Canning; Plot to Make Burdett the Whig Leader
1 1822 1822: Cain ; conflict with Canning; plot to make Burdett the Whig leader; Isaac sent down from Oxford, but gets into Cambridge. Trip to Europe; the battlefield of Waterloo; journey down the Rhine; crossing the Alps; the Italian lakes; Milan; Castlereagh’s suicide; Genoa; with Byron at Pisa; Florence; Siena, Rome; Ferrara; Bologna; Venice; Congress of Verona; back across the Alps; Paris, Benjamin Constant. [Edited from B.L.Add.Mss. 56544/5/6/7.] Tuesday January 1st 1822: Left two horses at the White Horse, Southill (the sign of which, by the way, was painted by Gilpin),* took leave of the good Whitbread, and at one o’clock (about) rode my old horse to Welwyn. Then [I] mounted Tommy and rode to London, where I arrived a little after five. Put up at Douglas Kinnaird’s. Called in the evening on David Baillie, who has not been long returned from nearly a nine years’ tour – he was not at home. Wednesday January 2nd 1822: Walked about London. Called on Place, who congratulated me on my good looks. Dined at Douglas Kinnaird’s. Byng [was] with us – Baillie came in during the course of the evening. I think 1 my old friend had a little reserve about him, and he gave a sharp answer or two to Byng, who good-naturedly asked him where he came from last – “From Calais!” said Baillie. He says he begins to find some of the warnings of age – deafness, and blindness, and weakness of teeth. I can match him in the first. This is rather premature for thirty-five years of age. -

The Lives of the Chief Justices of England
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. https://books.google.com I . i /9& \ H -4 3 V THE LIVES OF THE CHIEF JUSTICES .OF ENGLAND. FROM THE NORMAN CONQUEST TILL THE DEATH OF LORD TENTERDEN. By JOHN LOKD CAMPBELL, LL.D., F.E.S.E., AUTHOR OF 'THE LIVES OF THE LORd CHANCELLORS OF ENGL AMd.' THIRD EDITION. IN FOUE VOLUMES.— Vol. IT;; ; , . : % > LONDON: JOHN MUEEAY, ALBEMAELE STEEET. 1874. The right of Translation is reserved. THE NEW YORK (PUBLIC LIBRARY 150146 A8TOB, LENOX AND TILBEN FOUNDATIONS. 1899. Uniform with the present Worh. LIVES OF THE LOED CHANCELLOKS, AND Keepers of the Great Seal of England, from the Earliest Times till the Reign of George the Fourth. By John Lord Campbell, LL.D. Fourth Edition. 10 vols. Crown 8vo. 6s each. " A work of sterling merit — one of very great labour, of richly diversified interest, and, we are satisfied, of lasting value and estimation. We doubt if there be half-a-dozen living men who could produce a Biographical Series' on such a scale, at all likely to command so much applause from the candid among the learned as well as from the curious of the laity." — Quarterly Beview. LONDON: PRINTED BY WILLIAM CLOWES AND SONS, STAMFORD STREET AND CHARINg CROSS. CONTENTS OF THE FOURTH VOLUME. CHAPTER XL. CONCLUSION OF THE LIFE OF LOKd MANSFIELd. Lord Mansfield in retirement, 1. His opinion upon the introduction of jury trial in civil cases in Scotland, 3. -

Ferruccio Busoni Biography
Ferruccio Busoni His Life And Times Beginnings Youth in Italy The Prodigy is Heard Busoni as Composer Free at Last First Experiences Marriage Busoni as Editor Hitting his Stride Busoni as Conductor Masterpiece Unveiled America again Turandot /Die Brautwahl The Author Debuts Back on the Road Paris, D’Annunzio Opera’s Seduction Liceo Rossini War in Europe The Artist at 50 The Last Years Final Enthusiasms Last Days FERRUCCIO BUSONI - HIS LIFE AND TIMES The Busoni heritage begins in Spicchio, a little village on the north bank of the Arno, inhabited mainly by barge-men, one of whom bore the name. The family is thought originally to have come from Corsica. Though reasonably well-off in their day, the Busonis fell on hard times, and upon the father’s death, moved to Empoli. Additional misfortune followed when the second son of three, Giovanni Battista also died later of a long illness in 1860, his wife following shortly thereafter. From this group of three sons, it would be the eldest, Ferdinando who would produce the artist the world learned to know and cherish. In Empoli his siblings became prosperous makers of felt hats, but Ferdinando would have none of that. He hid himself in corners to read the classics and practice the clarinet. Nothing would alter his intention to be a musician of prominence; he was capricious, self-willed, hot-tempered and impatient. These qualities would, lifelong, result in a reputation as difficult, highly-strung, opinionated, quarrelsome and to some a jeffatore...the possessor of the “evil eye.” He was largely self-taught, attained a high degree of proficiency on his instrument, adopted a career as a travelling virtuoso. -

Don Juan Study Guide
Don Juan Study Guide © 2017 eNotes.com, Inc. or its Licensors. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution or information storage retrieval systems without the written permission of the publisher. Summary Don Juan is a unique approach to the already popular legend of the philandering womanizer immortalized in literary and operatic works. Byron’s Don Juan, the name comically anglicized to rhyme with “new one” and “true one,” is a passive character, in many ways a victim of predatory women, and more of a picaresque hero in his unwitting roguishness. Not only is he not the seductive, ruthless Don Juan of legend, he is also not a Byronic hero. That role falls more to the narrator of the comic epic, the two characters being more clearly distinguished than in Byron’s Childe Harold’s Pilgrimage. In Beppo: A Venetian Story, Byron discovered the appropriateness of ottava rima to his own particular style and literary needs. This Italian stanzaic form had been exploited in the burlesque tales of Luigi Pulci, Francesco Berni, and Giovanni Battista Casti, but it was John Hookham Frere’s (1817-1818) that revealed to Byron the seriocomic potential for this flexible form in the satirical piece he was planning. The colloquial, conversational style of ottava rima worked well with both the narrative line of Byron’s mock epic and the serious digressions in which Byron rails against tyranny, hypocrisy, cant, sexual repression, and literary mercenaries. -

The Nerevarine Chronicles
The Nerevarine Chronicles Peace and Prosperity The kingdom of Avalon had existed for nearly a millennium, enjoying peace and prosperity for many of those centuries. In the ebb and flow of time, the races of Avalon united when necessary to converge on a common foe. For the most part, however the dwarves and elves tended to themselves and let the humans, with their shorter life spans, micro-manage the kingdom. As was the custom among humans at the time, people were addressed first by their surname and then their given name. The family name had taken precedence some generations prior, when the Great Houses of Northwind took prominence. Each ruling family was designated as House so-and-so. It did not take long for the custom to trickle out to the human rulers in Dai-Rynn and Dormack. The Great Houses were sometimes referenced by the family crest. House Dagoth, who were worshippers of Pelor, sported a rising sun above a sword, and was commonly called the Sun-and-Sword. House Indoril was called the Moon-and-Star, after their crest, which resembled a tiny slice of the night sky. House Indoril followed Heironeous and the origin of their crest remains a mystery. After the events surrounding the Nerevarine Prophecies, however, this all but ended. Family names were held with honor and pride, but took no more importance over the individual than they had prior. The Great Houses stopped referring to each other as such and that era was left in the wake of these unfortunate events to fade only into the annals of history. -

How to Be the Branch Herald
How to Be the Branch Herald by Lord Michael FitzGeoffrey, GdS, OLM Argent Scroll Herald Taught as a 90-minute class at the annual Kingdom Heraldic & Scribal Symposium Kingdom of An Tir October 11, anno societatis XLIX (being 2014 in the common reckoning) INTRODUCTION: For every barony in the SCA, the office of baronial herald is a requirement. Even for smaller groups, the vast majority have a herald as well. But just what is the duty of this officer-of-arms? This class discusses the role of a branch herald considering both the responsibilities and the opportunities that it carries. For purposes of discussion, this course will categorize the functions of a branch herald into three areas: administrative, ceremonial, and technical. Administrative responsibilities are those for which the branch herald is responsible because s/he is an officer of the branch, and are similar to the responsibilities of every other officer in the branch, but not necessarily the job of other heralds. The ceremonial roles of the branch herald are (to a greater or lesser extent) those tasks that set the herald’s office apart from other offices in the branch. When it comes right down to the fundamentals, ceremony is a great part what heraldry entails. This course will discuss what some of those roles are. Finally, for better or for worse, heralds are viewed as technical experts. As such, the branch herald needs to know (or to learn) some of the basics, at least, of book heraldry, and voice heraldry, as well as where to go for further expertise. -

Music and Artistic Citizenship: in Search of a Swiss Identity
253 Music and Artistic Citizenship: In Search of a Swiss Identity CARLO PICCARDI (Lugano) Although, for obvious reasons, one cannot speak of a “Swiss music” in terms of a unified, homogeneous culture or style, this does not mean there are no observable constants within the variety of its manifestations and its development over time. More than individual elaborations, historical con- ditions have had the greatest influence in determining the aesthetic prin- ciples which have imposed themselves; general behaviour and interests have outweighed particular interests, and the way the country has de- fined itself as a distinct community in relation to its neighbouring nations. This essay draws upon well-known studies to examine music, art and cul- ture from historical, social, civil and political perspectives in an attempt to critically re-examine the question. It will be shown how a certain Swiss musical identity is constituted with regard to its functional role in the country’s interests, as an expression of a collective dimension, as a regu- lating organisation of its integration within society, and as a permanent and recognised dialogue with the institutions. The fact that certain char- acteristics recur both in situations of conservative withdrawal and in those of opening to new influences, leads us to speak of a shared value in the diversity of attitudes. About the fact that Switzerland has been the location of choice for travellers and refugees from all over the continent, someone has said that this country has more often welcomed the people who have found com- fort and refuge here than it has welcomed the messages they have brought with them. -

A Jewish Agent in Eighteenth-Century Paris: Israël Bernard De Valabrègue
W&M ScholarWorks Arts & Sciences Articles Arts and Sciences Spring 2006 A Jewish Agent in Eighteenth-Century Paris: Israël Bernard de Valabrègue Ronald Schechter College of William and Mary, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/aspubs Part of the European History Commons Recommended Citation Schechter, Ronald, A Jewish Agent in Eighteenth-Century Paris: Israël Bernard de Valabrègue (2006). Historical Reflections/Réflexions Historiques, 32(1), 39-63. https://scholarworks.wm.edu/aspubs/779 This Article is brought to you for free and open access by the Arts and Sciences at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Arts & Sciences Articles by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. 1 A Jewish Agent in Eighteenth-Century Paris: Israël Bernard de Valabrègue Ronald Schechter, The College of William and Mary In Lettres orientales, an unfinished novel from 1754, the Arab merchant Aben- Zaïd writes from Constantinople to two friends: A Turk named Zadé and a Frenchman, the Chevalier de ***. Following the conventions of the epistolary novel, an "editor" introduces the correspondents. We learn that Aben-Zaïd is a "learned Oriental" who has grown wise through his travels. Although characterized by a "phlegmatic Asian temperament," Aben-Zaïd is amused by "stories, fables and accounts," which he enjoys sharing with his friends. In the first letter, Aben-Zaïd writes Zadé of his arrival in Constantinople, "the residence of the most powerful prince in the world," Sultan Mahmud. After reflecting on the vicissitudes of Turkish history, he complains of the time that business has taken from his studies. -

263-264 Contents Copia
ROMANCE NOTES YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY VOLUME XLVI, NUMBER 3SPRING, 2006 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY CONTENTS Specters of Naiveté and Nuance in Verlaine’s Poèmes Saturniens Matthew D. Anderson 265 “El amante liberal”: Cervantes’s Ironic Imitation of Heliodorus Sean McDaniel 277 Berceo’s “La casulla de San Ildefonso”: Thematic Transformation through Rhetoric Matthew A. Wyszynski 287 Jews in Voltaire’s Candide Arthur Scherr 297 Transatlantic Visions: Imagining Mexico in Juan Rejano’s La esfinge mestiza and Luis Buñuel’s Los olvidados Victoria Rivera-Cordero 309 João Cabral de Melo Neto and the Poetics of Bullfighting Robert Patrick Newcomb 319 Garnier’s La Troade between Homeric Fiction and French History: The Question of Moral Authority Marc Bizer 331 Reflections on Translating Nicolás Guillén’s Poetry into English Keith Ellis 341 Blurring Boundaries between Animal and Human: Animalhuman Rights in “Juan Darién” by Horacio Quiroga Bridgette W. Gunnels 349 Une réécriture de Constance Verrier chez George Sand: Malgrétout Dominique Laporte 359 Un voyage de l’oeil à l’autre ou Maldoror traverse le miroir. Quelques Remarques sur l’identité et le flou dans Les Chants de Malldoror Éloïse Sureau 367 Translating Tango: Sally Potter’s Lessons Carolyn Pinet 377 Las musas inquietantes de Cristina Peri Rossi. Problematización de la mirada masculina en las artes visuales Parizad Dejbord Sawan 387 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Other publications of the Department: Estudios de Hispanófila, Hispanófila, North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures. Impreso en España Printed in Spain Artes Gráficas Soler, S. L. Valencia, 2007 Depósito Legal: V. 963 - 1962 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SPECTERS OF NAIVETÉ AND NUANCE IN VERLAINE’S POÈMES SATURNIENS MATTHEW D. -
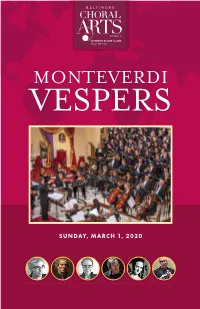
BCAS 11803 Mar 2020 Program Rev3 28 Pages.Indd
ANTHONY BLAKE CLARK Music Director SUNDAY, MARCH 1, 2020 Baltimore Choral Arts Society Anthony Blake Clark 54th Season: 2019-20 Sunday, March 1, 2020 at 3 pm Shriver Hall Auditorium, The Johns Hopkins University, Homewood Campus Monteverdi Vespers Anthony Blake Clark, conductor Leo Wanenchak, associate conductor Baltimore Baroque Band, Peabody’s Baroque Orchestra, Dr. John Moran and Risa Browder, co-directors Peabody Renaissance Ensemble, Mark Cudek, director; Adam Pearl, choral coach Washington Cornett and Sackbutt Ensemble, Michael Holmes, director The Baltimore Choral Arts Chorus James Rouvelle and Lili Maya, artists Vespro della Beata Vergine Claudio Monteverdi I. Domine ad adiuvandum II. Dixit dominus III. Nigra sum IV. Laudate pueri V. Pulchra es VI. Laetatus sum VII. Duo seraphim VIII. Nisi dominus Intermission IX. Audi coelum X. Lauda Ierusalem XI. Sonata sopra Sancta Maria ora pro nobis XII. Ave maris stella XIII. Magnificat 2 Monteverdi Vespers is generously sponsored by the William G. Baker, Jr. Memorial Fund, creator of the Baker Artists Portfolios, www.BakerArtists.org. This performance is supported in part by the Maryland State Arts Council (msac.org). Our concerts are also made possible in part by the Citizens of Baltimore County and Mayor Jack Young and the Baltimore Offi ce of Promotion and the Arts. Our media sponsor for this performance is Please turn the pages quietly, and please turn off all electronic devices during the concert. The use of cameras and recording equipment is not allowed. Thanks for your cooperation. Please visit our web site: www.BaltimoreChoralArts.org e-mail: [email protected] 1316 Park Avenue | Baltimore, MD 21217 410-523-7070 Copyright © 2020 by the Baltimore Choral Arts Society Notice: Baltimore Choral Arts Society, Inc.