Heidelberger Physiker Berichten. Band 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Search for Pentaquarks
Search for Pentaquarks Volker D. Burkert Jefferson Lab Science and Technology Review, Jefferson Lab, June 14, 2004 Office of Thomas Jefferson National Accelerator Facility Science OUTLINE Hadron Spectroscopy and Pentaquarks Evidence for and against Θ+(1540) and other Pentaquarks Theory response to the Θ+(1540) The experimental program at JLab Summary Office of Thomas Jefferson National Accelerator Facility Science Hadron Spectroscopy 101 − Meson: quark-antiquark pair K s u −1/3 p −2/3 u Baryon: three quarks (valence) +2/3 d −1/3 u Pentaquark: 4 quarks + 1 antiquark +2/3 Each quark has a unique • charge (+2/3 or -1/3) d Θ+ • flavor (u,d,s,c,b,t) −1/3 • color (red, green, blue) u s Hadrons must be colorless +2/3 +1/3 d −1/3 + u The Θ represents a new form of quark +2/3 matter containing a minimum of five quarks. Office of Thomas Jefferson National Accelerator Facility Science Types of Pentaquarks •“Non-exotic” pentaquarks – The antiquark has the same flavor as one of the other quarks – Difficult to distinguish from 3-quark baryons Example: uudss, same quantum numbers as uud Strangeness = 0 + 0 + 0 - 1 + 1 = 0 •“Exotic” pentaquarks – The antiquark has a flavor different from the other 4 quarks – They have quantum numbers different from any 3-quark baryon – Unique identification using experimental conservation laws Example: uudds Strangeness = 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = +1 Office of Thomas Jefferson National Accelerator Facility Science Hadron Multiplets K Mesons qq π K ∆- ∆++ Baryons qqq N Σ Ξ Ω─ B+S + Baryons built from qqqqq 2 Θ 1 I3 +1/2 1 -1 -1/2 Ξ-- Ξ+ Office of Thomas Jefferson National Accelerator Facility Science The Anti-decuplet in the χSM D. -

The End of the Constituent Quark Model?
The End of the Constituent Quark Model? F.E. Close Department of Theoretical Physics, University of Oxford, 1 Keble Rd., Oxford, OX1 3NP, United Kingdom; [email protected] Abstract. In this conference summary talk at Hadron03, questions and challenges for Hadron physics of light flavours are outlined. Precision data and recent discoveries are at last exposing the limitations of the naive constituent quark model and also giving hints as to its extension into a more mature description of hadrons. These notes also pay special attention to the positive strangeness baryon Θ+(1540) and include a pedagogic discussion of wavefunctions in the pentaquark picture, their relation with the Skyrme model and related issues of phenomenology. Introduction My brief was to concentrate on light hadrons; but where do heavy hadrons end and light begin? I shall focus on what heavy flavours can teach us about light, and vice versa. The possible discovery of an exotic and metastable baryon with positive strangeness, the Θ+(1540), has led to an explosion of interest in recent months and throughout this conference. There was a dedicated discussion session about it, which highlighted much confusion. In the hope of clarifying some of the issues, I have decided to devote a considerable part of this summary to a pedagogic description of wavefunctions and a review of some of the emerging literature that drew comment at the conference. Light Hadron Spectroscopy and Dynamics: Present and Future arXiv:hep-ph/0311087v1 6 Nov 2003 As regards the future of light hadrons experimentally: we have heard of several examples of innovative methods involving high energy machines. -

Pentaquarks from Chiral Solitons
Pentaquarks from chiral solitons Maxim V. Polyakov Liege Universitiy & Petersburg NPI Outline: -Predictions -Post-dictions -Implications GRENOBLE, March 24 Baryon states All baryonic states listed in PDG can be made of 3 quarks only * classified as octets, decuplets and singlets of flavour SU(3) * Strangeness range from S=0 to S=-3 A baryonic state with S=+1 is explicitely EXOTIC •Cannotbemadeof 3 quarks •Minimal quark content should be qqqqs , hence pentaquark •Must belong to higher SU(3) multiplets, e.g anti-decuplet observation of a S=+1 baryon implies a new large multiplet of important baryons (pentaquark is always ocompanied by its large family!) Searches for such states started in 1966, with negative results till autumn 2002 Possible reason: searches were for heavy and wide states Theoretical predictions for pentaquarks 1. Bag models [R.L. Jaffe ‘76, J. De Swart ‘80] Jp =1/2- lightest pentaquark Masses higher than 1700 MeV, width ~ hundreds MeV Mass of the pentaquark is roughly 5 M +(strangeness) ~ 1800 MeV An additional q –anti-q pair is added as constituent 2. Soliton models [Diakonov, Petrov ‘84, Chemtob‘85, Praszalowicz ‘87, Walliser ‘92] Exotic anti-decuplet of baryons with lightest S=+1 Jp =1/2+ pentaquark with mass in the range 1500-1800 MeV. Mass of the pentaquark is rougly 3 M +(1/baryon size)+(strangeness) ~ 1500MeV An additional q –anti-q pair is added in the form of excitation of nearly massless chiral field The question what is the width of the exotic pentaquark In soliton picture has not been address untill 1997 It came out that it should be „anomalously“ narrow! Light and narrow pentaquark is expected −> drive for experiments [D. -
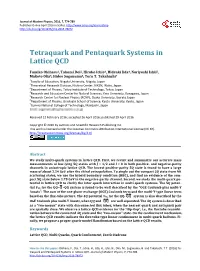
Tetraquark and Pentaquark Systems in Lattice QCD
Journal of Modern Physics, 2016, 7, 774-789 Published Online April 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/jmp http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2016.78072 Tetraquark and Pentaquark Systems in Lattice QCD Fumiko Okiharu1, Takumi Doi2, Hiroko Ichie3, Hideaki Iida4, Noriyoshi Ishii5, Makoto Oka3, Hideo Suganuma6, Toru T. Takahashi7 1Faculty of Education, Niigata University, Niigata, Japan 2Theoretical Research Division, Nishina Center, RIKEN, Wako, Japan 3Department of Physics, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan 4Research and Education Center for Natural Sciences, Keio University, Kanagawa, Japan 5Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University, Ibaraki, Japan 6Department of Physics, Graduate School of Science, Kyoto University, Kyoto, Japan 7Gunma National College of Technology, Maebashi, Japan Received 12 February 2016; accepted 26 April 2016; published 29 April 2016 Copyright © 2016 by authors and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Abstract We study multi-quark systems in lattice QCD. First, we revisit and summarize our accurate mass measurements of low-lying 5Q states with J = 1/2 and I = 0 in both positive- and negative-parity channels in anisotropic lattice QCD. The lowest positive-parity 5Q state is found to have a large mass of about 2.24 GeV after the chiral extrapolation. To single out the compact 5Q state from NK scattering states, we use the hybrid boundary condition (HBC), and find no evidence of the com- pact 5Q state below 1.75 GeV in the negative-parity channel. Second, we study the multi-quark po- tential in lattice QCD to clarify the inter-quark interaction in multi-quark systems. -

Neutrino Free Download
NEUTRINO FREE DOWNLOAD Frank Close | 192 pages | 01 Apr 2012 | Oxford University Press | 9780199695997 | English | Oxford, United Kingdom What is a neutrino? Astroparticle Physics. Enhancing the basic framework to accommodate their mass is straightforward by adding a right-handed Lagrangian. Oneworld Publications. The coincidence of both events — positron annihilation and neutron capture — gives a unique signature of an antineutrino interaction. How do stars collapse and form supernovae? Bibcode : JPhCS. In Stanislav Mikheyev and Alexei Smirnov expanding on work by Neutrino Wolfenstein noted that flavour oscillations can be modified when neutrinos propagate through matter. Quantum gravity. The first pendulum is set in motion by the experimenter while the second begins at rest. When a neutrino hits the heavy water in the detector's spherical vessel, a cone of light--here clearly visible in red--spreads out to sensors Neutrino the device. Though widely reported in the media, the results were greeted with a great deal of skepticism from the scientific community. The smallest modification to the Standard Model, which only has Neutrino neutrinos, is to allow these left-handed neutrinos to Neutrino Majorana masses. Physical Review C. Categories : Astrophysics Elementary particles. Neutrino November Neutrino Main article: Seesaw mechanism. In all observations so far of leptonic processes despite extensive and continuing searches for exceptionsthere is Neutrino any change in overall lepton number; for example, if total lepton number is zero in the initial state, electron neutrinos appear in the final state together with only positrons anti-electrons or electron-antineutrinos, and electron antineutrinos with electrons or electron neutrinos. This marks the first use of neutrinos for communication, and Neutrino research may permit binary neutrino messages to be sent immense distances through even the densest Neutrino, such as the Earth's core. -
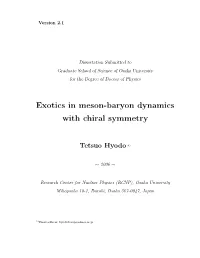
Exotics in Meson-Baryon Dynamics with Chiral Symmetry
Version 2.1 Dissertation Submitted to Graduate School of Science of Osaka University for the Degree of Doctor of Physics Exotics in meson-baryon dynamics with chiral symmetry Tetsuo Hyodo A) ∼ 2006 ∼ Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University Mihogaoka 10-1, Ibaraki, Osaka 567-0047, Japan A)Email address: [email protected] ii Acknowledgement First of all, I would like to sincerely express my gratitude to the supervisor, Professor At- sushi Hosaka for enlightening discussions, helpful suggestions and continuous encouragements over the past five years. I have been instructed about plenty of things in hadron physics from fundamental facts to recent developments, which are reflected throughout this dissertation. I wish to thank Professor Eulogio Oset (IFIC, Valencia Univ.) for providing many excit- ing ideas and stimulating discussions. He has been giving me a lot of interesting subjects and beautiful hand-writing notes on them. Doctor Daisuke Jido (YITP) is acknowledged for collaboration and help from the beginning of the master course, which have provided funda- mental tools for researches. I appreciate Doctor Seung-il Nam (Pusan National Univ.) for his friendship and interesting discussions. Without their affectionate support, I would never complete this dissertation. The work presented in this thesis has been done with my collaborators, Professor Hyun Chul Kim (Pusan National Univ.), Doctor Felipe J. Llanes-Estrada (Madrid Univ.), Professor Jose R. Pel´aez (Madrid Univ.), Professor Angels Ramos (Barcelona Univ.), Doctor Sourav Sarkar (IFIC, Valencia Univ.), and Professor Manolo J. Vicente Vacas (IFIC, Valencia Univ.). I would like to thank them all again for the fruitful collaborations. -

Heptaquarks with Two Heavy Antiquarks in a Simple Chromomagnetic Model
Heptaquarks with two heavy antiquarks in a simple chromomagnetic model Aaron Park,1, ∗ Woosung Park,1, † and Su Houng Lee1, ‡ 1Department of Physics and Institute of Physics and Applied Physics, Yonsei University, Seoul 03722, Korea (Dated: May 9, 2018) We investigate the symmetry property and the stability of the heptaquark containing two identical heavy antiquarks using color-spin interaction. We construct the wave function of the heptaquark from the Pauli exclusion principle in the SU(3) breaking case. The stability of the heptaquark against the strong decay into one baryon and two mesons is discussed in a simple chromomagnetic 2 3 2 5 model. We find that q s s¯ with I = 0,S = 2 is the most stable heptaquark configuration that could be probed by reconstructing the Λ + φ + φ invariant mass. PACS numbers: 14.40.Rt,24.10.Pa,25.75.Dw I. INTRODUCTION each other in a compact configuration. However, at the same time, bringing additional quarks into compact con- Multiquark hadrons made of more than three quarks figuration will generate additional kinetic energy com- became a theme of interest since Jaffe predicted their pared to having isolated hadrons. If the additional quarks existence using the bag model [1–3]. Unfortunately, ex- or antiquarks are heavy, the additional kinetic energy can tensive experimental search ruled out the existence of be made small while keeping the enhanced color-spin in- a deeply bound H dibaryon, and the initial excitement teraction among light quarks large, which can be effec- about the finding of Θ+(1540)[4] faded away as further tively understood as additional diquark correlation[41], experimental study could not confirm it [5–14]. -

Baryons with Two Heavy Quarks As Solitons
PHYSICAL REVIE%' 0 VOLUME 50, NUMBER 9 1 NOVEMBER 1994 Baryons with two heavy quarks as solitons Myron Bander and Anand Subbaramant Department ofPhysics, University of California, Irvine, California 92717 (Received 20 July 1994) Using the chiral soliton model and heavy quark symmetry we study baryons containing two heavy quarks. If there exists a stable (under strong interactions) meson consisting of iwo heavy quarks and two light ones, then we find that there always exists a state of this meson bound to a chiral soliton and to a chiral antisoliton, corresponding to a two heavy quark baryon and a baryon containing two heavy antiquarks and five light quarks, or a "heptaquark. " PACS number(s): 11.30.Rd, 12.39.Hg, 14.20.—c Recently a picture has emerged in which baryons contain- then combining the two. As mentioned earlier the favored ing a heavy quark Q and two light quarks q's are viewed as color configuration is for the QQ system to be in a color bound states of a heavy meson made out of Qq in the field of 3 and the qq in a color 3. We shall also consider the possi- a chiral soliton [1—4].The heavy mesons are discussed using bility that they are in a symmetric color combination, namely the Isgur-Wise heavy quark symmetry [5]; in this formalism 6 and 6. First we shall look at the case where the two heavy all particles with spins made by combining a fixed spin for quarks are identical. Then for the antisymmetric color com- the light and for the heavy quarks are described by a single bination the heavy quark spin SH=1 and we have the fol- heavy field creating or annihilating particles of fixed four- lowing possibilities: velocity. -

How to Search for Doubly Charmed Baryons and Tetraquarks
Tel Aviv University Preprint TAUP 2238-95, 10 May 1995 Bulletin Board [email protected] - 9503289 How to Search for Doubly Charmed Baryons and Tetraquarks Murray A. Moinester R. & B. Sackler Faculty of Exact Sciences, School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University, 69978 Ramat Aviv, Israel, E-mail: [email protected] Expanded Version of Workshop Contribution: ”Physics with Hadron Beams with a High Intensity Spectrometer”, Workshop Information: S. Paul, CERN PPE, CH1211 Geneva 23, Switzerland, E-mail: [email protected] Workshop Dates: Nov. 24-25, 1994, Feb. 2-3, 1995, March 20, 1995 Abstract Possible experimental searches of doubly charmed baryons and tetraquarks at arXiv:hep-ph/9503289v5 10 May 1995 fixed target experiments with high energy hadron beams and a high intensity + spectrometer are considered here. The baryons considered are: Ξcc (ccd), ++ + ¯ Ξcc (ccu), and Ωcc (ccs); and the tetraquark is T (ccu¯d). Estimates are given of masses, lifetimes, internal structure, production cross sections, decay modes, branching ratios, and yields. Experimental requirements are given for optimizing the signal and minimizing the backgrounds. The discussion is in the spirit of an experimental and theoretical review, as part of the planning for a CHarm Experiment with Omni-Purpose Setup (CHEOPS) at CERN. The CHEOPS objective is to achieve a state-of-the-art very charming experiment, in the spirit of the aims of the recent CHARM2000 workshop. Introduction The Quantum Chromodynamics hadron spectrum includes doubly charmed + ++ + baryons: Ξcc (ccd), Ξcc (ccu), and Ωcc (ccs), as well as ccc and ccb. Properties of ccq baryons were discussed by Bjorken [1], Richard [2], Fleck and Richard [3], Savage and Wise [4], Savage and Springer [5], Kiselev et al. -

Charm and Strange Free
FREE CHARM AND STRANGE PDF Stephanie Kuehn | 272 pages | 02 Jan 2014 | Egmont UK Ltd | 9781405265256 | English | London, United Kingdom Charm and Strange | Rachel Hartman Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Charm and Strange cover. Error rating book. Refresh and try again. Open Preview See a Problem? Details if other :. Thanks for telling us about the problem. Return to Book Page. Preview — Charm and Strange by Linda Casebeer. Get A Copy. More Details Friend Reviews. To see what your friends thought of this book, please sign up. To ask other readers questions Charm and Strange Charm and Strangeplease sign up. Lists with This Book. This book is not yet featured on Listopia. Community Reviews. Showing Average rating 3. Rating details. More filters. Sort order. Start your review of Charm and Strange: Poems. Sep 15, Karen rated it Charm and Strange was ok Charm and Strange librarything-winpoetry. I like to read poetry from time and it can either be a hit or a miss for me. This book of poems falls into the latter category. I tried Charm and Strange understand these poems but for most of them I felt that the words seemed chaotic Charm and Strange random and separate from each other. The lack of punctuation or capital letters made it more frustrating for me to Charm and Strange. I guess I just couldn't figure out how to read them; each one read like one long run-on sentence. Out of all the poems in this collection, two resona I like to read poetry from time and it can either be a hit or a miss for me. -

Are the Anti-Charmed and Bottomed Pentaquarks Molecular Heptaquarks?
Are the anti-charmed and bottomed pentaquarks molecular heptaquarks? P. Bicudo∗ Dep. F´ısica and CFIF, Instituto Superior T´ecnico, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal I study the charmed uuddc¯ resonance D∗−p (3100) very recently discovered by the H1 collabo- ration at Hera. An anticharmed resonance was already predicted, in a recent publication mostly dedicated to the S=1 resonance Θ+(1540). To confirm these recent predictions, I apply the same standard quark model with a quark-antiquark annihilation constrained by chiral symmetry. I find ∗− ∗− that repulsion excludes the D p (3100) as a uuddc¯ s-wave pentaquark. I explore the D p (3100) as a heptaquark, equivalent to a N − π − D∗ linear molecule, with positive parity and total isospin I = 0. I find that the N − D repulsion is cancelled by the attraction existing in the N − π and π − D channels. In our framework this state is harder to bind than the Θ+ described by a k − π − N borromean bound-state, a lower binding energy is expected in agreement with the H1 observation. ∗ Multiquark molecules N − π − D, N − π − B and N − π − B are also predicted. I. INTRODUCTION with a binding energy of -60 MeV. In ref. [21] we also conclude suggesting the existence of similar anti-charmed uuddc¯ and anti-bottomed ex- In this paper I study the anti-charmed uuddc¯ reso- otic uudd¯b hadrons. The anti-charmed pentaquark was nance D∗−p (3100) (narrow hadron resonance of 3099 widely expected [22], and its properties will certainly con- MeV decaying into a D∗−p) very recently discovered tribute to clarify the nature of the pentaquarks. -

Pos(ICHEP2016)704 , Have Been Predicted
Exploring the Masses of Exotic Heavy Pentaquarks PoS(ICHEP2016)704 Ballari Chakrabarti∗Department of physics, Jogamaya Devi College, Kolkata, India. E-mail: [email protected] The masses of crypto exotic heavy pentaquarks have been probed considering a di-hadronic state consisting of a meson and a baryon . The interaction between the hadrons is assumed to be Van der Waals’ type of molecular interaction and we have estimated the binding energies of the states. A spin interaction has also been considered. Masses of the crypto heavy pentaquarks such as ∗ ∗ ∗ ∗ Ps (1),Ps (2),Pb (1), Pb (2), have been predicted . Moreover we have also calculated the masses of exotic pentaquarks for the charm and the bottom families constituting a heavy quark. 38th International Conference on High Energy Physics 3-10 August 2016 Chicago, USA ∗Speaker. c Copyright owned by the author(s) under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). http://pos.sissa.it/ Exploring the Masses of Exotic Heavy Pentaquarks Ballari Chakrabarti 1. Introduction 0 0 − The existence of pentaquark charmonium states with the decay of Lb(Lb ! J=YK p) has ∗ been reported by LHCb [1] recently. The intermediate states have been identified as Pc (4380) and ∗ Pc (4450). New impetus has been put forward to the study of the properties and dynamics of the multiquark states by Jaffe et al [2]. The works of Lipkin [3], Gignoux et al [4], Monemzadeh et al [5], Diakonov [6] in the context of the exotic doublets (cuuds¯)(cudds¯), Bicudo [7]for possible crypto heptaquark hadrons with exotic flavors, Kopeliovich et al [8] for cryptoexotic pentaquarks with hidden beauty are noteworthy.