Gericht Entscheidungsdatum Geschäftszahl Spruch Text
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
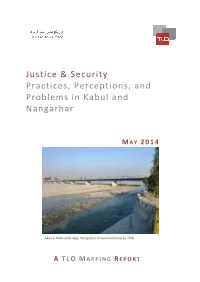
Justice & Security Practices, Perceptions, and Problems in Kabul and Nangarhar
Justice & Security Practices, Perceptions, and Problems in Kabul and Nangarhar M AY 2014 Above: Behsud Bridge, Nangarhar Province (Photo by TLO) A TLO M A P P I N G R EPORT Justice and Security Practices, Perceptions, and Problems in Kabul and Nangarhar May 2014 In Cooperation with: © 2014, The Liaison Office. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, recording or otherwise without prior written permission of the publisher, The Liaison Office. Permission can be obtained by emailing [email protected] ii Acknowledgements This report was commissioned from The Liaison Office (TLO) by Cordaid’s Security and Justice Business Unit. Research was conducted via cooperation between the Afghan Women’s Resource Centre (AWRC) and TLO, under the supervision and lead of the latter. Cordaid was involved in the development of the research tools and also conducted capacity building by providing trainings to the researchers on the research methodology. While TLO makes all efforts to review and verify field data prior to publication, some factual inaccuracies may still remain. TLO and AWRC are solely responsible for possible inaccuracies in the information presented. The findings, interpretations and conclusions expressed in the report are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Cordaid. The Liaison Office (TL0) The Liaison Office (TLO) is an independent Afghan non-governmental organization established in 2003 seeking to improve local governance, stability and security through systematic and institutionalized engagement with customary structures, local communities, and civil society groups. -

Community- Based Needs Assessment
COMMUNITY- BASED NEEDS ASSESSMENT SUMMARY RESULTS PILOT ▪ KABUL As more IDPs and returnees urbanize and flock to cities, like Kabul, in search of livelihoods and security, it puts a strain on already overstretched resources. Water levels in Kabul have dramatically decreased, MAY – JUN 2018 forcing people to wait for hours each day to gather drinking water. © IOM 2018 ABOUT DTM The Displacement Tracking Matrix (DTM) is a system that HIGHLIGHTS tracks and monitors displacement and population mobility. It is districts assessed designed to regularly and systematically capture, process and 9 disseminate information to provide a better understanding of 201settlements with largest IDP and return the movements and evolving needs of displaced populations, populations assessed whether on site or en route. 828 In coordination with the Ministry of Refugees and Repatriation key informants interviewed (MoRR), in May through June 2018, DTM in Afghanistan piloted a Community-Based Needs Assessment (CBNA), intended as an 1,744,347 integral component of DTM's Baseline Mobility Assessment to individuals reside in the assessed settlements provide a more comprehensive view of multi-sectoral needs in settlements hosting IDPs and returnees. DTM conducted 117,023 the CBNA pilot at the settlement level, prioritizing settlements residents are returnees from abroad hosting the largest numbers of returnees and IDPs, in seven target 111,700 provinces of highest displacement and return, as determined by IDPs currently in host communities the round 5 Baseline Mobility Assessments results completed in mid-May 2018. DTM’s field enumerators administered the inter- 6,748 sectoral needs survey primarily through community focus group residents fled as IDPs discussions with key informants, knowledgeable about the living conditions, economic situation, access to multi-sectoral 21,290 services, security and safety, and food and nutrition, among residents are former IDPs who returned home other subjects. -

Länderinformationen Afghanistan Country
Staatendokumentation Country of Origin Information Afghanistan Country Report Security Situation (EN) from the COI-CMS Country of Origin Information – Content Management System Compiled on: 17.12.2020, version 3 This project was co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund Disclaimer This product of the Country of Origin Information Department of the Federal Office for Immigration and Asylum was prepared in conformity with the standards adopted by the Advisory Council of the COI Department and the methodology developed by the COI Department. A Country of Origin Information - Content Management System (COI-CMS) entry is a COI product drawn up in conformity with COI standards to satisfy the requirements of immigration and asylum procedures (regional directorates, initial reception centres, Federal Administrative Court) based on research of existing, credible and primarily publicly accessible information. The content of the COI-CMS provides a general view of the situation with respect to relevant facts in countries of origin or in EU Member States, independent of any given individual case. The content of the COI-CMS includes working translations of foreign-language sources. The content of the COI-CMS is intended for use by the target audience in the institutions tasked with asylum and immigration matters. Section 5, para 5, last sentence of the Act on the Federal Office for Immigration and Asylum (BFA-G) applies to them, i.e. it is as such not part of the country of origin information accessible to the general public. However, it becomes accessible to the party in question by being used in proceedings (party’s right to be heard, use in the decision letter) and to the general public by being used in the decision. -

AFGHANISTAN Kabul Province Flood Risk Exposure
AFGHANISTAN Kabul Province Flood Risk Exposure Location Diagram Nejrab Bagram Qara Bagh Alasay Koh-e- Safi Tagab Parwan Qarabagh Estalef Estalef Kapisa Legend Road Network Farza Farza Capital Highway Kalakan Provincial Capital Secondary Road Guldara N Primary Road " District Center 0 ' Guldara 5 Mirbachakot 4 ° 4 3 Kalakan Airport Boundary Airport District Boundary Mir Bacha Kot Airfield Province Boundary Shakar Dara International Boundary Shakardara Helipad Deh Sabz River Flood Risk Exposure Minor River High Risk Intermediate River Medium Risk Major River Low Risk No Risk Paghman Dehsabz Surobi Population Living in Flood Risk Zone 31.41 K (0.66%) 89.35 K Kabul (1.88%) Paghman 123.71 K Laghman (2.6%) Bagrami 4.52 M N " 244.5 K 0 ' (94.87%) 0 3 ° 4 3 Surobi AT RISK Bagrami Flood Risk Area (km²) 72.2 (1.55%) 147.5 Kabul (3.17%) 148.4 (3.19%) Chaharasyab Maydan Shahr Musahi Chahar Asyab Khak-e- 4.29 K 368 Musayi Jabbar (92.09%) AT RISK Nangarhar Hesarak Flood Risk Category: Maidan Flood risk category is estimated based upon potential flood depth: Low flood risk relates to inundation more than 29cm, moderate to Wardak 1.21m and high flood risk more than 2.7m. The 100-year inundation interval implies that every year there is a N " Khak-e-Jabbar Sherzad 0 1% chance of such a flood event occurring. Most flood events will ' 5 1 ° 4 be in 5,10, 20-year inundation interval. 3 Disclaimer and Data Source: Logar The boundaries,names, and designations used on this map do not Mohammadagha imply official endorsement or acceptance by iMMAP or USAID /OFDA. -

Transportation Services for the Socio-Demographic and Economic Survey in Kabul and Panjshir Provinces
Address: UNOCA Compound, Jalalabad Road, Kabul, Afghanistan Telephone: +93 (0) 0707 11 66 66 Email: [email protected] Website: www.unfpa.org Sunday 14nd July 2013 Re-Advertisement REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) RFP No. UNFPA/KBL/13/009 Transportation services for the Socio-Demographic and Economic Survey in Kabul and Panjshir Provinces UNFPA, United Nations Population Fund, an international development agency, is seeking qualified offers for the above-mentioned services. Your company is kindly invited to submit your best technical and financial offer for the requested Services. Your bid could form the basis for a contract between your firm/institution and the UNFPA. 2. UNFPA posts all bids notices, clarifications and results in www.ungm.org. 3. To enable you to submit a bid, please read the following attached documents carefully: • Instructions to Bidders Annex I • Terms of Reference (ToR) Annex II • Bid Submission Form Annex III • Bidders Identification Form Annex IV • Format of Bidder’s Previous Experience and Clients Annex V • Technical forms Annex VI • Price Schedule Form Annex VII • UNFPA General Terms and Conditions Annex VIII 4. The technical bid containing the technical information shall be submitted separately from the financial bid. 5. The bid shall reach UNFPA’s reception or for entities with no representation in Afghanistan only, by sending two separate emails (one each for the technical proposal and the financial proposal in PDF format) only to [email protected] (please add that the physical delivery to UNFPA office is possible as per RFP Clause 13) no later than (21 July 2013, 02:00 pm, Kabul Local Time). -

AFGHANISTAN Humanitarian Operational Capacity (3W) (October - Decmeber 2018)
AFGHANISTAN Humanitarian Operational Capacity (3W) (October - Decmeber 2018) 220 organisations Darwaz-e-Payin UZBEKISTAN Shaki TAJIKISTAN Organisations with the capacity to provide humanitarian Kofab services in October, November and December 2018. Khwahan Darwaz-e-Balla Shighnan Raghestan Yawan Chahab Yangi Qala Shahr-e-Buzorg Kohistan Arghanj Darqad Khwah CHINA Qarqin Shortepa Yaftal-e-Sufla Khamyab Dasht-e-Qala Wakhan TURKMENISTAN Khan-e-Char Mardyan Fayzabad Sharak-e-Hayratan Kaldar Shuhada Bagh Imam Sahib ! Qurghan Mingajik Dawlat Abad Rostaq Argo Khwaja Baharak Dasht-e-Archi Andkhoy Khwaja Dukoh Ghar Hazar Khash Warduj Balkh Nahr-e-Shahi Qala-e-Zal KUNDUZ Sumuch Qaram Qul JAWZJAN Fayzabad Darayem Char Khulm Kunduz Khan Baharak Kalafgan Khanaqa Bolak Eshkashem Mazar-e-Sharif ! Abad ! Keshem Jorm ! ! Teshkan Chahar Darah Taloqan Shiberghan Aqcha Dehdadi Ali Dawlat Abad Bangi TAKHAR Chemtal Abad BADAKHSHAN NUMBER OF REPORTED ORGANISATIONS BY CLUSTER Marmul Farkhar Feroz Chal Tagab Yamgan BALKH Nakhchir Namak Ab Charkent Zebak Shirin Tagab Sar-e-Pul Hazrat-e-Sultan Eshkmesh Qush ! Sholgareh ! Tepa Aybak Baghlan-e-Jadid Burka Guzargah-e-Nur Khwaja Sayad Keshendeh Fereng Almar Sabz Posh SAMANGAN Warsaj Darzab Sozmaqala Khwaja Wa Gharu ! Khuram Wa Pul-e-Khumri Ghormach Nahrin Hejran Maymana Gosfandi Dara-e-Suf-e-Payin Sarbagh ! Khost Wa Koran Wa Bilcheragh Zari Pashtun Kot Fereng Monjan Dahana-e-Ghori ! Sancharak BAGHLAN ! ! ! Dara-e-Suf-e-Bala Barg-e-Matal ! Qaysar FARYAB Deh Salah ! ! ! Garzewan ! Kohestanat ! ! Ruy-e-Duab Paryan ! ! -

AFGHANISTAN Humanitarian Operational Presence (3W) (January - March 2019)
AFGHANISTAN Humanitarian Operational Presence (3W) (January - March 2019) 146 organisations Darwaz-e-Payin UZBEKISTAN Shaki TAJIKISTAN Delivering humanitarian services in Kofab Khwahan January, February and March 2019. Darwaz-e-Balla Raghestan Shighnan Chahab Yawan Yangi Qala Arghanj Darqad Shahr-e-Buzorg Kohistan Khwah CHINA Qarqin Shortepa Yaftal-e-Sufla Khamyab Dasht-e-Qala Wakhan TURKMENISTAN Khan-e-Char Mardyan Fayzabad Sharak-e-Hayratan Kaldar Shuhada Bagh Imam Sahib ! Qurghan Mingajik Dawlat Abad Rostaq Argo Baharak Khwaja Dukoh Khwaja Andkhoy Khulm Dasht-e-Archi Ghar Hazar Khash Warduj JAWZJAN Balkh Qala-e-Zal Sumuch Qaram Qul Fayzabad Char Nahr-e-Shahi KUNDUZ Darayem Kunduz Khan Baharak Kalafgan Khanaqa Bolak Abad Eshkashem Mazar-e-Sharif ! ! Keshem Jorm ! ! Teshkan Chahar Darah Taloqan Shiberghan Aqcha Dehdadi Ali Dawlat Abad Bangi Chemtal Abad TAKHAR Marmul Namak Ab BADAKHSHAN Feroz Yamgan NUMBER OF REPORTING ORGANISATIONS BY CLUSTER Chal Farkhar Tagab BALKH Nakhchir Charkent Zebak Shirin Tagab Sar-e-Pul Hazrat-e-Sultan Eshkmesh Qush ! Sholgareh ! Baghlan-e-Jadid Tepa Aybak Burka Guzargah-e-Nur Khwaja Sayad Keshendeh Fereng Almar Sabz Posh SAMANGAN Warsaj Darzab Sozmaqala Wa Gharu ! Khuram Wa Pul-e-Khumri Nahrin Khwaja Ghormach Maymana Dara-e-Suf-e-Payin ! Bilcheragh Gosfandi Sarbagh Hejran Khost Wa Koran Wa Pashtun Kot Fereng Monjan ! Sancharak Zari ! ! ! Dara-e-Suf-e-Bala BAGHLAN Barg-e-Matal ! Qaysar FARYAB ! Deh Salah ! Dahana-e-Ghori ! Garzewan ! ! ! Ruy-e-Duab Paryan ! ! Bala Murghab Kohestanat ! Andarab Pul-e-Hisar ! -

Baseline Mobility Assessment
BASELINE MOBILITY ASSESSMENT KAPISA SUMMARY RESULTS Like these IDPs living in makeshift tents, 1,740 returnees and IDPs in Paktika live in open air or ROUND 10 ▪ JAN – JUN 2020 tents. © IOM 2020 ABOUT DTM The Displacement Tracking Matrix (DTM) is a system that tracks HIGHLIGHTS and monitors displacement and population mobility. It is designed districts assessed to regularly and systematically capture, process and disseminate 7 information to provide a better understanding of the movements 165 settlements assessed and evolving needs of displaced populations, whether on site or en route. For more information about DTM in Afghanistan, please 794 visit www.displacement.iom.int/afghanistan. key informants interviewed In Afghanistan, DTM employs the Baseline Mobility Assessment 43,078 tool, designed to track mobility, determine the population sizes and returnees from abroad [2012-2020] locations of forcibly displaced people, reasons for displacement, places of origin, displacement locations and times of displacement, 62,489 including basic demographics, as well as vulnerabilities and priority IDPs [2012–2020] currently in host communities needs. Data is collected at the settlement level, through key informant interviews, focus group discussions, and direct observations. 47,685 former IDPs have returned to their homes [2012–2020] DTM enables IOM and its partners to deliver evidence-based, better targeted, mobility-sensitive and sustainable humanitarian 50,905 assistance, reintegration, community stabilization and development out-migrants fled abroad [2012–2020] programming. 5,665 out-migrants fled to Europe (11%) 5 TARGET POPULATIONS 1,740 Through the Baseline Mobility Assessments, DTM tracks the returnees and IDPs live in tents or in the open air locations, population sizes, and cross-sectoral needs of five core target population categories: 3 in 5 56% of all returnees and arrival IDPs reside in Tagab 1. -

Translation of the Death List As Given by Late Afghan Minister of State Security Ghulam Faruq Yaqoubi to Lord Bethell in 1989
Translation of the death list as given by late Afghan Minister of State Security Ghulam Faruq Yaqoubi to Lord Bethell in 1989. The list concerns prisonners of 1357 and 1358 (1978-1979). For further details we refer to the copy of the original list as published on the website. Additional (handwritten) remarks in Dari on the list have not all been translated. Though the list was translated with greatest accuracy, translation errors might exist. No.Ch Name Fathers Name Profession Place Accused Of 1 Gholam Mohammad Abdul Ghafur 2nd Luitenant Of Police Karabagh Neg. Propaganda 2 Shirullah Sultan Mohammad Student Engineering Nerkh-Maidan Enemy Of Rev. 3 Sayed Mohammad Isa Sayed Mohammad Anwar Mullah Baghlan Khomeini 4 Sefatullah Abdul Halim Student Islam Wardak Ikhwani 5 Shujaudin Burhanudin Pupil 11th Grade Panjsher Shola 6 Mohammad Akbar Mohabat Khan Luitenant-Colonel Kohestan Ikhwani 7 Rahmatullah Qurban Shah Police Captain Khanabad Ikhwani 8 Mohammad Azam Mohammad Akram Head Of Archive Dpt Justice Nejrab Ikhwani 9 Assadullah Faludin Unemployed From Iran Khomeini 10 Sayed Ali Reza Sayed Ali Asghar Head Of Income Dpt Of Trade Chardehi Khomeini 11 Jamaludin Amanudin Landowner Badakhshan Ikhwani 12 Khan Wasir Kalan Wasir Civil Servant Teachers Education Panjsher Khomeini 13 Gholam Reza Qurban Ali Head Of Allhjar Transport. Jamal-Mina Khomeini 14 Sayed Allah Mohammad Ajan Civil Servant Carthographical Off. Sorubi Anti-Revolution 15 Abdul Karim Haji Qurban Merchant Farjab Ikhwani 16 Mohammad Qassem Nt.1 Mohammad Salem Teacher Logar Antirevol. -

Afghanistan Opium Survey 2018
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics Afghanistan Opium Survey 2018 Cultivation and Production NOVEMBER 2018 MCN/NSD Research Narcotics Survey Directorate Page intentionally left blank Afghanistan Opium Survey 2018 Contents CONTENTS .................................................................................................................................................. 2 LIST OF FIGURES .................................................................................................................................... 3 LIST OF TABLES ....................................................................................................................................... 4 KEY FINDINGS .......................................................................................................................................... 5 1 INTRODUCTION ..................................................................................................................13 2 OPIUM POPPY CULTIVATION ......................................................................................14 2.1 NATIONAL AND REGIONAL OPIUM POPPY CULTIVATION TRENDS .................... 14 2.2 PROVINCIAL BREAKDOWN ................................................................................................ 21 3 ERADICATION......................................................................................................................35 3.1 POPPY ERADICATION DECREASED BY 46% IN 2018 ................................................... 35 3.2 QUALITY -

Afghanistan Opium Survey 2020: Cultivation and Production
Islamic Republic of Afghanistan Afghanistan Opium Survey 2020 Cultivation and Production ‒ Executive Summary APRIL 2021 Research Page intentionally left blank Afghanistan Opium Survey 2020 – Executive Summary Introduction This Executive Summary presents the key findings of the Afghanistan Opium Survey 2020. The survey is implemented by NSIA in collaboration with UNODC. The survey team collects and analyses information on the location and extent of opium poppy cultivation, potential opium production and the socio-economic situation in rural areas. This information is essential for planning, implementing and monitoring counter-narcotic efforts. The opium survey is implemented within the technical framework of the UNODC Illicit Crop Monitoring Programme (ICMP), established in 1999 upon request of the Commission on Narcotic Drugs in its resolution 42/3, Monitoring and verification of illicit cultivation. The objective of ICMP is to assist the international community in monitoring the extent and evolution of illicit crops and to compile reliable and internationally comparable data. Currently, UNODC carries out monitoring activities in seven countries affected by illicit crop cultivation: coca surveys in Bolivia, Colombia and Peru; opium poppy surveys in Afghanistan, Mexico and Myanmar; and a cannabis survey in Nigeria. The Afghanistan Opium Survey 2020 was implemented under the project “Monitoring of Opium Production in Afghanistan” (AFG/F98), with financial contributions from the Government of United States of America. 3 Afghanistan Opium -

Socio-Demographic and Economic Survey
Islamic Republic of Afghanistan Central Statistics Organization SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC SURVEY KABUL KABUL For more details, please contact: Central Statistics Organization Name: Mr. Eidmarjan Samoon P.O.Box: 1254, Ansari Watt Kabul,Afghanistan Phone: +930202104338 • E-Mail: [email protected] Website: www.cso.gov.af Design: Julie Pudlowski Consulting/Ali Mohaqqeq 2 Cover and inside photos: © UNFPA/CSO Afghanistan/2012 SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC SURVEY KABUL MESSAGE FROM CSO ,WLVZLWKJUHDWKRQRUDQGSOHDVXUHWRSUHVHQWWKLVÀQDOUHSRUWRQWKH6RFLR'HPRJUDSKLFDQG(FRQRPLF 6XUYH\ 6'(6 RI.DEXO3URYLQFH$IWHUJRLQJWKURXJKDOOWKRVHGLIÀFXOWLHVDQGFKDOOHQJHVWKDWVHHP WRQHYHUHQGFRQVLGHULQJWKHLPPHQVHVL]HRIWKHSURYLQFHWKXVPDNLQJWKHFRYHUDJHDUHDZLGHDQG UHTXLULQJPRUHPDQKRXUVDQGODERUWKDQRWKHUSUHYLRXVO\FRYHUHGSURYLQFHVLWMXVWÀOOVXVZLWKSULGH WRQRWHZHKDYHVXFFHVVIXOO\FRPSOHWHGWKHVXUYH\6XSHUYLVLRQRIFORVHWRVXUYH\ZRUNHUV KDVWUXO\EHHQGLIÀFXOWDVVRPHZRXOGTXLWLQWKHPLGGOHRIWKHRSHUDWLRQIRURWKHUMREVZKLFKLQDZD\ MHRSDUGL]HGVFKHGXOHVDQGWLPHOLQHVVRIÀHOGZRUNDVKLULQJQHZVXUYH\ZRUNHUVZRXOGDOVRUHTXLUH QHZWUDLQLQJV.DEXOKDVEHFRPHPRVWXUEDQL]HGDQGZKHUHPRVWHGXFDWHGZRUNHUVÀQGMREVLQWKH FLW\$QRWKHUGLIÀFXOW\LQWKHRSHUDWLRQLQ.DEXOLVWKHUHVSRQGHQWV·XQZLOOLQJQHVVWRFRRSHUDWHZKLFKLV FRPPRQZKHQXQGHUWDNLQJDVXUYH\LQDQXUEDQVHWWLQJDVXUEDQGZHOOHUVGRQRWHDVLO\WUXVWVWUDQJHUV 6RPHSDUWVRIWKHSURYLQFHZHUHDOVRFRQVLGHUHGLQVHFXUH %XWWKURXJKDOOWKRVHFKDOOHQJHVZHZHUHDEOHWRRYHUFRPHDQGVHHWKHIUXLWRIKDUGODERU:HQRZ KDYHLQIRUPDWLRQDERXW.DEXO3URYLQFHWKDWZLOOVHUYHDVEDVHVLQGHVLJQLQJTXDOLW\SURJUDPPHVIRUWKH FLWL]HQU\7KHVHGDWDVSHDNRIWKHWUXHHFRQRPLFDQGVRFLDOSLFWXUHRIWKHSURYLQFHWKDWPD\VHUYHDV