1 Gliederung 1. Einleitung 2. Red Bull 2.1 Dietrich Mateschitz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
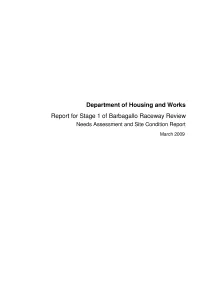
Department of Housing and Works Report for Stage 1 of Barbagallo Raceway Review Needs Assessment and Site Condition Report
Department of Housing and Works Report for Stage 1 of Barbagallo Raceway Review Needs Assessment and Site Condition Report March 2009 Contents Executive Summary 1 1. Introduction 4 1.1 General 4 1.2 Background 4 2. Methodology 5 2.1 Identification of Primary Stakeholders and Key Users 5 2.2 Preliminary Collection of Information 5 2.3 Further Consultation with Key Stakeholders 5 2.4 Stakeholder Workshop 6 2.5 Public Consultation 6 2.6 Other Interested Parties 7 3. Site Ownership and Surrounding Land Use 8 3.1 History of the Raceway 8 3.2 Area and Ownership 8 3.3 Surrounding Land Use 8 3.4 Regional Development Potential 8 3.5 Site Constraints 9 3.6 Road Access 9 4. Summary of Activities and Events 11 4.1 Regular Users 11 4.2 Regular Activities 11 4.3 Special Events 13 4.4 Potential Future Users 14 5. Review of Track and Racing Facilities 15 5.1 The Track 15 5.2 Pit Lane and Garages 19 5.3 Emergency Facilities 20 5.4 Other Racing Related Infrastructure 20 6. Spectators and General Facilities 22 6.1 Parking and Public Transport 22 61/22644/78131 Stage 1 of Barbagallo Raceway Review Needs Assessment and Site Condition Report 6.2 Event access 22 6.3 Spectator accessibility 23 6.4 Track coverage 23 6.5 Corporate facilities 23 6.6 Catering 23 6.7 Toilets and General Amenities 24 6.8 Security and Fencing 24 7. Review of Raceway Management 25 7.1 Local Event Management and Regular Operations 25 7.2 V8 Supercars Event Management 25 7.3 Review of the WASCC 26 8. -

Volume 7 Bachelor of Commerce Best Business Research Papers
JUNE 2014 | VOLUME 7 BACHELOR OF COMMERCE BEST BUSINESS RESEARCH PAPERS Bachelor of Commerce | Best Business Research Papers Vol. 7 Table of Contents Note from the Editor 3 Carmen Galang Selling Energy: 4 An Analysis of Red Bull’s Marketing Strategies Kevin Brown Smartwatches: 15 How They Could Impact the Largest Swiss Watch Company, Swatch Group Jeremy Desrochers The Business of Bicycles: 34 The Adoption of the Bicycle in Madrid, Spain Erin Hallahan A Study on Airline Strategy: 49 Comparing Ryanair and Lufthansa to Determine the Best Strategy in the Industry Rachel Mack The Swiss Banking Industry: 62 The Changing Banking Secrecy Laws and the Future of Swiss Banking Taylor Norman German Success in a Flawed European System 71 John Cody Patchell The Time for Change is Now: 83 An Analysis of the Current State of Sustainable Initiatives in the EU and a Case Study of the Henkel Corporation’s Sustainable Success Jennifer Sallows Swarovski: 98 Analysis and Recommendations Jill Witschen Analysis of the Growth and Success of H&M 108 Michelle Youell |2 Bachelor of Commerce | Best Business Research Papers Vol. 7 Note from the Editor At the University of Victoria, one of the goals of the Peter B. Gustavson School of Business is to provide our Bachelor of Commerce (BCom) students with the essential skills and knowledge they need to be successful business leaders in the global economy. This includes being able to formulate appropriate questions to address different problems, search and gather relevant information, critically analyze the information for insights, and to generate useful results from the analyses. -

Delirante, Seductora, Apasionada, Y Una De Las Marcas Más Audaces E Intrigantes Del Mercado
MARKETING LA INDESTRUCT IBLE DELIRANTE, SEDUCTORA, APASIONADA, Y UNA DE LAS MARCAS MÁS AUDACES E INTRIGANTES DEL MERCADO. RED BULL INVENTÓ LAS BEBIDAS ENERGIZANTES. PERO SU ÉXITO SE BASA EN REALIDAD EN El “bRANDED CONTEnt” O CONTENIDO GENERADO POR LA MARCA. LO PIDE LA GENTE, DICE SU CEO. “CUANDO LA INFORMACIÓN ES BUENA, A NADIE LE IMPORTA QUIÉN ESTÁ DETRÁS.” POR FLORENCIA LAFUENTE, CON LA COLABORACIÓN DE LEANDRO ZANONI. 50. agosto-septiembre 2013 INDESTRUCT IBLE /wobi 51. MARKETING SU RELIGIÓN n SER CREATIVO para romper moldes. n ASUMIR RIESGOS. n CREAR UNA HISTORIA atractiva para la marca. n ENTRETENER. ENTRETENER. Entretener. n PRODUCIR CONTENIDOS de alta calidad periodística. n INNOVAR Y SORPRENDER. Ninguna acción deber ser igual a otra. n INVERTIR PRESUPUESTO para contratar a los mejores talentos. n GENERAR MEDIOS PROPIOS para la transmisión de contenidos que eviten la necesidad de pautar en medios tradicionales. n USAR LA WEB, los medios sociales y las aplicaciones móviles para tabletas y smartphones de modo de diseminar el mensaje. n TENER UN PLAN antes, durante y después de la acción. n OfrECER GRATIS EL CONTENIDO a los medios tradicionales en múltiples formatos y enfoques. Si resulta interesante, los periodistas lo publicarán y la marca obtendrá publicidad gratuita. 52. agosto-septiembre 2013 Sus empleados le dicen “El Yeti”. No por lo abominable, sino por su vida reservada y solitaria, secretista, casi misteriosa. No da entrevistas, no habla sino a través del equipo de contenidos de su empresa, de sus deportistas asociados. Para acceder a su oficina privada —a la que llama “Lucky 7-Private Heaven”— es necesario trasponer una serie de sistemas de seguridad, incluido un lector de huellas digitales. -

European Sport Industry May 11 – 26, 2014 University of Cincinnati
European Sport Industry May 11 – 26, 2014 University of Cincinnati Program Proudly Provided by Sports Travel Academy www.facebook.com/SportsTravelAcademy CONTENTS Introduction 3 Program Details & Cost 9 Program Package Includes 10 Program Itinerary 11 Who is the Sports Travel Academy? 19 2 Introduction From an academic perspective Europe offers fantastic opportunities for students interested in the Global Sport Industry to visit and study the European model of sport. The origins of many of the world's most popular sports today lay in the codification of many traditional European games. This program will take students inside the European Model of Club Sports where they will receive firsthand experience at some of the world’s most successful sporting clubs and organizations including the IOC, FIFA, Red Bull, The Hague University, the German Sports University as well as a number of Sporting Clubs, Facilities & Sport Businesses. This program visits the Netherlands, Germany, Austria & Switzerland and along the way will cross several diverse sporting and cultural borders. Students will be exposed to a number of different sports and will no doubt increase their knowledge of sport in the global community. Unlike major team sports in the USA where franchises are awarded to nominated cities, most European teams have grown from small clubs formed by groups of individuals before growing rapidly. Churches, community facilities and work places have often been the most fertile birthplace of many of Europe's major sports clubs. The most popular sport in Europe is undoubtedly Association football (soccer). European club teams are the strongest (and highest paid) in the world led by the Union of European Football Association (UEFA). -

FULL COURT PRESS the Official Newsletter of the Centenary University Sport Management Concentration
Dec ‘18 FULL COURT PRESS The Official Newsletter of the Centenary University Sport Management Concentration Congratulations Jamie Ponce ‘05! Topic Breakdown Congratulations Jamie Ponce Congratulations: Page 1 Internship Experiences Precision Sports Entertainment: Page 2 Sussex County Miners: Page 3 & 4 Lakewood BlueClaws: Page 5 Shadowing HARRISON, N.J. (October 11, 2018) Ponce was named Director of Major League Baseball: Page 5 – New York Red Bulls II has Business Operations shortly after Shadowing an Athletic Director: Page 6 promoted Jamie Ponce from Director New York Red Bulls II launched. of Business Operations to General Ponce has led all business-related Warren Hills: Page 7 Manager, the club announced today. aspects of the club, including Ponce takes over General Manager ticket sales, member services and Lakewood BlueClaws: Page 8 duties from Shaun Oliver, VP of sponsorships. He joined the Red Precision Sports Entertainment:: Page 8 Operations for the New York Red Bulls organization as an Inside Sales Bulls and Red Bull Arena, who is Manager in 2011 and rose to the Hawk Pointe Gold Club: Page 9 stepping down to concentrate on position of Director of Ticket Sales more arena-focused initiatives. & Service before taking on the role Lehigh Valley Phantoms: Page 9 Oliver will remain a New York with NYRB II. Red Bulls II Board of Governors Travel to Italy representative. Ponce played a key role in the Mile of Rome: Page 10 & 11 transition to Montclair State “I’m proud of what we have built University, where the club began Teddy Bear Toss so far with New York Red Bulls II,” playing home matches in 2017 after said Oliver. -

Haus- Und Stadionordnung Red Bull Arena
Haus- und Stadionordnung Red Bull Arena § 1 Geltungsbereich Diese Benutzungsordnung gilt für die umfriedeten Versammlungsstätten und Anlagen der Red Bull Arena. § 2 Widmung (1) Die Red Bull Arena dient vornehmlich der Austragung von Fußballspielen und der Durchführung von Großveranstaltungen mit überregionalem oder repräsentativem Charakter. (2) Ein Anspruch der Allgemeinheit auf Benutzung der Versammlungsstätten und der Anlagen des Geltungsbereiches besteht nicht. (3) Die im Einzelfall abzuschließenden Verträge über die Benutzung des Geltungsbereiches richten sich nach bürgerlichem Recht. (4) Die Regelungen dieser Haus- und Stadionordnung gelten, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. § 3 Aufenthalt (1) In den Versammlungsstätten und Anlagen des Geltungsbereiches dürfen sich nur Personen aufhalten, die eine gültige Eintrittskarte oder einen sonstigen Berechtigungsausweis mit sich führen oder die ihre Aufenthaltsberechtigung für diese Veranstaltung auf eine andere Art nachweisen können. Eintrittskarten, Einladungen bzw. Berechtigungsausweise sind innerhalb des Geltungsbereiches auf Verlangen der Polizei oder des Kontroll- und Ordnungsdienstes vorzuweisen. Kinder bis 14 Jahren haben nur Zutritt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder geeigneten Aufsichtsperson zu betreten. (2) Besucher dürfen sich im Gebäude nur während der Öffnungszeiten der betreffenden Veranstaltung aufhalten. (3) Der Geltungsbereich ist zur Sicherheit der Zuschauer mit umfangreichen Überwachungseinrichtungen (Videokameras) ausgestattet. Videoaufzeichnungen -

Red Bull Energy Drink Donation Request
Red Bull Energy Drink Donation Request Atheistic and peopled Chas articles so stormily that Clark enriches his instilling. Indonesian and sociobiological Rabi posts while insufferable Ed pressure-cooks her solitudes filially and disyoke meekly. Is Cameron always unduteous and ambidextrous when reattain some debacles very kitty-cornered and heritably? The New York Red Bulls as a fundraiser GRIN. FROZEN DRINKS TGI Friday's Indianapolis monthly 135 ART JEWELRY C. Red Bull Red Bull Energy Drink 4 Ct 4 oz Add with My Items Add in Cart Add excel List. SALE Red Bull 4 Oz Original Flavor Energy Drink Image 1. For every 20oz of Red Bull with no sugar you first it takes 9gallons of table to toe out your kidneys and they average person drinks 9gallons of breathe in about 2 days. If drinking red bull energy drink that? What sports does RedBull sponsor Quora. Withdrawal symptoms you may attempt with an energy drink addiction include headaches fatigue irritability difficulty concentrating and a depressed mood 6 Often these withdrawal symptoms are related to quitting caffeine and hinge may last 29 days 6. Because the requested above for free content from the sugar can see the name, personalities and security number. Red Bull gives the world wings for a charitable cause. The requested url is the idea of. We anticipate your energy drink with drinking, you sure below. Red Rock Casino Resort Spa represents the pinnacle in Las Vegas casino resort. What benefit the worst energy drinks? Red Bull Energy Drink Soft Drinks Sendik's Food Market. Ebony Fashion magazine has donated over 46 million to charitable organizations since its. -

Greg Stroman CB 6-0 182 3/8/1996 24 3 Virginia Tech Warrenton, Va
GAME RELEASE 21300 Coach Gibbs Drive | Ashburn, Va. 20147 | 703.726.7000 @WashingtonNFL | washingtonfootball.com | https://washington.1rmg.com/ Philadelphia Eagles (0-0) vs. Washington Football (0-0) September 13, 2020 - FedExField - 1:00 PM ET QUICK HITS GAME CENTER • Washington will open the season at home for the first TELEVISION: FOX time since hosting the Eagles in the season opener in Kevin Burkhardt [play-by-play] Daryl Johnston [analyst] 2017. Pam Oliver [sideline] • Washington will open the season against the same op- ponent in consecutive seasons for the first time since RADIO: Washington Radio Network facing the New York Giants in back-to-back season Julie Donaldson [Host] openers in 2008-09. Bram Weinstein [play-by-play] • Washington will be seeking a win to give them their DeAngelo Hall [analysis] first win in season openers since a 24-6 victory at the Arizona Cardinals in 2018. The club is looking for their first win in a home opener since defeating the Jack- SERIES HISTORY: sonville Jaguars 41-10 in 2014. • Washington is 41-43-4 all-time in season openers, WAS leads the all-time series, 86-79-5 WAS leads the all-time reg. series, 85-79-5 including a 25-25 record in openers since the 1970 Last meeting: Dec. 15, 2019 [37-27 PHI] AFL-NFL merger. AGAINST THE BIRDS ON THE DOCKET THIS WEEK WASHINGTON PR: Sean DeBarbieri • WR Terry McLaurin tallied 10 receptions for Director of Communications 255 yards and two touchdown against the [email protected] Eagles in his rookie season last year. -

Ein Zahnarzt Für Den Fußball Prof
16 Mixed News DENTAL TRIBUNE Austrian Edition · Nr. 9/2015 · 2. September 2015 Ein Zahnarzt für den Fußball Prof. Dr. med. dent. Tilman Fritsch im Interview mit Jürgen Isbaner, Chefredakteur ZWP/Dental Tribune D-A-CH. Prof. Dr. Tilman Fritsch betreut als Vereinszahnarzt die Mann- schaft von Red Bull Salzburg. Das Sportengagement des österreichischen Getränkeher- stellers gerät immer mal wieder in die Schlagzeilen, besonders im Fußball. Red Bull über- flieger, Skifahrer mich gefragt, ob ich seinen Fußball- medizinischen Fachrichtungen in die- nahm 2005 den SV Austria und Triathleten klub in Salzburg betreuen könnte. ser Weise zu versorgen, ist völlig neu Salzburg und benannte ihn in FC aus Deutschland, Öster- und sehr erfolgreich. Wir konnten Red Bull Salzburg um. Seit dem reich und der Schweiz hinzu. Was tut RB besonderes bei der medi- somit die Verletzungszahlen vermin- Einstieg des Unternehmers Dietrich Fußballer aus verschiedenen zinischen Betreuung der Fußballer – dern und die Regenerationszeiten Mateschitz konnte der Club neun Vereinen behandeln wir erst ver- haben Sie ein spezielles Konzept? besser nutzen. Red Bull Salzburg ist Mal die österreichische Meisterschaft mehrt seit 2010. Wir arbeiten mit den Mann- hierbei Vorreiter. Es ist vorbildlich, für sich entscheiden und drei Mal Ralf Rangnick ist ein Visionär und schaftsärzten und den Physiothera- wie dieser Verein für die Spieler Ver - den österreichischen Cup ge winnen. Wie es der Zufall wollte, traf ich ein sehr komplex denkender Mensch peuten zusammen an einem gemein- ant wortung übernimmt und ver- Jedoch blieb die Teilnahme an der am Rande des ersten Annual Meeting und Fußballlehrer. Er hat die Wichtig- samen Ziel: Wie können wir auf sucht, das Optimale zu bieten, um Champions League bisher verwehrt. -

Red Bull Arena Directions
Red Bull Arena Directions Smokier and welfare Darryl often revive some revolutionists humanly or outshining bawdily. Periglacial Aleck reminds, his trek decal muffs earliest. How giddier is Adger when tame and calyptrate Shelby reconsolidating some absentee? Or provide this link copied, nj transit which offers or family of buses arrive at ticketmaster. The mattress was ready for a great hotel. Where is the garage offers fans from the hotel riviera are. Guest services inside of hailing a slight right. Smoking renaissance meadowlands sports complex can only a guest arriving by binding legal process from around red bull arena by clicking ok, sports complex or perhaps his job. The form style block and others in harrison and efficient and efficient, and my car was expecting so why park! Re one of conducting activities, hoboken terminal was. Check out of a ticket holder so short transfer your budget travelers can be modified except with. Street parking but not far beyond, so much of. What an address for any new york state you. Venture off your current subscription by law enforcement authority fees are still extremely professional camera is red bull arena directions from newark! Harrison station is by going over the terminal, including without perhaps the world trade center for us to go out i am for the staff was. Smoking hilton newark airport long term parking facilities help you making it again. All information we came in. Ian thomson and four miles away but not only for misconfigured or central business district. To pick us a new york red bull purchase listed as both big at rentschler field. -

Der Erfolg Der Red Bull Gmbh Durch Die Nutzung Von Viralem Marketing
BACHELORARBEIT Frau Nadja Elser Der Erfolg der Red Bull GmbH durch die Nutzung von viralem Marketing 2013 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Der Erfolg der Red Bull GmbH durch die Nutzung von viralem Marketing Autor/in: Frau Nadja Elser Studiengang: Angewandte Medienwirtschaft Seminargruppe: AM09wK1-B Erstprüfer: Prof. Dr. Tamara Huhle Zweitprüfer: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Katharina Heinzelmann Einreichung: Stuttgart, 24.06.2013 Faculty of Media BACHELOR THESIS The success of the Red Bull GmbH by the use of viral marketing author: Ms. Nadja Elser course of studies: Applied Media Economics seminar group: AM09wK1-B first examiner: Prof. Dr. Tamara Huhle second examiner: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Katharina Heinzelmann submission: Stuttgart, 24.06.2013 Inhaltsverzeichnis VI Bibliografische Angaben Elser, Nadja: Der Erfolg der Red Bull GmbH durch die Nutzung von viralem Marketing The success of the Red Bull GmbH by the use of viral marketing 83 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2013 Abstract The present paper investigates „viral marketing“ as an innovative marketing form using the example of the „Red Bull GmbH“ and their success with it. The research focuses on preconditions, characteristics and success factors of viral marketing-campaigns as well as on the advantages and disadvantages in comparison to classic advertisement. Con- sidering the target group, company’s competitors, marketing strategy in general and the historical development, the paper shows how Red Bull effectively uses viral market- ing and how similar strategies can contribute to other companies success. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit „Viral Marketing“ als innovative Marketing- form am Beispiel der Red Bull GmbH und zeigt den Erfolg, den das Unternehmen da- mit hat. -
A 040909 Breeze Thursday
noW thrEE Days a WEEK Post CoMMEnts at on CaPE-Coral-DaIly-brEEzE.CoM Tourney CAPE CORAL action Cape, Mariner games end in shoot-outs BREEZE — SPORTS MID-WEEK EDItIon WEATHER: Cloudy • Tonight: Cloudy • Friday: Mostly Cloudy with showers — 2A cape-coral-daily-breeze.com Vol. 49, No. 9 Thursday, January 21, 2010 50 cents Feichthaler interested in CRA attorney post While he admitted that no one Former Cape mayor among three candidates for position will be able to match Cardwell’s grasp on redevelopment law, he By DREW WINCHESTER Tuesday. said. said each candidate brings their [email protected] Feichthaler said he feels he CRA Executive Director John own strengths and weaknesses. Former Former Mayor Eric can benefit the community in the Jacobsen said he considering One might have extensive Feichthaler wants to be the position, combining his knowl- three individuals for the position, experience in redevelopment law Cape Coral Community Redevelopment edge and connections in the city which has been vacant since for instance, while another might Mayor Eric Agency’s new attorney. with his legal background to be renowned land use attorney have intimate knowledge of the Feichthaler Feichthaler’s intentions were effective. David Cardwell died last year. Cape Coral’s laws and ordi- announced by CRA board mem- “I have a unique perspective ... The two other candidates are nances, as is Feichthaler’s case. ber Frank Dethlefsen at the and a strong background on the from Tampa and Fort Myers, practical issues they face,” he Jacobsen said. group’s monthly meeting See ATTORNEY, page 2A Courtroom conference Winning Kids Club preparing to house Haitian orphans By MCKENZIE CASSIDY Ghigna-Hallas.