MEU Sudan 01 Titelei
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
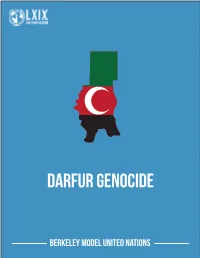
Darfur Genocide
Darfur genocide Berkeley Model United Nations Welcome Letter Hi everyone! Welcome to the Darfur Historical Crisis committee. My name is Laura Nguyen and I will be your head chair for BMUN 69. This committee will take place from roughly 2006 to 2010. Although we will all be in the same physical chamber, you can imagine that committee is an amalgamation of peace conferences, UN meetings, private Janjaweed or SLM meetings, etc. with the goal of preventing the Darfur Genocide and ending the War in Darfur. To be honest, I was initially wary of choosing the genocide in Darfur as this committee’s topic; people in Darfur. I also understood that in order for this to be educationally stimulating for you all, some characters who committed atrocious war crimes had to be included in debate. That being said, I chose to move on with this topic because I trust you are all responsible and intelligent, and that you will treat Darfur with respect. The War in Darfur and the ensuing genocide are grim reminders of the violence that is easily born from intolerance. Equally regrettable are the in Africa and the Middle East are woefully inadequate for what Darfur truly needs. I hope that understanding those failures and engaging with the ways we could’ve avoided them helps you all grow and become better leaders and thinkers. My best advice for you is to get familiar with the historical processes by which ethnic brave, be creative, and have fun! A little bit about me (she/her) — I’m currently a third-year at Cal majoring in Sociology and minoring in Data Science. -

Spotlight on Sudan
REGIONAL PROGRAM POLITICAL DIALOGUE SOUTH MEDITERRANEAN FOREWORD At the crossroads between Sub-Saharan Africa, North Africa and the Arabian Peninsula, Sudan is keeping pace with the political developments of the entire region. Yet, little studied, the country is not very visible to research institutions and think tanks due to difficult access to information. The recent developments that have brought Sudan to the forefront have also highlighted the extent to which this country of 42 million inhabitants has its destiny linked to the countries on the southern Mediterranean. Indeed, from the sending of Sudanese militiamen to Libya to the discussions on normalization with Israel through the numerous transactions with the Egyptian neighbor, Sudan is a country that impacts the southern Mediterranean in a deep and constant way. Furthermore, in addition to the internal ongoing conflicts, Sudan has found itself in the middle of the Nile river dispute between Ethiopia and its north African neighbor Egypt. Faced with this, and following a common reflection, the Regional Program Political Dialogue South Mediterranean of the Konrad-Adenauer-Stiftung decided to open its geographical scope to Sudan and develop more knowledge about this country through various events and programs. SPOTLIGHT ON SUDAN In this sense, our regional program elaborated this study striving to highlight the recent developments in Sudan, its impact on the country’s neighbors and the geopolitical situation. Thomas Volk Director Regional Program Political Dialogue South Mediterranean -
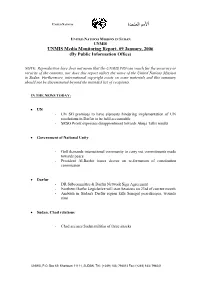
UNMIS Media Monitoring Report, 02 January, 2006
أﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة UNITED NATIONS UNITED NATIONS MISSION IN SUDAN UNMIS UNMIS Media Monitoring Report, 09 January, 2006 (By Public Information Office) NOTE: Reproduction here does not mean that the UNMIS PIO can vouch for the accuracy or veracity of the contents, nor does this report reflect the views of the United Nations Mission in Sudan. Furthermore, international copyright exists on some materials and this summary should not be disseminated beyond the intended list of recipients. IN THE NEWS TODAY: • UN - UN SG promises to have elements hindering implementation of UN resolutions in Darfur to be held accountable - SRSG Pronk expresses disappointment towards Abuja Talks results • Government of National Unity - GoS demands international community to carry out commitments made towards peace - President Al-Bashir issues decree on re-formation of constitution commission • Darfur - DR Subcommittee & Darfur Network Sign Agreement - Northern Darfur Legislative will start Sessions on 23rd of current month - Ambush in Sudan's Darfur region kills Senegal peacekeeper, wounds nine • Sudan, Chad relations - Chad accuses Sudan militias of three attacks UNMIS, P.O. Box 69, Khartoum 11111, SUDAN. Tel.: (+249) 183- 794013 Fax: (+249) 183- 794041 • East - Some Biga Congress Members demand quit of six leaders from Organization • Other Developments - Kiir congratulates SPLA & SSDF forces for merger - New SSDF Leadership May Declare Today - Garang helicopter crash parts sent to US for testing - Sudan peace still fragile year after north-south deal - Clandestine nuclear deals traced to Sudan - Ex Lost boy Jal performs at UN’s CPA celebrations HIGHLIGHTS: UN UN SG promises to have elements hindering implementation of UN resolutions in Darfur to be held accountable (Al-Ayaam, 9 Jan, 06, Khartoum) The Secretary-General of the United Nations, Mr. -

New Orleans and the LRA
Lighting The Road To Freedom Data Zone Page 13 Emmanuel Jal: Soldier For Peace “The People’s Paper” October 7, 2006 40th Year Volume 36 www.ladatanews.com The Soul of New Orleans A Long Road Home: New Orleans and the LRA Page 3 Newsmaker Congressional Race Heats Up Amaju Barak to speak Inside Data| at Tulane Page 6 Page 5 4HEULTIMATETRIPFORTHEULTIMATECIRCLEOFFRIENDS Pack your bags and go in style with the Girlfriends L.A. Getaway. Enter for your chance to win a trip to glamorous Los Angeles, California. Plus sensational sights, shopping and spa treatment for you and three of your best girls! come and get your loveSM SM— call anyone on any network for free. Visit alltelcircle.com for details. Alltel Retail Stores These Retail Stores Now Open Sunday. Authorized Agents Equipment & promotional offers at these locations may vary. Covington Kenner Slidell Destrehan LaPlace Nationwide Comm. Marrero Metairie 808 Hwy. 190, Ste. B 1000 W. Esplanade Ave. 1302 Corporate Sq., Ste. 2016 NexGeneration Superior Comm. 2003 Florida St. V. Telecom Bobby April Wireless (985) 893-7313 (504) 468-8334 (985) 847-0891 12519 Airline Hwy. 1819 W. Airline Hwy. (985) 626-1282 5001 Lapalco Blvd. 1700 Veterans blvd., Ste. 300 (985) 764-2021 (985) 652-6659 (504) 349-4912 (504) 835-9600 Houma Larose Shop at a Participating 1043 W. Tunnel Blvd. 115 W. 10th St. Gretna Mandeville (985) 851-2355 (985) 798-2323 Cell Phone Depot Nationwide Comm. 2112 Belle Chase Hwy., Ste. 2 1876 N. Causeway Blvd. Official Wireless Provider Proud Sponsor of: Southland Mall Metairie (504) 433-1921 (985) 626-1272 5953 W. -

International Human Rights Law Fall 2014
International Human Rights Law Fall 2014 Supplementary Readings (Supp.) Professor Schnably Contents Human Rights Committee, General Comment 20: Article 7 (Forty-fourth session, 1992), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 151 (2003). ..................................................... 1 Atul Gawande, Hellhole: The United States holds tens of thousands of inmates in long-term solitary confinement. Is this torture? THE NEW YORKER, March 30, 2009 .......................................... 4 Yash Ghai, Universal Rights and Cultural Pluralism: Universalism and Relativism: Human Rights as a Framework for Negotiating Interethnic Claims, 21 CARDOZO L. REV. 1095 (2000) ................................................................................................................................................... 16 Abdullahi Ahmen An-Na’im, Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives, 3 HARV. HUM. Rts. J. 13 (1990) .............................................................. 23 Materials and Questions on Cultural Relativism ........................................................................................ 29 Geoffrey Cowley, Gender Limbo, Newsweek, May 19, 1997, at 64 .......................................................... 32 UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating to Female Genital Mutilation, May 2009 (excerpts) ............................................................................................................................................. -

Safeguarding Sudan's Revolution
Safeguarding Sudan’s Revolution $IULFD5HSRUW1 _ 2FWREHU +HDGTXDUWHUV ,QWHUQDWLRQDO&ULVLV*URXS $YHQXH/RXLVH %UXVVHOV%HOJLXP 7HO )D[ EUXVVHOV#FULVLVJURXSRUJ Preventing War. Shaping Peace. Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. From Crisis to Coup, Crackdown and Compromise ......................................................... 3 III. A Factious Security Establishment in a Time of Transition ............................................ 10 A. Key Players and Power Centres ................................................................................. 11 1. Burhan and the military ....................................................................................... 11 2. Hemedti and the Rapid Support Forces .............................................................. 12 3. Gosh and the National Intelligence and Security Services .................................. 15 B. Two Steps Toward Security Sector Reform ............................................................... 17 IV. The Opposition ................................................................................................................. 19 A. An Uneasy Alliance .................................................................................................... 19 B. Splintered Rebels ...................................................................................................... -

Violations of Articles 4 and 5
ALTERNATIVE REPORT To Sudan’s Periodic Report Before the 43rd Session of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (Swaziland, May 2008) Introduction……………………………………………………………………………………………………. ……… 2 The Situation in Relation to Articles 4 and 5………………………………………….……………...................... 3 The Situation in Relation to Article 6………………………………………………………………….………......... 9 The Situation in Relation to Articles 7 and 26……………………………………………………………………… 12 The Situation in Relation to Article 9………………………………………………………………………….......... 16 The Situation in Relation to Articles 10 and 13……………………………………………………………………. 23 The Situation in Relation to Article 11………………………………………………………………………………. 27 The Situation in Relation to Article 18………………………………………………………………………………. 28 Recommendations……………………………………………………………………………………………………. 33 Glossary………………………………………………………………………………………………………………... 35 SOAT is supported by and is a member of the International Federation for Human Rights (FIDH) SOAT, Alternative Report to the African Commission on Human and Peoples’ Rights, May 2008 1 Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Introduction Punishment (CAT), and the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). As a signatory to Sudan ratified the African Charter on Human and these acts, Sudan is bound to refrain from acts which Peoples’ Rights (ACHPR) on 18 February 1986. The would defeat their object and purpose. Sudanese government is therefore obliged to respect and protect the internationally recognised human Three years after the signing of the CPA, very little rights -

The Case of the Sudan's Power Relations
American University in Cairo AUC Knowledge Fountain Theses and Dissertations 6-1-2015 A Prince and a Fractured Kingdom: The Case of the Sudan’s Power Relations Jihad Salih Mashamoun Follow this and additional works at: https://fount.aucegypt.edu/etds Recommended Citation APA Citation Salih Mashamoun, J. (2015).A Prince and a Fractured Kingdom: The Case of the Sudan’s Power Relations [Master’s thesis, the American University in Cairo]. AUC Knowledge Fountain. https://fount.aucegypt.edu/etds/63 MLA Citation Salih Mashamoun, Jihad. A Prince and a Fractured Kingdom: The Case of the Sudan’s Power Relations. 2015. American University in Cairo, Master's thesis. AUC Knowledge Fountain. https://fount.aucegypt.edu/etds/63 This Thesis is brought to you for free and open access by AUC Knowledge Fountain. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of AUC Knowledge Fountain. For more information, please contact [email protected]. The American University in Cairo School of Humanities and Social Sciences A Prince and a Fractured Kingdom: The Case of the Sudan’s Power Relations A Thesis Submitted to The Political Science Department In partial fulfillment of the requirements for A Master of Arts Degree By Jihad Salih Mashamoun Under the supervision of Dr. Nadia Farah April 30,2015 Table of Contents Dedication……………………………………………………………………………v Acknowledgments…………………………………………………………………...vi Acronyms………………………………………………………………………………………….. vii Abstract……………………………………………………………………………...xi Introduction…………………………………………………………………………...1 -
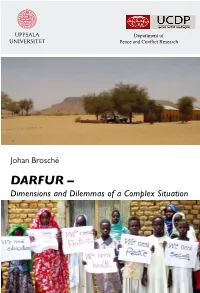
DARFUR – Dimensions and Dilemmas of a Complex Situation Johan Brosché
Department of Peace and Conflict Research Johan Brosché DARFUR – Dimensions and Dilemmas of a Complex Situation Johan Brosché DARFUR – Dimensions and Dilemmas of a Complex Situation Uppsala University Department of Peace and Conflict Research UCDP Paper No. www.ucdp.uu.se Department of Peace and Conflict Research Uppsala University Box 51 S 751 0 Uppsala Sweden www.pcr.uu.se Darfur– Dimensions and Dilemmas of a Complex Situation Copyright © 2008 Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University. All rights reserved. Cover photos: ©Johannes Saers, all rights reserved Cover design, layout and typesetting: Maria Wold-Troell Printed in Sweden by Universitetstryckeriet, Uppsala, 2008 ISBN 978-91-506-1991-1 Table of Contents Acknowledgements ............................................................................................ ......... i Executive Summary .....................................................................................................................ii Policy recommendations ...........................................................................................................v Acronyms ...................................................................................................................................viii 1. Introduction ........................................................................................................1 . Backgound and Comprehensive View of Sudan .......................................... Background on Sudan .................................................................................. -

What the Warrant Means Justice, Peace, and the Key Actors in Sudan
What the Warrant Means Justice, Peace, and the Key Actors in Sudan By Enough Team February 12, 2009 The issuance of an arrest warrant for Sudan’s sitting head of state for crimes against humanity offers the Obama administration a chance to catalyze multilateral efforts to bring about a solu- tion to Sudan’s decades-long cycle of warfare. One of the crucial missing ingredients to conflict resolution efforts has been some form of accountability for the horrific crimes against human- ity that have been perpetrated by the warring parties in Sudan, primarily the Khartoum regime. Peace without justice in Sudan would only bring an illusion of stability without addressing the primary forces driving the conflict. The decision by the Pre-Trial Chamber of the International Criminal Court, or ICC, to issue an arrest warrant for Sudanese President Omar al-Bashir is unsurprising given the long pattern of profound abuses in Sudan directed from the highest echelons of government. Over the past several weeks, President Bashir has escalated violence in Darfur and increased human rights violations in Khartoum in a last-ditch effort to force the United Nations Security Council to defer the ICC’s investigation for one year “in the interest of peace.”1 However, as Enough argued when ICC Chief Prosecutor Luis Moreno Ocampo requested the warrant in July 2008, the prior indictments of former Liberian President Charles Taylor and former Serbian President Slobodan Milosevic demonstrate that the pursuit of justice can be a catalyst for peace—if the international community stands resolutely behind efforts to promote accountability for genocide and crimes against humanity.2 The situation in Sudan is no different. -

Sudan: a Political Marketplace Analysis
Sudan: A Political Marketplace Framework Analysis ALEX DE WAAL OCCASIONAL PAPER OVERVIEW: Sudan’s Predicament NO. 19 This paper provides a succinct analysis of Sudan as a politi- AUGUST 2019 cal marketplace. It assumes a working knowledge of the basic principles of the political marketplace framework (PMF). It The World Peace Foundation, an does not offer a policy recommendation, but rather a frame- work for analyzing the Sudanese predicament so as to under- - stand the implications of different courses of action. operating foundation affiliated with the Fletcher School at Tufts Uni- The basic predicament facing Sudan’s rulers today—irrespective versity, aims to provide intellectual- of whether they are soldiers, paramilitaries, civilian technocrats leadership on issues of peace, jus or civilian politicians—is that they have neither the material re- tice and security. We believe that in sources nor the skills and reputation to manage a political mar- novative research and teaching are ketplace based on mercenarized paramilitarism and crony capi- critical to the challenges of making talism, but also do not have the means to transform it. peace around the world and should- go hand-in-hand with advocacy and The alliance of forces supporting the Declaration of Freedom and practical engagement with the tough Change (hereafter FFC), along with some army generals in the Su- est issues. To respond to organized dan Armed Forces (SAF), and the majority of African and western violence today, we not only need new nations, aspire for a transition to an institutionalized and demo- instruments and tools—we need a cratic state. According to the PMF analysis that is not in prospect. -

Download the Report Here
Cover: Sudanese President Omar al-Bashir. November 23, 2017. Credit: Mikhail Metzel/TASS/Alamy Live News With Friends Like These Strong Benchmarks for Next Phase of U.S.-Sudan Relations By Dr. Suliman Baldo February 2018 Executive Summary The U.S. government’s October 2017 lifting of its comprehensive economic and financial sanctions on Sudan has created the impression that the Sudanese regime of President Omar al-Bashir is evolving into a reliable partner and no longer poses a threat to the national security and foreign policy interests of the United States. This impression is deeply misguided. New circumstances have emerged in Sudan that make U.S. efforts at full normalization dramatically ill-timed. This report attempts to explain those dynamics. If the United States persists in laying out a path to normalization despite the poor timing, below are a series of incentives, pressures, and benchmarks that could potentially contribute to a more constructive process. Through forthcoming talks with the United States, the Sudanese regime seeks its removal from the U.S. State Sponsors of Terrorism list,1 one of the last remaining forms of U.S. sanctions on Sudan. This is significant because it would allow Sudan to seek debt relief at a time when its economy is imploding. Yet, as the Sudan government continues its inconsistent charm offensive aimed at U.S. policymakers, serious concerns linger about Sudan’s true commitment to the fight against international terrorism, its disruptive and erratic foreign policy that includes recent overtures to and military agreements with Russia, its continued role as a regional destabilizer, and its ongoing repression of its people and persecution of minority religious groups, including Christians.