Kirchberger-Informelle Regeln Der Politik in China
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
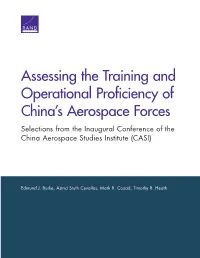
Assessing the Training and Operational Proficiency of China's
C O R P O R A T I O N Assessing the Training and Operational Proficiency of China’s Aerospace Forces Selections from the Inaugural Conference of the China Aerospace Studies Institute (CASI) Edmund J. Burke, Astrid Stuth Cevallos, Mark R. Cozad, Timothy R. Heath For more information on this publication, visit www.rand.org/t/CF340 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9549-7 Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. © Copyright 2016 RAND Corporation R® is a registered trademark. Limited Print and Electronic Distribution Rights This document and trademark(s) contained herein are protected by law. This representation of RAND intellectual property is provided for noncommercial use only. Unauthorized posting of this publication online is prohibited. Permission is given to duplicate this document for personal use only, as long as it is unaltered and complete. Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another form, any of its research documents for commercial use. For information on reprint and linking permissions, please visit www.rand.org/pubs/permissions. The RAND Corporation is a research organization that develops solutions to public policy challenges to help make communities throughout the world safer and more secure, healthier and more prosperous. RAND is nonprofit, nonpartisan, and committed to the public interest. RAND’s publications do not necessarily reflect the opinions of its research clients and sponsors. Support RAND Make a tax-deductible charitable contribution at www.rand.org/giving/contribute www.rand.org Preface On June 22, 2015, the China Aerospace Studies Institute (CASI), in conjunction with Headquarters, Air Force, held a day-long conference in Arlington, Virginia, titled “Assessing Chinese Aerospace Training and Operational Competence.” The purpose of the conference was to share the results of nine months of research and analysis by RAND researchers and to expose their work to critical review by experts and operators knowledgeable about U.S. -

Les Politiques De Développement Régional D'une Zone Périphérique
Les politiques de développement régional d’une zone périphérique chinoise, le cas de la province de Hainan Sébastien Goulard To cite this version: Sébastien Goulard. Les politiques de développement régional d’une zone périphérique chinoise, le cas de la province de Hainan . Science politique. EHESS, 2014. Français. tel-01111893 HAL Id: tel-01111893 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01111893 Submitted on 31 Jan 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES Thèse en vue de l‟obtention du Doctorat en socio-économie du développement Sébastien GOULARD Les politiques de développement régional d’une zone périphérique chinoise, le cas de la province de Hainan Thèse dirigée par François GIPOULOUX, directeur de recherche au CNRS Présentée et soutenue publiquement à l‟École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, le 18 décembre 2014. Membres du jury : François GIPOULOUX, directeur de recherche, -

Journal of Current Chinese Affairs
China Data Supplement March 2008 J People’s Republic of China J Hong Kong SAR J Macau SAR J Taiwan ISSN 0943-7533 China aktuell Data Supplement – PRC, Hong Kong SAR, Macau SAR, Taiwan 1 Contents The Main National Leadership of the PRC ......................................................................... 2 LIU Jen-Kai The Main Provincial Leadership of the PRC ..................................................................... 31 LIU Jen-Kai Data on Changes in PRC Main Leadership ...................................................................... 38 LIU Jen-Kai PRC Agreements with Foreign Countries ......................................................................... 54 LIU Jen-Kai PRC Laws and Regulations .............................................................................................. 56 LIU Jen-Kai Hong Kong SAR ................................................................................................................ 58 LIU Jen-Kai Macau SAR ....................................................................................................................... 65 LIU Jen-Kai Taiwan .............................................................................................................................. 69 LIU Jen-Kai ISSN 0943-7533 All information given here is derived from generally accessible sources. Publisher/Distributor: GIGA Institute of Asian Studies Rothenbaumchaussee 32 20148 Hamburg Germany Phone: +49 (0 40) 42 88 74-0 Fax: +49 (040) 4107945 2 March 2008 The Main National Leadership of the -

Marketing Fragment 6 X 10.5.T65
Cambridge University Press 978-0-521-86940-9 - Legal Reform and Administrative Detention Powers in China Sarah Biddulph Index More information INDEX abuse of power lawfulness of specific administrative act detention for investigation 333 297–8 police (public security organs) 276, 280–1, lawyers and 303–5 312–3, 327, 361, 367 parties administration according to law 240–3, applicant 298–303 365 respondent 303 balance theory 244–5 Party leadership and 314–8 building basis of laws and rules 248–50 procedural issues 306–8 debates over purpose of administrative law scope of litigation and accepting a case 244–5 295–7 flexibility as problem of discretion 246–7 social order policy and 314–18 formalist approaches 243–4 withdrawal of applications 308–12, 327–30 redefining law and its values 250–6 administrative review 294–5, 318–20, 328, constraining scope of MPS rule-making 329 power 251–3 decisions 325 efforts by NPC to increase control over jurisdiction of review organs 324–5 legislation 250–1 lawfulness and appropriateness of specific regularising rule-making 253–5 administrative act 321–2 strengthening supervision over procedures 322–4 rule-making 255–6 scope of review 320–1 rule of law administration 245–6 age limits, Re-education through Labour administrative detention powers 3–6, 94, 149, (RETL) and 206 358–62 Alford, William 18 conceptual framework of study 18–20 Anti-Rightist Campaign 85, 86, 87, 92 continuities and discontinuities between arrest 64 reform and pre-reform era 353–8 asylums 6 institutional mechanisms for policy and rule -

The PLA and the 16Th Party Congress Jiang Controls the Gun? James Mulvenon
Hoover-CLM-5.qxd 6/5/2003 12:36 PM Page 20 The PLA and the 16th Party Congress Jiang Controls the Gun? James Mulvenon For Western observers of the People’s Liberation Army (PLA), the 16th Party Congress presented a curious mixture of the past, the present, and the future. Jiang Zemin’s long-rumored and ultimately successful bid to retain the chairmanship of the Central Military Commission (CMC) brought back memories of party-army relations in the late 1980s before Tiananmen. At the same time, the new crop of PLA leaders elevated to the CMC represents the present and future PLA, possessing high levels of experience, training, and education, and thus professionalism. This article explores the implications of Jiang’s gambit, analyzes the retirements of senior PLA leaders and the biographies of their replacements, and offers some pre- dictions about the choice of defense minister and the future course of Chinese Communist Party (CCP)-PLA relations. JIANG STICKS AROUND If imitation is the highest form of flattery, then Jiang Zemin has given Deng Xiaoping’s boots a real tongue-shine. Recall that at the 13th Party Congress in 1987, confident of his preeminence in the system, Deng retired from all formal positions save one, the chairmanship of the Central Military Commission. His logic at the time was clear.The PLA was still subordinate to party control, but the fresh memory of the breakdown of formal lines of authority during the events in Tiananmen Square told Deng that his continued personal control of the military was crucially important to Jiang Zemin’s successful transition to the leadership core. -

From Textual to Historical Networks: Social Relations in the Bio-Graphical Dictionary of Republican China Cécile Armand, Christian Henriot
From Textual to Historical Networks: Social Relations in the Bio-graphical Dictionary of Republican China Cécile Armand, Christian Henriot To cite this version: Cécile Armand, Christian Henriot. From Textual to Historical Networks: Social Relations in the Bio-graphical Dictionary of Republican China. Journal of Historical Network Research, In press. halshs-03213995 HAL Id: halshs-03213995 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03213995 Submitted on 8 Jun 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. ARMAND, CÉCILE HENRIOT, CHRISTIAN From Textual to Historical Net- works: Social Relations in the Bio- graphical Dictionary of Republi- can China Journal of Historical Network Research x (202x) xx-xx Keywords Biography, China, Cooccurrence; elites, NLP From Textual to Historical Networks 2 Abstract In this paper, we combine natural language processing (NLP) techniques and network analysis to do a systematic mapping of the individuals mentioned in the Biographical Dictionary of Republican China, in order to make its underlying structure explicit. We depart from previous studies in the distinction we make between the subject of a biography (bionode) and the individuals mentioned in a biography (object-node). We examine whether the bionodes form sociocentric networks based on shared attributes (provincial origin, education, etc.). -
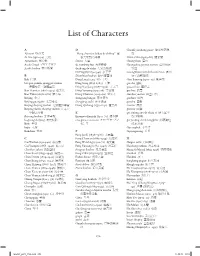
List of Characters
List of Characters A D Guanli yaoshang guize 䭉䎮喍⓮夷 Ajinomi 味の美 “Dang chuntian laidao de shihou” 䔞 ⇯ Ai Xia (1912–34) 刦曆 㗍⣑Ἦ⇘䘬㗪῁ Guan Zilan (1903–86) 斄䳓嗕 Ajinomoto 味の素 Daxue ⣏⬠ Guangzhou ⺋ⶆ Asahi Graph アサヒグラフ da yundong hui ⣏忳≽㚫 Guangzhou guomin xinwen ⺋ⶆ⚳㮹 Asahi shinbun 朝日新聞 dazhong de yishu ⣏䛦䘬喅埻 㕘倆 Di Pingzi (1879–1941) 䉬⸛⫸ Guangzhou nuzi shifan xuexiao ⺋ⶆ B Dianshizai huabao 溆䞛滳䔓⟙ ⤛⫸ⷓ䭬⬠㟉 Bali 湶 Ding Ling (1904–86) ᶩ䍚 Guo Jianying (1907–79) 悕⺢劙 baoguo yumin, qiangguo fumin Ding Song (1891-1969) ᶩあ guochi ⚳」 ᾅ⚳做㮹炻⻟⚳㮹 Ding Wenjiang (1887–1936) ᶩ㔯㰇 guocui hua ⚳䱡䔓 Bao Tianxiao (1876–1973) ⊭⣑䪹 Ding Yanyong (1902-78) ᶩ埵 guohua ⚳䔓 Bao Yahui (1898-1982) 欹Ṇ㘱 Dong Chuncai (1905–90) 吋䲼ㇵ Guohua yuekan ⚳䔓㚰↲ Beijing ⊿Ṕ dongfang bingfu 㜙㕡䕭⣓ guohuo ⚳屐 Beijing guangshe ⊿Ṕ䣦 Dongfang zazhi 㜙㕡暄娴 guoshu ⚳埻 Beijing sheying xuehui ⊿Ṕ㓅⼙⬠㚫 Dong Qichang (1555–1636) 吋℞㖴 Guotai ⚳㲘 Beiping daxue sheying xuehui ⊿⸛⣏ guoxue ⚳⬠ ⬠㓅⼙⬠㚫 E gei xinling zuo de shafa yi 䴎⽫曰⛸ Beiyang huabao ⊿㲳䔓⟙ Enomoto Kenichi (1904-70) 榎本健一 䘬㱁䘤㢭 boguang shuying 㲊㧡⼙ ero, guro, nansensu エロ・グロ・ナン gei yanjing chi de bingqilin 䴎䛤䜃⎫ Buin ิၨ センス 䘬⅘㵯㵳 bujie ᶵ㻼 Gyeongbok ઠฟ Bukchon ีᆀ F Gyeongseong ઠໜ Fang Junbi (1898–1986) 㕡⏃䑏 C Feng Chaoran (1882–1954) 楖崭䃞 H Cai Weilian (1904-40) 哉⦩ Feng Wenfeng (1900-71) 楖㔯沛 Haiguo tuzhi 㴟⚳⚾⽿ Cai Yuanpei (1868–1940) 哉⃫➡ Feng Yuxiang (1882–1948) 楖䌱䤍 Haishang fanhua 㴟ᶲ䷩厗 Chenbao fukan 㘐⟙∗↲ Fengyue huabao 桐㚰䔓⟙ Hamada Masuji (1892-1938) 浜田増治 Chen Baoyi (1893–1945) 昛㉙ᶨ Feng Zikai (1898–1975) 寸⫸ミ Hanbok ዽฟ Chen Duxiu (1879–1942) 昛䌐䥨 Fudan daxue ⽑㖎⣏⬠ Hankou 㻊⎋ -

THE CHINESE ARMED FORCES in the 21St CENTURY Edited By
THE CHINESE ARMED FORCES IN THE 21st CENTURY Edited by Larry M. Wortzel December 1999 ***** The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited. ***** Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave., Carlisle, PA 17013-5244. Copies of this report may be obtained from the Publications and Production Office by calling commercial (717) 245-4133, FAX (717) 245-3820, or via the Internet at [email protected] ***** Most 1993, 1994, and all later Strategic Studies Institute (SSI) monographs are available on the SSI Homepage for electronic dissemination. SSI's Homepage address is: http://carlisle-www.army. mil/usassi/welcome.htm ***** The Strategic Studies Institute publishes a monthly e-mail newsletter to update the national security community on the research of our analysts, recent and forthcoming publications, and upcoming conferences sponsored by the Institute. Each newsletter also provides a strategic commentary by one of our research analysts. If you are interested in receiving this newsletter, please let us know by e-mail at [email protected] or by calling (717) 245-3133. ISBN 1-58487-007-9 ii CONTENTS Introduction James R. Lilley..................... v 1. Geographic Ruminations Michael McDevitt ................... 1 2. The Chinese Military and the Peripheral States 1 in the 21st Century: A Security Tour d’Horizon Eric A. -

The CCP Central Committee's Leading Small Groups Alice Miller
Miller, China Leadership Monitor, No. 26 The CCP Central Committee’s Leading Small Groups Alice Miller For several decades, the Chinese leadership has used informal bodies called “leading small groups” to advise the Party Politburo on policy and to coordinate implementation of policy decisions made by the Politburo and supervised by the Secretariat. Because these groups deal with sensitive leadership processes, PRC media refer to them very rarely, and almost never publicize lists of their members on a current basis. Even the limited accessible view of these groups and their evolution, however, offers insight into the structure of power and working relationships of the top Party leadership under Hu Jintao. A listing of the Central Committee “leading groups” (lingdao xiaozu 领导小组), or just “small groups” (xiaozu 小组), that are directly subordinate to the Party Secretariat and report to the Politburo and its Standing Committee and their members is appended to this article. First created in 1958, these groups are never incorporated into publicly available charts or explanations of Party institutions on a current basis. PRC media occasionally refer to them in the course of reporting on leadership policy processes, and they sometimes mention a leader’s membership in one of them. The only instance in the entire post-Mao era in which PRC media listed the current members of any of these groups was on 2003, when the PRC-controlled Hong Kong newspaper Wen Wei Po publicized a membership list of the Central Committee Taiwan Work Leading Small Group. (Wen Wei Po, 26 December 2003) This has meant that even basic insight into these groups’ current roles and their membership requires painstaking compilation of the occasional references to them in PRC media. -
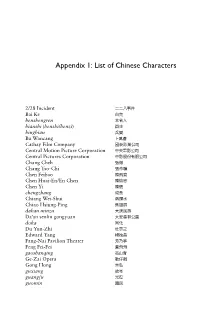
Appendix 1: List of Chinese Characters
Appendix 1: List of Chinese Characters 2/28 Incident 二二八事件 Bai Ke 白克 benshengren 本省人 bianshi (benshi/benzi) 辯士 bingbian 兵變 Bu Wancang 卜萬蒼 Cathay Film Company 國泰影業公司 Central Motion Picture Corporation 中央電影公司 Central Pictures Corporation 中影股份有限公司 Chang Cheh 張徹 Chang Tso-Chi 張作驥 Chen Feibao 陳飛寶 Chen Huai-En/En Chen 陳懷恩 Chen Yi 陳儀 chengzhang 成長 Chiang Wei- Shui 蔣謂水 Chiao Hsiung- Ping 焦雄屏 dahan minzu 大漢民族 Da’an senlin gongyuan 大安森林公園 doka 同化 Du Yun- Zhi 杜雲之 Edward Yang 楊德昌 Fang- Nai Pavilion Theater 芳乃亭 Feng Fei- Fei 鳳飛飛 gaoshanqing 高山青 Ge- Zai Opera 歌仔戲 Gong Hong 龔弘 guxiang 故鄉 guangfu 光復 guomin 國民 188 Appendix 1 guopian 國片 He Fei- Guang 何非光 Hou Hsiao- Hsien 侯孝賢 Hu Die 胡蝶 Huang Shi- De 黃時得 Ichikawa Sai 市川彩 jiankang xieshi zhuyi 健康寫實主義 Jinmen 金門 jinru shandi qingyong guoyu 進入山地請用國語 juancun 眷村 keban yingxiang 刻板印象 Kenny Bee 鍾鎮濤 Ke Yi-Zheng 柯一正 kominka 皇民化 Koxinga 國姓爺 Lee Chia 李嘉 Lee Daw- Ming 李道明 Lee Hsing 李行 Li You-Xin 李幼新 Li Xianlan 李香蘭 Liang Zhe- Fu 梁哲夫 Liao Huang 廖煌 Lin Hsien- Tang 林獻堂 Liu Ming- Chuan 劉銘傳 Liu Na’ou 劉吶鷗 Liu Sen- Yao 劉森堯 Liu Xi- Yang 劉喜陽 Lu Su- Shang 呂訴上 Ma- zu 馬祖 Mao Xin- Shao/Mao Wang- Ye 毛信孝/毛王爺 Matuura Shozo 松浦章三 Mei- Tai Troupe 美臺團 Misawa Mamie 三澤真美惠 Niu Chen- Ze 鈕承澤 nuhua 奴化 nuli 奴隸 Oshima Inoshi 大島豬市 piaoyou qunzu 漂游族群 Qiong Yao 瓊瑤 qiuzhi yu 求知慾 quanguo gejie 全國各界 Appendix 1 189 renmin jiyi 人民記憶 Ruan Lingyu 阮玲玉 sanhai 三害 shandi 山地 Shao 邵族 Shigehiko Hasumi 蓮實重彦 Shihmen Reservoir 石門水庫 shumin 庶民 Sino- Japanese Amity 日華親善 Society for Chinese Cinema Studies 中國電影史料研究會 Sun Moon Lake 日月潭 Taiwan Agricultural Education Studios -

U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress
U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress Shirley A. Kan Specialist in Asian Security Affairs October 27, 2014 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL32496 U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress Summary This CRS Report, updated through the 113th Congress, discusses policy issues regarding military- to-military (mil-to-mil) contacts with the People’s Republic of China (PRC) and records major contacts and crises since 1993. The United States suspended military contacts with China and imposed sanctions on arms sales in response to the Tiananmen Crackdown in 1989. In 1993, President Clinton reengaged with the top PRC leadership, including China’s military, the People’s Liberation Army (PLA). Renewed military exchanges with the PLA have not regained the closeness reached in the 1980s, when U.S.-PRC strategic alignment against the Soviet Union included U.S. arms sales to China. Improvements and deteriorations in overall bilateral engagement have affected military contacts, which were close in 1997-1998 and 2000, but marred by the 1995-1996 Taiwan Strait crisis, mistaken NATO bombing of a PRC embassy in 1999, the EP-3 aircraft collision crisis in 2001, and the PLA’s aggressive maritime and air confrontations. Issues for Congress include whether the Administration complies with legislation overseeing dealings with the PLA and pursues contacts with the PLA that advance a prioritized set of U.S. security interests, especially the operational safety of U.S. military personnel. Oversight legislation includes the Foreign Relations Authorization Act for FY1990-FY1991 (P.L. 101-246) and National Defense Authorization Act (NDAA) for FY2000 (P.L. -

The Chinese People's Liberation Army at 75
THE LESSONS OF HISTORY: THE CHINESE PEOPLE’S LIBERATION ARMY AT 75 Edited by Laurie Burkitt Andrew Scobell Larry M. Wortzel July 2003 ***** The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited. ***** Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave., Carlisle, PA 17013-5244. Copies of this report may be obtained from the Publications Office by calling (717) 245-4133, FAX (717) 245-3820, or via the Internet at [email protected] ***** Most 1993, 1994, and all later Strategic Studies Institute (SSI) monographs are available on the SSI Homepage for electronic dissemination. SSI’s Homepage address is: http:// www.carlisle.army.mil/ssi/index.html ***** The Strategic Studies Institute publishes a monthly e-mail news- letter to update the national security community on the research of our analysts, recent and forthcoming publications, and upcoming conferences sponsored by the Institute. Each newsletter also pro- vides a strategic commentary by one of our research analysts. If you are interested in receiving this newsletter, please let us know by e-mail at [email protected] or by calling (717) 245-3133. ISBN 1-58487-126-1 ii CONTENTS Foreword Ambassador James R. Lilley . v Part I: Overview. 1 1. Introduction: The Lesson Learned by China’s Soldiers Laurie Burkitt, Andrew Scobell, and Larry M.