Neozoa (Makrozoobenthos) an Der Deutschen Nordseekueste
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Best Restaurants and Hotels
★★★ THE BEST RESTAURANTS AND HOTELS EDITION ★★★ Robbe & Berking Restaurant Guide 2017 ★★★ Dear Friends of Fine Cuisine, Delicious Food and Tables Set in Style, This 10th anniversary edition of our restaurant guide is bursting with 234 culinary hotspots featuring 143 Michelin stars. All the eateries listed have one thing in common: their outstanding performance. The very best produce and ingredients are prepared with meticulous attention to detail here by creative chefs with incredible fl air who really love their job. If they didn’t, they wouldn’t make it onto this prestigious list. And speaking of love, there’s another thing that sets these restaurants apart: real love – real silver. After all, the trappings and the atmosphere also play an important role in the dining experience. Even the greatest masterpiece needs a stage to unveil its full effect. Nowadays, it seems there’s a constant pressure for everything to become quicker, more convenient and easier all the time. All the more comforting, then, to know that these restaurants and the people behind them exist. Dine with the best and enjoy yourself. Yours, Oliver Berking 2 3 Alta Alta is a veritable classic amongst the Moderns. Despite its somewhat austere appearance, this range of cutlery conveys an almost sensuous feeling of pure pleasure for the eye and also for the hands. The reason is that its chiselled fi nish allows us to experience the beauty of the silver, there is no unneces- sary ornamentation to distract our gaze away from the clarity of the lines. With its simplistic beauty and its taut silhouette, Alta makes us feel that this is the one and only shape that is justifi ed in providing the basic pattern for every contemporary style of cutlery today. -

The American Slipper Limpet Crepidula Fornicata (L.) in the Northern Wadden Sea 70 Years After Its Introduction
Helgol Mar Res (2003) 57:27–33 DOI 10.1007/s10152-002-0119-x ORIGINAL ARTICLE D. W. Thieltges · M. Strasser · K. Reise The American slipper limpet Crepidula fornicata (L.) in the northern Wadden Sea 70 years after its introduction Received: 14 December 2001 / Accepted: 15 August 2001 / Published online: 25 September 2002 © Springer-Verlag and AWI 2002 Abstract In 1934 the American slipper limpet 1997). In the centre of its European distributional range Crepidula fornicata (L.) was first recorded in the north- a population explosion has been observed on the Atlantic ern Wadden Sea in the Sylt-Rømø basin, presumably im- coast of France, southern England and the southern ported with Dutch oysters in the preceding years. The Netherlands. This is well documented (reviewed by present account is the first investigation of the Crepidula Blanchard 1997) and sparked a variety of studies on the population since its early spread on the former oyster ecological and economic impacts of Crepidula. The eco- beds was studied in 1948. A field survey in 2000 re- logical impacts of Crepidula are manifold, and include vealed the greatest abundance of Crepidula in the inter- the following: tidal/subtidal transition zone on mussel (Mytilus edulis) (1) Accumulation of pseudofaeces and of fine sediment beds. Here, average abundance and biomass was 141 m–2 through the filtration activity of Crepidula and indi- and 30 g organic dry weight per square metre, respec- viduals protruding in stacks into the water column. tively. On tidal flats with regular and extended periods of This was reported to cause changes in sediments and emersion as well as in the subtidal with swift currents in near-bottom currents (Ehrhold et al. -
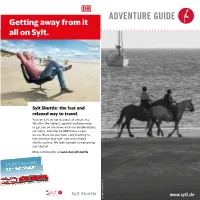
ADVENTURE GUIDE Getting Away from It All on Sylt
ADVENTURE GUIDE Getting away from it all on Sylt. Sylt Shuttle: the fast and relaxed way to travel. You can rely on our decades of experience. We offer the highest capacity and guarantee to get you on the move with our double-decker car trains. Running 14,000 trains a year, we are there for you from early morning to late evening: your fast, safe and reliable shuttle service. We look forward to welcoming you aboard. More information at bahn.de/syltshuttle 14,000 trains a year. The Sylt Shuttle. www.sylt.de Last update November 2019 Anz_Sylt_Buerostuhl_engl_105x210_mm_apu.indd 1 01.02.18 08:57 ADVENTURE GUIDE 3 SYLT Welcome to Sylt Boredom on Sylt? Wrong! Whether as a researcher in Denghoog or as a dis- coverer in the mudflats, whether relaxed on the massage bench or rapt on a surfboard, whether as a daydreamer sitting in a roofed wicker beach chair or as a night owl in a beach club – Sylt offers an exciting and simultaneously laid-back mixture of laissez-faire and savoir-vivre. Get started and explore Sylt. Enjoy the oases of silence and discover how many sensual pleasures the island has in store for you. No matter how you would like to spend your free time on Sylt – you will find suitable suggestions and contact data in this adventure guide. Content NATURE . 04 CULTURE AND HISTORY . 08 GUIDED TOURS AND SIGHTSEEING TOURS . 12 EXCURSIONS . 14 WELLNESS FOR YOUR SOUL . 15 WELLNESS AND HEALTH . 16 LEISURE . 18 EVENT HIGHLIGHTS . .26 SERVICE . 28 SYLT ETIQUETTE GUIDE . 32 MORE ABOUT SYLT . -

Volker Frenzel · Frank Deppe Sylt S Schönste Seiten Sylt’S Most Beautiful Sides
Volker Frenzel · Frank Deppe Sylt s schönste Seiten Sylt’s Most Beautiful Sides Medien-Verlag Schubert ISBN 3-929229-93-5 Copyright © 2004 by Medien-Verlag Schubert, Hamburg Alle Rechte, auch des auszugsweisen Nachdrucks und der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten. Gestaltung: Medien-Verlag Schubert / Thomas Börnchen Englische Übersetzung: Adelheid Kaessens Druck: Grafisches Centrum Cuno Printed in Germany Inhalt Sylt – eine Insel, viele Gesichter 5 List – in Deutschland ganz oben 8 Kampen – ein exklusives Kleinod 18 Wenningstedt-Braderup – vom Strand bis in die Heide 28 Sylt-Ost – das ländliche Sylt 38 Munkmarsch 40 Keitum 44 Morsum 50 Archsum 56 Tinnum 58 Westerland – der Puls der Insel 62 Rantum – Sylts schmale Taille 76 Hörnum – Sylts sonniger Süden 84 Sylt – an island of many faces 94 List – in Deutschland ganz oben Wer ganz hinauf bis zur Spitze der Insel dern sie vom Wind angefacht pro Jahr wandert, der darf ein besonderes Privileg etwa fünf Meter. für sich in Anspruch nehmen: Dann näm- Nicht nur Feinschmecker dürften von ei- lich ist man seinen 80 Millionen Lands- ner anderen Besonderheit angetan sein, die leuten ein Stück voraus und darf sich als sich im Lister Wattenmeer findet: nördlichster Mensch Deutschlands be- Deutschlands einzige Austernzucht. Von zeichnen. Außer diesem Superlativ hat hier aus gelangen jährlich rund eine Milli- List noch einiges mehr zu bieten: Pulsie- on Schalentiere in den bundesweiten Ver- rendes Zentrum des ansonsten beschau- sand. Gedeihen die Austernsetzlinge die lichen Dorfes ist der Hafen. Hier werden meiste Zeit des Jahres in Spezialnetzen im Spezialitäten aus dem Meer aufgetischt, Wattenmeer, so überwintern sie während legt die Autofähre gen Dänemark ab, ste- der kalten Jahreszeit in großen Bassins an chen die Ausflugsschiffe in See. -

Les Sociétés Littorales Et Leurs Usages Traditionnels Du Watt En Mer Des Wadden Depuis Le Moyen-Âge (Mer Du Nord, Pays-Bas, Allemagne, Danemark)
Université Bretagne Sud Faculté Lettres, Langues, Science Humaines et Sociales Département d’Histoire Les sociétés littorales et leurs usages traditionnels du Watt en mer des Wadden depuis le Moyen-Âge (Mer du Nord, Pays-Bas, Allemagne, Danemark) Mémoire de Master 2 Histoire Présenté par M. Anatole DANTO Sous la direction de Mme Sylviane LLINARES Septembre 2017 Master Recherche Histoire - Histoire maritime - Archéologie Histoire des régions littorales et de la mer Centre de Recherches Historiques de l’Ouest – CERHIO CNRS UMR 6258 Les sociétés littorales et leurs usages traditionnels du Watt en mer des Wadden depuis le Moyen-Âge (Mer du Nord, Pays-Bas, Allemagne, Danemark) Sommaire Introduction ........................................................................................................................................... 13 I – Historiographie ................................................................................................................................. 21 II – Corpus .............................................................................................................................................. 28 III - Le Watt : socio-écosystème marin et côtier nord-européen .......................................................... 39 IV - L’époque Médiévale, ou l’âge d’or des Frisons ............................................................................... 57 V - La structuration des usages à l’époque Moderne............................................................................ 78 VI - Les importantes -

Juvenile-Adult Distribution of the Bivalve Mya Arenaria on Intertidal Flats in the Wadden Sea: Why Are There So Few Year Classes?
Helgol Mar Res (1999) 53:45–55 © Springer-Verlag and AWI 1999 ORIGINAL ARTICLE M. Strasser · M. Walensky · K. Reise Juvenile-adult distribution of the bivalve Mya arenaria on intertidal flats in the Wadden Sea: why are there so few year classes? Received: 18 June 1998 / Accepted: 12 November 1998 Abstract Patchy distribution is frequently observed in ties >30 ind m–2 did not prevent relatively high M. aren- benthic marine invertebrates. In order to indentify fac- aria recruitment of >500 ind m–2. tors causing spatial patterns in the bivalve Mya arenaria, abundances of juveniles and adults, as well as death as- Key words Mya arenaria · Predation · Recruitment · semblages, were recorded on a 20-km scale in the inter- Population dynamics · Patchiness tidal zone of the Sylt-Rømø Bight. Both adults and juve- niles exhibited pronounced patchiness. Shell length of juveniles rarely exceeded 2 mm in 1995, which was most Introduction likely a consequence of epibenthic predators truncating the size spectrum. Only a few yearclasses dominated the Population structure and dynamics of Mya arenaria L. in adult population. While the northern part of the Bight the European Wadden Sea are characterized by the oc- was colonized mainly by a 1993-cohort, most M. aren- currence of adults in locally restricted dense beds (Kühl aria in the southern part were from the mid-1980s. It is 1955) and by a large annual variation in reproductive hypothesized that epibenthic predation is a major cause success (Beukema 1982, 1992). Patchy distribution of of the lack of dense M. arenaria beds from other years. -

Herzlich Willkommen Auf Dem Archäologischen Ausflug »Hünen.Kultour«
Herzlich Willkommen auf dem archäologischen Ausflug »hünen.kulTour«. Der Ausflug möchte Ihnen die in der Landschaft heute noch O sichtbaren Zeugnisse der Vor- und Frühgeschichte auf Sylt näher bringen. Kaum ein Gebiet in Deutschland wurde früher derart von den Grabhügeln und Megalithgräbern (Großsteingräber) geprägt wie die Nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr und Am- rum. Die Grabhügel aus dem Neolithikum (Jungsteinzeit), der Bronzezeit und der Wikingerzeit dominierten auf den weitgehend baumlosen Inseln die Landschaft. Krockhooger 6 . Gehen Sie auf Entdeckungstour hünenSteingrab kulTour Wachtmannshoog 140 Der Ausflug ist unterteilt in drei Touren. Jede Tour umfasst 5 7 mehrere Standorte, die Sie abwandern oder mit dem Fahrrad Steingrab 180 Soonjihoog erkunden können. Diese Tourenkarte wird Sie auf Ihrem Weg 4 Stapelhooger begleiten. Sie können systematisch vorgehen oder sich ein- Steingrab 2 fach auf den Weg machen und dabei überraschen lassen, 8 welchen Zeitzeugnissen Sie auf Ihrer Tour begegnen. SWARTE WALL Kampen 3 Turndelhoog Jede Tafel ist selbsterklärend und jeder Standort ist an den 9 Fuß- und Radwegen so ausgewählt, dass die Tafeln nicht ver- Gonnenhoog 2 fehlt werden können. Brönshooger Pückhoog auf Sylt auf 10 Jüdelhooger Wir wünschen Ihnen viel Freude bei diesem spannenden Frühgeschichte Frühgeschichte Denghoog Tiideringhoog 11 Ausflug in die Vor- und Frühgeschichte der Insel! Lünghoog 12 zur Vor- und und Vor- zur 1 Buatskenhoog Brödihoog die Archäologie Archäologie die 13 Raisihoog Ein Ausflug in in Ausflug Ein Wenningstedt Braderup 14 Trööshoog 15 Grabhügel 9 Herausgeber und Kontakt: Munkmarsch Sölring Foriining e. V. Gallighoog TOUREN-Übersicht Am Kliff 19 a, 25980 Sylt/Keitum Tel. 04651 328 05 TOUR [email protected] 8 August 2019 | 3. -

Jahresbericht 2004 Landesamt Für Natur Und Umwelt
Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein Jahresbericht 2004 Landesamt für Natur und Umwelt Herausgeber: Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein Hamburger Chaussee 25 24220 Flintbek Tel.: 0 43 47 / 704-0 www.lanu-sh.de Ansprechpartner: Martin Schmidt, Tel.: 0 43 47 / 704-243 Titelfoto: Die Rotbauchunke (Bombina bombina) ist Zielart des internationalen LIFE-Projektes „Management von Rotbauchunkenpopulationen im Ostseeraum”. Die Art wird wegen ihres melodischen Rufes in Dänemark auch Klokkefrø (Glockenfrosch) genannt, da ein „Konzert” dieser Art an entferntes Kirchenglockengeläut erinnert. Das LANU ist Partner in dem von 2004 bis 2009 laufenden Projekt, das die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein beantragt hat (www.life-bombina.de). (Foto: Hauke Drews) Fotos im Innenteil: wenn nicht anders angegeben, Autorenschaft LANU Herstellung: Pirwitz Druck & Design, Kiel November 2005 ISBN: 3-937937-02-1 Schriftenreihe LANU SH - Jahresberichte; 9 Die Jahresberichte des LANU ab 1996 finden Sie auch im Internet unter www.lanu-sh.de Diese Broschüre wurde auf Recyclingpapier hergestellt. Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der schleswig- holsteinischen Landesregierung heraus- gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahl- kampf zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Auch ohne zeit- lichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei- nahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Die Landesregierung im Internet: www.landesregierung.schleswig-holstein.de Inhalt Vorwort ............................................................................................................................................6 Wolfgang Vogel Monitoring von Klimaveränderungen mit Hilfe von Bioindikatoren (Klima-Biomonitoring) .............7 Dr. -

December '05/January
DEAR� SUBSCRIBER� GEMüTLICHKEIT�The Travel Letter for Germany, Austria, Switzerland & the New Europe� Strange Advice From The Guru In the Navy, we called it “bum dope,” bad information (if the term in ISLAND OF SYLT those long-ago days had a drug con- notation, it was lost on me). As we Germany’s version of the Hamptons on the North Sea attracts an elite clien- close out the 19th year of publishing tele and is a perfect place to escape fellow American tourists. Gemütlichkeit, there is a considerable amount of bum dope being passed out hen it comes to destina- that this is Germany’s most coveted about travel. tions, many travelers have and expensive residential real estate. to fight the urge to return For example, companies and mer- W Visitors arrive via long, double- time after time to the tried-and-true. decked car trains (42 per car each chants who benefit financially from the It’s a safe but dull strategy, and readers way), over vast tide flats on the seven- procedure, tell visitors to Europe that unable to break out of the not-so-vicious mile Hindenburg embankment, or by it’s advisable to pay hotel and res- southern Bavaria/Black Forest cycle will car ferry (37) from Denmark. taurant bills in dollars (the process is never know the many unique charms of called Dynamic Currency Conversion, the island of Sylt, Deutschland’s version This is not the Germany of cuckoo DCC). That way, they explain, you’ll of the Hamptons. clocks and dirndls, forests and rolling know the exact amount in dollars that farmland, sauerkraut and Rostbraten; This flat, sliver of an island in the will appear on your credit card bill. -

Munkmarsch Auf Sylt
Über sammelmöglichkeiten in den Kaolinsandgruben in raume Braderup/ Munkmarsch auf Sylt Ulrich von Hacht SUMMARY: Es wird die Verteilung ordovizischer und silurischer Fossilien und verkieselter Kalke in sechs Abbaugruben in pliozänen Kaolinsanden im Osten der Insel Sylt beschrieben. DANKSAGUNG: Mein Dank gilt meiner Frau, die nicht nur die Karte zeichnete, sondern jahrelang dafür sorgte, dap die Aufsammlung von Gesteinen und Fossilien beharrlich fort- gesetzt werden konnte. Frau E. von Hacht, Elmshorn, gilt mein Dank für die Aufnahme No. 5, Herrn W. Hahnel, Hamburg, für die Aufnahme No. 6. Der vorliegende Aufsatz geht auf den Wunsch einiger Hamburger Geschiebe- sammler zurück, einige Angaben über Fundmöglichkeiten in den Kaolinsand• gruben von Sylt zu erhalten, urn bei kurzen Wochenendfahrten die besten Fund- platze aufsuchen zu können. Ich komme diesen Wunsch gerne nach und beschreibe den Stand in den Gruben Anfang Januar 1976. Hierbei erscheint es mir zweckmapig, die von R. El-Najjar begonnene bezifferung der Gruben fortzusetzen. Die beigegebene Karte gibt die Lage der Gruben zueinander richtig wieder, die Grubenumrisse entsprechen etwa dem Eindruck, den man aus 4000 m Höhe gewinnt. Die Grubenziffern besagen, dap den genannten Firmen die Gruben ent weder gehören oder aber von ihnen ausgebeutet werden. Hierbei gebe ich Hinweisschildern im Gelande den Vorzug vor Eigentumsverhalt- nissen. Interessierten Sammlern soil das Auffinden von Eigentümern oder Pachtern erleichtert werden, die in aller Regel uns Sammlern den Zutritt zu den Gruben auf Anfrage gern auf eigenes Risiko erlauben. Grube 1 Fa. Holst, Wenningstedt (in der Grube: a) Teerbau, stillgelegt b) Readymix, stillgelegt) Grube 2 Fa. Jacobsen, Westerland (Teerwerk in Betrieb) Grube 3 Fa. -
Beitrag Zur Phanerogamenflora Der Nordfriesischen Inseln Sylt, Rom Und Föhr
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein Jahr/Year: 1906 Band/Volume: 13 Autor(en)/Author(s): Ostermeyer Franz Artikel/Article: Beitrag zur Phanerogamenflora der nordfriesischen Inseln Sylt, Rom und Föhr. 20-38 Abhandlungen. Beitrag zur Phanerogamenflora der nordfriesischen Inseln Sylt, Rom und Föhr. Von Dr. Franz Ostermeyer, Wien. Ich besuchte im Jahre 1901 die vorerwähnten Inseln in der Zeit vom 23. Juni bis 21. Juli. Westerland auf Sylt war mein ständiger Aufenthalt, von wo die Insel Sylt ihrer ganzen Aus- dehnung nach durchstreift wurde. Mein Aufenthalt auf Rom beschränkte sich auf 2 halbe Tage, der auf Föhr auf einen halben Tag. Ein Ausflug nach der Hallig Hooge verlief für die Botanik resultatlos, weil ein Gewitter die Landung unmöglich machte. Die hauptsächlichsten von mir unternommenen botanischen Ausflüge sind in nachstehendem Itinerarium aufgezählt: 24. Juni : Von Westerland über Wenningstedt nach Kampen zum Roten Kliff und retour. 27. Juni: Von Westerland nach Munkmarsch, Besuch des Lornsenheimes, dann am Strand des Wattenmeeres nach Keitum und zurück nach Westerland. 30. Juni: Über Wenningstedt, Kampen nach Braderup und Munkmarsch. l.Juli: Nach Keitum gegen Morsum Kliff und retour. 2. Juli: Besuch von List und Umgebung. 4. Juli: Ausflug zur Eidumer Vogelkoje, Nachmittags Aus- flug nach Kampen. Dr. Franz Ostermeyer. 21 5. Juli: Besuch des Friesen-, ehemals Viktoriahains. 6. Juli: Ausflug nach Hörnum und Besuch der Umgebung. 8. Juli : Besuch der Sümpfe in der Umgebung der Tinnumburg. 10. Juli: Besuch von Rantum und des Burgtales. 12. und 13. Juli: Besuch der Insel Rom, über Königsmark nach Bad Lakolk und retour. -
Mobil Gegen Corona
Nr. 7/8 Juli/August 2021 74. Jahrgang Herausgegeben von der Ärztekammer Schleswig-Holstein Diabetes Epigenetik, Telemedizin, Lebensstil Seiten 8 − 11 HIV Mobil gegen Corona Kieler Ambulanz Impfteams sind im ganzen besteht seit 30 Jahren Land unterwegs Seiten 26 − 27 Seiten 12 − 13 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES ÄRZTEBLATT Schleswig-Holsteins Werbeträger für Ärzte In 11 Ausgaben im Jahr informiert das Schleswig-Holsteinische Ärzteblatt über zentrale Themen aus dem Gesundheitswesen zwischen Nord- und Ostsee. Das Mitgliedermagazin der Ärztekammer Schleswig-Holstein erreicht neben allen Ärzten auch Entscheidungsträger aus Gesundheitswirtschaft und -politik. Anzeigenberatung unter 040 / 33 48 57 11 oder [email protected] Bismarckstr. 2 | 20259 Hamburg | www.elbbuero.com Anzeige JULI/AUGUST 2021 EDITORIAL 3 Weiterbildung im Fortschritt Berufspolitisches Engagement, auch in der ärztlichen Selbstverwaltung, ist auf ganz unterschiedliche Motivationsgründe zurückzuführen: Mitwirkung in einem Berufs- verband oder einer Fachgesellschaft, standespolitische Interessenvertretung, Wunsch nach Mitgestaltung und vieles mehr. Bei mir ist es primär die Weiterbildung gewesen. Nachdem ich selber eine sehr breite, gute Weiterbildung erhalten hatte, wurde es als junger Oberarzt meine Aufgabe, mich um die Durchführung der Weiterbildung bei den jungen Kolleginnen und Kollegen zu kümmern, obwohl ich selber keine Befugnis hatte – diese war zu der Zeit noch ein rein chefärztliches Privileg. So war es ein naheliegender Schritt, mich auch auf Ärztekammerebene vertiefend in übergeordnete Weiterbildungsthemen einzuarbeiten und einzubringen. Weiterbildung nach Erhalt der ärztlichen Approbation und damit freier Ausübung der Heilkunde ist der prägendste Abschnitt in der Arztwerdung. Hier werden die ärztlichen Rollen, Haltungen und Kompetenzen vermittelt, letztere nicht allein in Prof. Henrik Herrmann ist fachlicher, sondern auch in kommunikativer, sozialer und empathischer Hinsicht.