Mitteilungen Der Münchner Entomologischen Gesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Амурский Зоологический Журнал Amurian Zoological Journal
Амурский зоологический журнал Amurian zoological journal Том VIII. № 1 Март 2016 Vol. VIII. No 1 March 2016 Амурский зоологический журнал ISSN 1999-4079 Рег. свидетельство ПИ № ФС77-31529 Amurian zoological journal Том VIII. № 1. Vol. VIII. № 1. Март 2016 www.bgpu.ru/azj/ March 2016 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD Главный редактор Editor-in-chief Член-корреспондент РАН, д.б.н. Б.А. Воронов Corresponding Member of R A S, Dr. Sc. Boris A. Voronov к.б.н. А.А. Барбарич (отв. секретарь) Dr. Alexandr A. Barbarich (exec. secretary) к.б.н. Ю. Н. Глущенко Dr. Yuri N. Glushchenko д.б.н. В. В. Дубатолов Dr. Sc. Vladimir V. Dubatolov д.н. Ю. Кодзима Dr. Sc. Junichi Kojima к.б.н. О. Э. Костерин Dr. Oleg E. Kosterin д.б.н. А. А. Легалов Dr. Sc. Andrei A. Legalov д.б.н. А. С. Лелей Dr. Sc. Arkadiy S. Lelej к.б.н. Е. И. Маликова Dr. Elena I. Malikova д.б.н. В. А. Нестеренко Dr. Sc. Vladimir A. Nesterenko д.б.н. М. Г. Пономаренко Dr. Sc. Margarita G. Ponomarenko к.б.н. Л.А. Прозорова Dr. Larisa A. Prozorova д.б.н. Н. А. Рябинин Dr. Sc. Nikolai A. Rjabinin д.б.н. М. Г. Сергеев Dr. Sc. Michael G. Sergeev д.б.н. С. Ю. Синев Dr. Sc. Sergei Yu. Sinev д.б.н. В.В. Тахтеев Dr. Sc. Vadim V. Takhteev д.б.н. И.В. Фефелов Dr. Sc. Igor V. Fefelov д.б.н. А.В. Чернышев Dr. Sc. Alexei V. Chernyshev к.б.н. -

Kiss Diána IV
ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою ЗУІ Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. Ф-КДМ-1 Міністерство освіти і науки України Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ Кафедра біології та хімії Реєстраційний № _____________ Дипломна робота ФАУНІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ МЕТЕЛИКІВ (LEPIDOPTERA) С. ПАЛАДЬ КОМАРІВЦІ (УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН) КІШ ДІАНА ЗОЛТАНІВНА Cтудентка IV-го курсу Cпеціальність: біологія Oсвітній рівень: бакалавр Тема затверджена на засіданні Кафедри біології та хімії Протокол № 2 від 10 жовтня 2019 р. Науковий керівник: Коложварі Степан Васильович доктор філософії, в/о доцента Завідувач Кафедрою біології та хімії: Когут Ержебет Імріївна доктор філософії з ботаніки, в/о доцента Робота захищена на оцінку ____________, „___” __________ 2020 р. Протокол № ______ / 2020 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою ЗУІ Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. Ф-КДМ-1 Міністерство освіти і науки України Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ Кафедра біології та хімії Дипломна робота ФАУНІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ МЕТЕЛИКІВ (LEPIDOPTERA) С. ПАЛАДЬ КОМАРІВЦІ (УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН) Виконавець: студентка ІV-го курсу спеціальність біологія освітній рівень: бакалавр Кіш Діана Золтанівна Науковий керівник: Коложварі Степан Васильович доктор філософії, в/о доцента Рецензент: Желіцкі І. Й. спец., ст. викладач Берегово 2020 ЗМІСТ ВСТУП ...................................................................................................................................... 6 І. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ................................................................................................. -

Korrekturen Und Ergänzungen Zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs Und Angrenzender Gebiete - 2
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart Jahr/Year: 2009 Band/Volume: 44_2009 Autor(en)/Author(s): Hausenblas Dietger Artikel/Article: Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete - 2. Beitrag. 81-107 © Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at 81 Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete - 2. Beitrag Dietger Hausenblas, Stuttgart Abstract This paper is the author’s second contribution to the microlepidoptera fauna of Baden-Wuerttemberg and neighbouring regions. As a result of recent collecting and of a review of historical specimens in the mu- seums of Karlsruhe and Stuttgart several species are reported as new to the fauna of Baden- Wuerttemberg whereas some others have to be deleted from the faunal list. Two species - Metalampra italica Baldizzone , 1977 and Stenoptilia mariaeluisae B igot & P icard , 2002 - are new for Germany. In an appendix the geographical colour-code-system of the labels in the C. Reutti collection is elucidated. Zusammenfassung In diesem zweiten Beitrag des Autors zur Microlepidopterenfauna von Baden-Württemberg und benachbarter Regionen sind erneut Ergebnisse sowohl aktueller Aufsammlungen als auch von Nachuntersuchung historischen Materials in den beiden großen Naturkundemu seen des Landes in Verbindung mit der Auswertung von Literaturmeldungen zusammenge stellt. Zahlreiche Arten können der Fauna hinzugefügt, während andere Meldungen korrigiert werden. Zwei Arten - Metalampra italica Baldizzone , 1977 und Stenoptilia mariaeluisae Bigot & P icard, 2002 - sind neu für Deutschland. Zusätzlich erfolgt in einem Anhang die Auflistung von Fundorten der Sammlungsetiketten von C. Reutti in Verbindung mit der von ihm verwendeten Farbcodierung. -
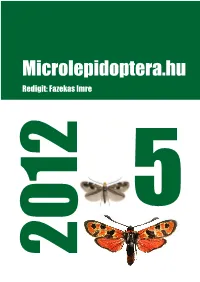
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Data to the Knowledge of the Macrolepidoptera Fauna of the Sălaj-Region, Transylvania, Romania (Arthropoda: Insecta)
Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii Vol. 26 supplement 1, 2016, pp.59- 74 © 2016 Vasile Goldis University Press (www.studiauniversitatis.ro) DATA TO THE KNOWLEDGE OF THE MACROLEPIDOPTERA FAUNA OF THE SĂLAJ-REGION, TRANSYLVANIA, ROMANIA (ARTHROPODA: INSECTA) Zsolt BÁLINT*, Gergely KATONA, László RONKAY Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum ABSTRACT. We provide 984 data of 88 collecting events originating from the Sălaj-region of western Transylvania, Romania. These have been assembled in the period between 22. April, 2014 and 10. September, 2015. Geographical, spatial and temporal records to the knowledge of 98 butterflies (Papilionoidea) and 225 moths (Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Noctuoidea and Sphingoidea) are given representing the families (species numbers in brackets) Hesperiidae (8), Lycaenidae (28), Nymphalidae (28), Papilionidae (3), Pieridae (13) Riodinidae (1), Satyridae (17) (Papilionoidea); Arctiidae (11), Ctenuchidae (1), Lymantriidae (1), Noctuidae (119), Nolidae (2), Notodontidae (6) Thyatiridae (4), (Noctuoidea); Drepanidae (3) (Drepanoidea); Geometridae (73) (Geometroidea); Lasiocampidae (2), Saturniidae (1) (Bombycoidea); Sphingidae (2) (Sphingoidea). According to the most recent catalogue of the Romanian Lepidoptera fauna 31 species proved to be new for the region Sălaj. The following 43 species have faunistical interest, therefore they are briefly annotated: Agrochola humilis, Agrochola laevis, Aplocera efformata, Aporophila lutulenta, Atethmia centrago, Bryoleuca -

Entomologische Berichten Maandblad Uitgegeven Door De Nederlandse Entomologische Vereniging Issn 0013-8827
ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING ISSN 0013-8827. Officiële afkorting (World List): Ent. Ber., Amst. Deel 44 1 januari 1984 No. 1 Adres van de Redactie: B. J. LEMPKE, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam — Nederland ^ (TM i H. W. van der WOLF, Aantekeningen over Nederlandse Coleophoridae (Lepidoptera) 2: 1; Br. GENNARDUS (L. F. BALVERS), Verdere waarnemingen aan vlinders na een vulkani¬ sche asregen (Lepidoptera): 2; N. B. M. BRANTJES & R. NEEF, Helophilus affinis Wahl¬ berg in Nederland (Diptera: Syrphidae): 5; JEAN BELLE, Nothodiplax dendrophila, a new genus and a new species from Surinam (Odonata: Libellulidae): 6; J. KRIKKEN & J. P. KAAS, A new dung-beetle species of the genus Aphodius Illiger from East Africa (Coleoptera: Aphodiidae): 9; L. VÄRI, A replacement name for a genus group name in the Limacodidae (Lepidoptera): 12; J. M. REVIER, Naamlijst van de Nederlandse Sciomyzidae (Diptera): 13; KORTE MEDEDELINGEN: Te koop gevraagd: 8; Afdeling Noord-Holland en Utrecht: 11; LITERATUUR: 4, 12. Aantekeningen over Nederlandse Coleophoridae (Lepidoptera) 2 door H. W. van der WOLF ABSTRACT. — Notes on Dutch Coleophoridae (Lepidoptera) 2. The Heylaerts collection in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden contains three species of Coleophori¬ dae not yet recorded for the Dutch fauna: Coleophora cornuta Stainton, C. conspicuella Zeller and C. ditella Zeller. Another species new to the Dutch fauna was found in the collection of the Zoölogisch Museum, Amsterdam: Coleophora trifariella Zeller. In de collectie Heylaerts in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden trof ik drie soorten Coleophoridae aan die nog niet uit ons land zijn vermeld. -

Melanargia 19 Heft
NACHRICHTEN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT RHEINISCH-WESTFÄLISCHER LEPIDOPTEROLOGEN XIX. Jahrgang, Heft 3/4 Leverkusen, 31. Dezember 2007 Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz mit Sitz am Aquazoo-LÖBBECKE Museum Düsseldorf Schriftleitung: GÜNTER SWOBODA, Am Weingarten 21, D-51371 Leverkusen ISSN 0941-3170 Inhalt JELINEK, K.-H.: Entdeckung einer Population von Ethmia dodecea (HAWORTH, 1828) in der Niederrheinischen Bucht (Lep., Ethmiidae) ...................................... 110 SCHÖPWINKERL, R.: Nachweis des Ulmen-Zipfelfalters Satyrium w-album (KNOCH, 1782) in Neunkirchen-Seelscheid (NRW, Bergisches Land) und einige Anmer- kungen zum Status der Art in Nordrhein-Westfalen (Lep., Lycaenidae) CCCC 112 HEMMERSBACH, A. & SCHWAN, H.: Drei Irrg'ste o er Verschleppungen am Nie er- rhein - arunter .wei Arten neu f,r Deutschlan (Lep., Noctui ae) ..................... 11D JELINEK, K.-H.: Bembecia ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in er Bergbaufolgelan schaft er Nie errheinischen Bucht (Lep., Sesii ae) CC. 119 BIESENBAUM, W.: Weitere Nachweise von 1leinschmetterlingen (Microlepi optera) vom 1aiserstuhl (Ba en-W,rttemberg) ............................................................... 121 WIROOKS, L.: Ei.uchtbeobachtungen bei Caradrina (Eremodrina) gilva (DONZEL, 1837) (Lep., Noctui ae) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.. 140 Vereinsnachrichten Nachruf f,r Hans-Eoachim (FHaGoH) van Loh (E.H. Stu-e I Ch. 1ayser) CCCCCCC.. 148 Aufruf .ur Teilnahme an en 7. Europ'ischen Nachtfaltern'chten (European Moth Nights - EMN) (L. Wiroo-s) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 147 Verleihung es Bun esver ienst-reu.es an Rainer Lechner CCCCCCCCC.. 147 Schmetterlingsschut. im Dialog auf er Trupbacher Hei e bei Siegen - Wan erer un 1in er waren ,berrascht von en vielen Du-atenfaltern (V. Fieber, R. Twar ella, P. Fasel) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 172 Ban 18 er Lepi opterenfauna er Rheinlan e un Westfalens erschienen (G. -

Acta Rerum 17.Indb
Acta rerum naturalium 17: 69–84, 2014 ISSN 1803-1587 Význačné nálezy motýlů Znojemska (Lepidoptera) Signifi cant records of butterfl ies and moths of the Znojmo Region (Lepidoptera) JAN ŠUMPICH1, PAVEL VÍTEK2 1 Entomologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1470, CZ-193 00 Praha 9 - Horní Počernice; e-mail: [email protected]; 2 Za Plovárnou 1, CZ-671 81 Znojmo; e-mail: [email protected] Abstract: In the paper, the faunistic data for 94 species of butterfl ies and moths recorded in the territory of the Znojmo Region, excluding the territory of Podyjí National Park, are presented. Out of these, 16 species are completely new to the Znojmo region – Elachista griseella (Duponchel, 1843), Coleophora thymi Hering, 1942, Agonopterix putridella (Denis et Schiffermüller, 1775), Ethmia dodecea (Haworth, 1828), Epermenia petrusellus (Heylaerts, 1883), Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839), Pelochrista subtiliana (Jäckh, 1960), Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835), Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856), Cydia intexta (Kuznetsov, 1962), Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790), Parahypopta caestrum (Hübner, 1808), Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804), Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849), Gastropacha populifolia (Denis et Schiffermüller, 1775) and Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847). An additional 30 species included here were previously known only from the territory of Podyjí National Park and at the same time the occurrence of some previously recorded species which are rare in the Znojmo Region was confi rmed – Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855), Laelia coenosa (Hübner, 1808), Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852), Sedina buettneri (Hering, 1858), Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808), Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) and Dichagyris signifera (Denis et Schiffermüller, 1775). Overall, these locations in the territory of the Znojmo Region could be considered the most signifi cant refuges for many rare or endangered species in the Czech Republic. -

Grazing As a Conservation Management Tool in Peatland
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Wageningen University & Research Publications Grazing as a conservation management tool in peatland Report of a Workshop held 22-26 April 2002 in Goniadz (PL) Edited and compiled by J. Bokdam1, A. van Braeckel 2, C.Werpachowski 3& M. Znaniecka4. 2002 1 Nature Conservation and Plant Ecology Group, Wageningen University, The Netherlands. 2 Institute of Nature Conservation, Brussels, Belgium. 3 Biebrza National Park, Goniadz, Poland. 4 WWF-“Biebrza National Park” project, Bialystok, Poland. Joint Publication of Nature Conservation and Plant Ecology Group, Department of Environmental Sciences, Wageningen University, Bornsesteeg 69, 6708 PD Wageningen, The Netherlands, Biebrza National Park, Osowiec-Twierdza 8, PL 19-110, Goniadz. Poland and WWF “Biebrza National Park”project, ul. Antoniukowska 7 15-740 Bialystok, Poland. The report will be available as PDF-file on the website of WWF-Poland http://www.wwf.pl Cover Cattle versus Reed and Birch in the peat zone near Stojka, Biebrza National Park, Poland, photographed by Alexander van Braeckel. Inserted: European bison. CONTENTS page Preface 1 PART I: GENERAL CONCLUSIONS 1. Introduction. J. Bokdam & A. van Braeckel 5 2. Suitability. J. Bokdam & A. van Braeckel 10 3. Feasibility. J. Bokdam & A. van Braeckel 17 4. Management recommendations. J. Bokdam & A. van Braeckel 24 5. Research recommendations. J. Bokdam & A. van Braeckel 26 PART II : PAPERS Session I: Orientation Biebrza National Park. Management targets and problems – animal species and their habitat 31 requirements. A Sienko Biebrza National Park. Management targets and problems – plants and vegetation. C. -

Changes in the List of Finnish Insects During 2001–2005
© Entomologica Fennica. 6 June 2007 Changes in the list of Finnish insects during 2001–2005 Hans Silfverberg Silfverberg, H. 2007: Changes in the list of Finnish insects during 2001–2005. — Entomol. Fennica 18: 82–101. During the period 2001–2005, 769 species have been added to the list of Finnish insects, and 213 species have been deleted from it. At the end of year 2005, a total of 20,533 insect species were known from Finland. The Finnish insect fauna is generally well known. Still, particularly for Diptera Nematocera and Hymenop- tera Parasitica, and to some degree also in part of Hemiptera, there still remains much to be done. H. Silfverberg, Zoological Museum, P.O.Box 26, 00014 Helsingfors, Finland. E-mail: [email protected] Received 10 March 2006, accepted 23 May 2006 1. Introduction ported, and has not been included in the species total. Again square brackets have been employed This paper is a sequel to a similar list published in for the name used in the original record when dif- 2001 (Silfverberg 2001, Entomol. Fennica 12: ferent from the one used here. Other symbols are 227–243), which itself was a continuation of a se- * = new to science and ! = different from the ries of lists published in 1921–1996 first by check list mentioned for the order. Hellén and then by Silfverberg. Insect species A thorough examination of earlier lists added to the fauna of Finland during the five-year showed that a few species had been added twice. period are listed, with references, as are those de- In order to correct the numbers, corresponding leted from the fauna. -

Suomen Yöperhosseuranta (Nocturna) 1993–2012
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 15 | 2016 Raportti kokoaa yhteen Valtakunnallisen yöperhosseurannan (Nocturna) YÖPERHO SUOMEN ensimmäisen 20 toimintavuoden (1993–2012) keskeiset tulokset. Suomen yöperhosseuranta Seurannassa on seurattu metsäympäristöjen yöperhosyhteisöjen muutoksia koko Suomen kattavan valopyydysverkoston avulla. (Nocturna) 1993–2012 Yöperhosyhteisöissä on jakson aikana todettu huomattavia muutoksia, jotka todennäköisesti liittyvät ilmaston lämpenemiseen ja ympäristön rehevöitymiseen typpilaskeuman seurauksena. Raportissa ehdotetaan SS joukko toimenpiteitä yöperhosseurannan kehittämiseksi jatkossa. ( EURANTA Reima Leinonen, Juha Pöyry, Guy Söderman ja Liisa Tuominen-Roto N octurna) 1993–2012 SUOMEN YMPÄRI S ISBN 978-952-11-4564-3 (nid.) TÖKE ISBN 978-952-11-4565-0 (PDF) S ISSN 1796-1718 (pain.) KUS ISSN 1796-1726 (verkkojulk.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 15 | 2016 Suomen yöperhosseuranta (Nocturna) 1993–2012 Reima Leinonen, Juha Pöyry, Guy Söderman ja Liisa Tuominen-Roto Helsinki 2016 Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15 | 2016 Suomen ympäristökeskus Luontoympäristökeskus Taitto: Erika Várkonyi Kuvat: Reima Leinonen, Esa Hujanen ja Pekka Malinen. Kartat ja graafit: Juha Pöyry ja Reima Leinonen Julkaisu on saatavana vain internetistä: www.syke.fi/julkaisut | helda.helsinki.fi/syke ISBN 978-952-11-4564-3 (nid.) ISBN 978-952-11-4565-0 (PDF) ISSN 1796-1718 (pain.) ISSN 1796-1726 (verkkojulk.) Julkaisun otsikko: Suomen yöperhosseuranta (Nocturna) 1993–2012 Kirjoittajat: -

Checklist of Lithuanian Diptera
LIETUVOS ENTOMOLOGŲ DRAUGIJOS DARBAI. 1 (29) tomas 77 3 NEW AND 159 RARE FOR THE LITHUANIAN FAUNA LEPIDOPTERA SPECIES RECORDED IN 2016–2017 GIEDRIUS ŠVITRA, VITALIJUS BAČIANSKAS, RAMŪNAS KVIETKAUSKAS, DARIUS MIKALAUSKAS, TOMAS ŪSAITIS Lithuanian Entomological Society, Akademijos 2, LT-08412 Vilnius, Lithuania E-mail of corresponding author: [email protected] Introduction New data on 3 new and 159 rare moths and butterfly species registered in 43 administrative districts and municipalities of Lithuania in 2016–2017 is presented in this article. Seven species (Lycaena dispar, Phengaris teleius, Euphydryas maturna, Euphydryas aurinia, Coenonympha hero, Parnassius mnemosyne, and Lopinga achine) are protected in the European Union according to the Habitats Directive (Council Directive..., 1992). These species are also included into the Red Data Book of Lithuania (Rašomavičius, 2007). Additionally, the following species that we report in this paper are protected in Lithuania: Zygaena angelicae, Zygaena ephialtes, Zygaena loti, Synanthedon vespiformis, Papilio machaon, Erynnis tages, Carterocephalus palaemon, Phengaris arion, Phengaris alcon, Glaucopsyche alexis, Eumedonia eumedon, Polyommatus dorylas, Lysandra coridon, Brenthis daphne, Brenthis hecate, Melitaea aurelia, Melitaea diamina, Coenonympha tullia, Oeneis jutta, Epirrhoe tartuensis, Baptria tibiale, Macaria carbonaria, Chariaspilates formosaria, Litoligia literosa, Agrotis ripae, and Tyria jacobaeae. Three species (Chamaesphecia nigrifrons, Idaea ochrata and Peribatodes rhomboidaria) were recorded in Lithuania for the first time. Material and Methods Butterflies and moths were recorded by the authors of this paper G. Švitra (G.Š.), V. Bačianskas (V.Ba.), R. Kvietkauskas (R.Kv.), D. Mikalauskas (D.Mik.), and T. Ūsaitis (T.Ū.) during field trips. Other data was kindly presented for this publication by A. Čerkauskas (A.Č.), R.