Joseph Haydn (1732–1809) Missa in Angustiis – Nelsonmesse (Hob
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Table of Contents
Sheet TM Version 2.0 Music 1 CD Haydn, Mozart, and Beethoven Major Choral Works Table of Contents Welcome to the CD Sheet Music™ edition of Haydn, Mozart, and Beethoven, The Major Choral Works. This Table of Contents is interactive. Click on a title below or in the book- marks section on the left side of the screen to open the sheet music. Once the music is open, the bookmarks become navigation aids to find the score or parts of the work. Return to the table of contents by clicking on the bookmark or using the “back” button of Acrobat Reader™. By opening any of the files on this CD-ROM, you agree to accept the terms of the CD Sheet Music™ license (Click on the bookmark to the left for the complete license agreement). Composers on this CD-ROM HAYDN MOZART BEETHOVEN The complete Table of Contents begins on the next page © Copyright 2005 by CD Sheet Music, LLC Sheet TM Version 2.0 Music 2 CD FRANZ JOSEPH HAYDN WOLFGANG AMADEUS MOZART The Creation (Die Schöpfung) Veni Sancte Spiritus, K. 47 Part I Te Deum in C Major, K. 141/66b Part II Mass in F, K. 192 Part III Litaniae Lauretanae in D Major, K. 195/186d Mass No. 3 in C Major (Missa Cellensis) (Mariazellermesse) Mass in C Major, K. 258 (Missa Brevis) Mass No. 6 in G Major Missa Brevis in C Major, K. 259 (Organ Solo) (Mass in Honor of Saint Nicholas) Sancta Maria, Mater Dei, K. 273 Mass No. 7 in B Major b Mass in Bb Major, K. -

Missa Brevis Harmoniemesse
HAYDN Missa brevis (1749) Harmoniemesse Trinity Choir • REBEL Baroque Orchestra J. Owen Burdick • Jane Glover 8.572126 Haydn masses-Missa brevis 1749 booklet.indd 1 23/09/2010 13:54 Joseph HAYDN (1732–1809) Missa brevis 11:41 in F major (Hob.XXII:1; 1749) 1 Kyrie 1:03 2 Gloria 1:34 3 Credo 2:39 4 Sanctus 0:59 5 Benedictus 2:55 6 Agnus Dei 1:27 7 Dona nobis pacem 1:04 Ann Hoyt, soprano 1 • Julie Liston, soprano 2 Richard Lippold, bass Trinity Choir Rebel Baroque Orchestra Jörg Michael Schwarz, leader J. Owen Burdick 8.572126 2 8.572126 Haydn masses-Missa brevis 1749 booklet.indd 2 23/09/2010 13:54 Joseph HAYDN (1732–1809) Missa brevis 11:41 Missa, ‘Harmoniemesse’ 40:30 in F major in B flat major (Hob.XXII:1; 1749) (Hob.XXII:14; 1802) 1 Kyrie 1:03 8 Kyrie 7:09 2 Gloria 1:34 9 Gloria 1:59 3 Credo 2:39 0 Gratias agimus tibi 5:16 4 Sanctus 0:59 ! Quoniam tu solus sanctus 3:17 5 Benedictus 2:55 @ Credo 2:44 6 Agnus Dei 1:27 # Et incarnatus est 3:04 7 Dona nobis pacem 1:04 $ Et resurrexit 2:44 % Et vitam venturi 1 2 1:45 Ann Hoyt, soprano 1 • Julie Liston, soprano 2 ^ Sanctus 2:45 Richard Lippold, bass & Benedictus 4:08 Trinity Choir * Agnus Dei 2:37 Rebel Baroque Orchestra ( Dona nobis pacem 3:02 Jörg Michael Schwarz, leader J. Owen Burdick Nacole Palmer, soprano • Nina Faia, soprano 1 Kirsten Sollek, alto • Daniel Mutlu, tenor Matthew Hensrud, tenor 2 • Andrew Nolen, bass Trinity Choir Rebel Baroque Orchestra Jörg Michael Schwarz, leader Jane Glover 3 8.572126 8.572126 Haydn masses-Missa brevis 1749 booklet.indd 3 23/09/2010 13:54 Haydn’s Masses The ‘father of the symphony’ and master of for composing in sixteen parts before I understood two- conversational wit in the string quartet, [Franz] Joseph part setting.’3 Reutter’s instruction was predominantly Haydn is viewed today principally in the light of his practical in nature; although Haydn remembered only instrumental music. -

Sacred Music, 136.4, Winter 2009
SACRED MUSIC Winter 2009 Volume 136, Number 4 EDITORIAL Viennese Classical Masses? | William Mahrt 3 ARTICLES Between Tradition and Innovation: Sacred Intersections and the Symphonic Impulse in Haydn’s Late Masses | Eftychia Papanikolaou 6 “Requiem per me”: Antonio Salieri’s Plans for His Funeral | Jane Schatkin Hettrick 17 Haydn’s “Nelson” Mass in Recorded Performance: Text and Context | Nancy November 26 Sunday Vespers in the Parish Church | Fr. Eric M. Andersen 33 REPERTORY The Masses of William Byrd | William Mahrt 42 COMMENTARY Seeking the Living: Why Composers Have a Responsibility to be Accessible to the World | Mark Nowakowski 49 The Role of Beauty in the Liturgy | Fr. Franklyn M. McAfee, D.D. 51 Singing in Unison? Selling Chant to the Reluctant Choir | Mary Jane Ballou 54 ARCHIVE The Lost Collection of Chant Cylinders | Fr. Jerome F. Weber 57 The Ageless Story | Jennifer Gregory Miller 62 REVIEWS A Gift to Priests | Rosalind Mohnsen 66 A Collection of Wisdom and Delight | William Tortolano 68 The Fire Burned Hot | Jeffrey Tucker 70 NEWS The Chant Pilgrimage: A Report 74 THE LAST WORD Musical Instruments and the Mass | Kurt Poterack 76 POSTSCRIPT Gregorian Chant: Invention or Restoration? | William Mahrt SACRED MUSIC Formed as a continuation of Caecilia, published by the Society of St. Caecilia since 1874, and The Catholic Choirmaster, published by the Society of St. Gre- gory of America since 1915. Published quarterly by the Church Music Associ- ation of America. Office of Publication: 12421 New Point Drive, Harbour Cove, Richmond, VA 23233. E-mail: [email protected]; Website: www.musicasacra.com Editor: William Mahrt Managing Editor: Jeffrey Tucker Editor-at-Large: Kurt Poterack Editorial Assistance: Janet Gorbitz and David Sullivan. -

Read Michael Driscoll's Progam Notes
FROM THE MUSIC DIRECTOR The idea for this program began with Haydn’s Missa in angustiis, which roughly translates as “Mass for Troubled Times.” The exact reasons why Haydn titled this Mass as being for “troubled times” are not known for sure, but scholars have suggested several possible reasons for this particular title. One is that Haydn, by then in his mid‐ 60s, had recently been quite ill. Another is that he had to compose the Mass in a short six‐week period. A third possibility is that the usual orchestral forces available to him were restricted because his patron, Nikolaus II, was experiencing financial troubles as a result of political and financial instability in Europe. Related to that, Napoleon and the French were threatening Austria yet again. Perhaps it was a combination of all of these factors that prompted Haydn to label the work “in angustiis.” (The work later also became popularly known as the “Lord Nelson Mass,” though the reason for this association is not entirely clear.) Once I settled on the Haydn Mass, I began thinking about other works which might complement it. I eventually discovered David Conte’s September Sun, a work written in memory of those who perished on September 11, 2001. September Sun depicts the chaos of that dreadful day before concluding on an elegiac tone. Given the conflict inherent in both the Haydn and Conte works, I wanted to end the concert on a more optimistic note, and so I added Mack Wilberg’s arrangement of the African‐American spiritual Peace Like a River. -
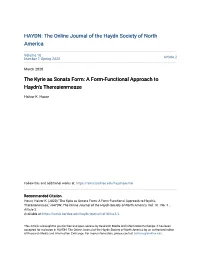
A Form-Functional Approach to Haydn's Theresienmesse
HAYDN: The Online Journal of the Haydn Society of North America Volume 10 Number 1 Spring 2020 Article 2 March 2020 The Kyrie as Sonata Form: A Form-Functional Approach to Haydn's Theresienmesse Halvor K. Hosar Follow this and additional works at: https://remix.berklee.edu/haydn-journal Recommended Citation Hosar, Halvor K. (2020) "The Kyrie as Sonata Form: A Form-Functional Approach to Haydn's Theresienmesse," HAYDN: The Online Journal of the Haydn Society of North America: Vol. 10 : No. 1 , Article 2. Available at: https://remix.berklee.edu/haydn-journal/vol10/iss1/2 This Article is brought to you for free and open access by Research Media and Information Exchange. It has been accepted for inclusion in HAYDN: The Online Journal of the Haydn Society of North America by an authorized editor of Research Media and Information Exchange. For more information, please contact [email protected]. 1 Hosar, Halvor K. “The Kyrie as Sonata Form: A Form-Functional Approach to Haydn’s Theresienmesse.” HAYDN: Online Journal of the Haydn Society of North America 10.1 (Spring 2020), http://haydnjournal.org. © RIT Press and Haydn Society of North America, 2020. Duplication without the express permission of the author, RIT Press, and/or the Haydn Society of North America is prohibited. The Kyrie as Sonata Form: A Form-Functional Approach to Haydn’s Theresienmesse1 By Halvor K. Hosar I. Introduction The theories of William Caplin, James Hepokoski and Warren Darcy have done much to revitalize the dormant Formenlehre tradition, by devising new analytical -

JEFFREY THOMAS Music Director
support materials for our recording of JOSEPH HAYDN (732-809): MASSES Tamara Matthews soprano - Zoila Muñoz alto Benjamin Butterfield tenor - David Arnold bass AMERICAN BACH SOLOISTS AMERICAN BACH CHOIR • PACIFIC MOZART ENSEMBLE Jeffrey Thomas, conductor JEFFREY THOMAS music director Missa in Angustiis — “Lord Nelson Mass” soprano soloist’s petition “Suscipe” (“Receive”) is followed by the unison choral response “deprecationem nostram” (“our Following the extraordinary success of his two so- prayer”). journs in London, Haydn returned in 1795 to his work as Kapellmeister for Prince Nikolas Esterházy the younger. The Even in the traditionally upbeat sections of the liturgy, Prince wanted Haydn to re-establish the Esterházy orchestra, the frequent turns to minor harmonies invoke the upheaval disbanded by his unmusical father, Prince Anton. Haydn’s re- wrought by war and disallow a sense of emotional—and au- turn to active duty for the Esterházy family did not, however, ditory—complacency. After the optimistic D-major opening signify a return to the isolated and static atmosphere of the of the Gloria, for example, the music slips into E minor at the relatively remote Esterházy palace, which had been given up words “et in terra pax hominibus” (“and peace to His people after the elder Prince Nikolas’s death in 1790. Haydn was now on earth”); throughout the section, D-minor inflections cloud able to work at the Prince’s residence in Vienna for most of the laudatory mood of the first theme and the text in general. the year, retiring to the courtly lodgings at Eisenstadt during The Benedictus is even more startling. -

Sacred Music Volume 109 Number 4
SACRED MUSIC Volume 109, Number 4, 1982 Eisenstadt Palace, garden front. SACRED MUSIC Volume 109, Number 4, 1982 FROM THE EDITORS Haydn in Vienna: the Late Years (1795-1809) Archbishop Weakland Cardinal Bernadin Music in our Church Schools WHY HAYDN WROTE HIS CHURCH MUSIC Otto Biba A LATIN HIGH MASS IN UPPER MICHIGAN Milton Olsson 11 Charles Nelson A CHRONICLE OF THE REFORM Part IV: Musicam sacrum 15 Monsignor Richard ). Schuler REVIEWS 22 NEWS 25 EDITORIAL NOTES 26 CONTRIBUTORS 27 INDEX TO VOLUME 109 28 SACRED MUSIC Continuation of Caecilia, published by the Society of St. Caecilia since 1874, and The Catholic Choirmaster, published by the Society of St. Gregory of America since 1915. Published quarterly by the Church Music Association of America. Office of publications: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103. Editorial Board: Rev. Msgr. Richard J. Schuler, Editor Rev. Ralph S. March, S.O. Cist. Rev. John Buchanan Harold Hughesdon William P. Mahrt Virginia A. Schubert Cal Stepan Rev. Richard M. Hogan Mary Ellen Strapp Judy Labon News: Rev. Msgr. Richard J. Schuler 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 Music for Review: Paul Salamunovich, 10828 Valley Spring Lane, N. Hollywood, Calif. 91602 Rev. Ralph S. March, S.O. Cist., Eintrachstrasse 166, D-5000 Koln 1, West Germany Paul Manz, 7204 Schey Drive, Edina, Minnesota 55435 Membership, Circulation and Advertising: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 CHURCH MUSIC ASSOCIATION OF AMERICA Officers and Board of Directors President Monsignor Richard J. Schuler Vice-President Gerhard Track General Secretary Virginia A. Schubert Treasurer Earl D. Hogan Directors Mrs. -

Download Booklet
ne of the many delights of being Artistic Director of America’s oldest continuously fact that he was writing for a paying audience, but also the press and their daily music criticism Operforming arts organisation, the Handel and Haydn Society (H+H), is that I am given – something which didn’t happen on the continent. London loved him and his Symphony the opportunity to present most of our concert season at Boston’s glorious Symphony Hall. No. 99 was not to disappoint. One critic hailed it as “a composition of the most exquisite kind, Built in 1900, it is principally the home of the Boston Symphony Orchestra, but it has been rich, fanciful, bold and impressive”. The woodwind writing in the second movement Adagio is our primary performance home since 1900 as well, and it is considered by many, with some simply exemplary and demonstrates his mastery of symphonic art. Haydn was out to enlighten justification I would add, to be one of the finest concert halls in the world. It is that classic and delight and its Finale certainly achieves the latter. He litters the movement with numerous ‘shoebox style’ reminiscent of the Musikverein in Vienna; the acoustics are quite superb and, jokes of instrumentation and the overall effect is quite simply breathtaking. despite its size – c.2500 capacity – perfect for playing on period instruments. I feel very privileged to have taken this august Society into its Bicentennial; yes, the Handel On this live recording, we present a programme devoted to our namesake, Haydn. Having and Haydn Society was founded in 1815. -

Joseph Haydn
Joseph Haydn Harmoniemesse Mass in Bb First performance: September 8, 1802 Vocal soloists (SATB) Chorus (SATB) Orchestra: Flute, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets, timpani, strings, organ ***************** Program notes by Martin Pearlman Composed in 1802, Haydn's Harmoniemesse is his last completed composition. By that time, the seventy-year old Haydn, celebrated as the greatest living composer, held what was essentially an emeritus position, sitting at table with Prince Esterhazy himself and being obliged only to compose one mass each year to commemorate the princess's name day. But composing a major choral work each year was taxing on a man who felt himself to be old and in failing health, and he was no doubt glad to be freed of this obligation for the future. The Harmoniemesse was given its first performance on September 8 of 1802, the princess's name day, at a mass in her honor. After the mass, the invited guests returned to the Esterhazy palace for a dinner which offered scores of various dishes and many fine wines. The round of toasts, including one to Haydn, was punctuated by trumpets and drums in the gallery and the sound of cannon from outside the hall. The evening concluded with a ball. The Harmoniemesse, named for its unusually large "Harmonie" (or wind) section, is the last -- and many would say the greatest -- of the series of six masses which Haydn wrote toward the end of his life. It has always been held in special esteem by musicians and others who knew it, but, being a mass, it has never enjoyed the wide popularity of his two great oratorios, The Creation and The Seasons, which date from the same period. -
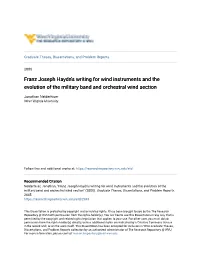
Franz Joseph Haydn's Writing for Wind Instruments and the Evolution of the Military Band and Orchestral Wind Section
Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2008 Franz Joseph Haydn's writing for wind instruments and the evolution of the military band and orchestral wind section Jonathan Neiderhiser West Virginia University Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Recommended Citation Neiderhiser, Jonathan, "Franz Joseph Haydn's writing for wind instruments and the evolution of the military band and orchestral wind section" (2008). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 2845. https://researchrepository.wvu.edu/etd/2845 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. Franz Joseph Haydn‟s Writing for Wind Instruments and the Evolution of the Military Band and Orchestral Wind Section Jonathan Neiderhiser Research Project submitted to the College of Creative Arts at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in Performance: Conducting Dr. Kathleen Shannon, chair Prof. John Hendricks Dr. Mary Ferer Dr. -

Sacred Music Volume 110 Number 2
SACRED MUSIC Volume 110, Number 2 (Summer) 1983, The Holy Year Interior, Basilica of Saint Paul without the Walls SACRED MUSIC Volume 110, Number 2, Summer 1983 The Holy Year FROM THE EDITORS Music in the Church Universal 3 Documents on the Liturgy 4 About the Pictures 4 JOSEPH HAYDN'S MISSA IN ANGUSTIIS: HISTORY, ANALYSIS AND PERFORMANCE SUGGESTIONS Stephen Town 5 A CHRONICLE OF THE REFORM Part VI: Music in Catholic Worship Monsignor Richard ]'. Schuler 11 THE INTERNATIONAL GREGORIAN CHANT SYMPOSIUM Paul LeVoir 17 REVIEWS 22 NEWS 17 CONTRIBUTORS 28 SACRED MUSIC Continuation of Caecilia, published by the Society of St. Caecilia since 1874, and The Catholic Choirmaster, published by the Society of St. Gregory of America since 1915. Published quarterly by the Church Music Association of America. Office of publications: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103. Editorial Board: Rev. Msgr. Richard J. Schuler, Editor Rev. Ralph S. March, S.O. Cist. Rev. John Buchanan Harold Hughesdon William P. Mahrt Virginia A. Schubert Cal Stepan Rev. Richard M. Hogan Mary Ellen Strapp Judy Labon News: Rev. Msgr. Richard J. Schuler 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 Music for Review: Paul Salamunovich, 10828 Valley Spring Lane, N. Hollywood, Calif. 91602 Rev. Ralph S. March, S.O. Cist., Eintrachstrasse 166, D-5000 Koln 1, West Germany Paul Manz, 7204 Schey Drive, Edina, Minnesota 55435 Membership, Circulation and Advertising: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 CHURCH MUSIC ASSOCIATION OF AMERICA Officers and Board of Directors President Monsignor Richard J. Schuler Vice-President Gerhard Track General Secretary Virginia A. Schubert Treasurer Earl D. -

Lord Nelson Mass Bears the Robbins Landon Observes, “The Total “Writ Large.” in His Role As Father of the Supreme Achievements in Western Music
furloughed for the summer and fall near the end: the musical realization of About the Music months. Although Haydn sanctioned the the desire for a state of grace.” addition of wind parts for publication As the so-called Father of the Symphony, and later performance, the raw sound Haydn intended his music to project a of the original version remains extremely “communal voice,” and to express musi- The late Masses of Joseph Haydn Like its predecessor, the 1796 Mass in Time effective. As the Haydn scholar H.C. cal ideas that were, in his own words, (1732–1809) count as one of the of War, the Lord Nelson Mass bears the Robbins Landon observes, “the total “writ large.” In his role as Father of the supreme achievements in Western music. stamp of the great European conflict that absence of wind parts, the solemn key of String Quartet, he mastered the art of In the 1790s, the decade after Mozart’s erupted from the French Revolution and D minor, and the acid, biting texture of conversation among instruments, and by death, Haydn was hailed across Europe as the rise of Napoleon. The summer of the trumpets, all lend a special kind of extension, among voices. Hailed by his the undisputed master of the symphony 1798, when Haydn composed the Mass, asperity to the music.” The choral and contemporaries as a musical Shakespeare, and the string quartet. Freed from service saw the Hapsburg empire in a tense solo writing is highly dramatic, and he understood profoundly the techniques —which he often experienced as servitude cease-fire with the French Republic.