Wirtschaft Der Verschwendung Die Biologie Der Allmende
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
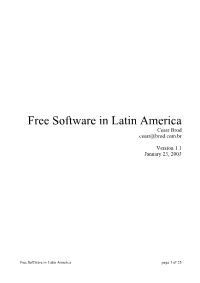
Free Software in Latin America Cesar Brod [email protected]
Free Software in Latin America Cesar Brod [email protected] Version 1.1 January 23, 2003 Free Software in Latin America page 1 of 25 Revision History Version Date Comments Author First public available version before proof-reading. Draft 1 06.11.2002 Cesar Brod Expect some errors. Draft 2 10.11.2002 Text review, proof reading Cesar Brod Added text on the First National Free Software Forum for Universities in Brasil (São Carlos) V 1.0 19.11.2002 Cesar Brod Added text on São Carlos city project for free software adoption – page 12 Consolidation of several research data on the overall ICT usage in Latin America V 1.1 22.01.2003 Cesar Brod Overall review Free Software in Latin America page 2 of 25 Table of Contents Revision History...................................................................................................................................2 Acknowledgements..............................................................................................................................4 Executive Summary..............................................................................................................................5 The ICT presence in Latin America.....................................................................................................8 An overview of the presence of Free Software17 in Latin American Countries.................................13 Free Software in Mexico....................................................................................................................14 GNOME.........................................................................................................................................14 -
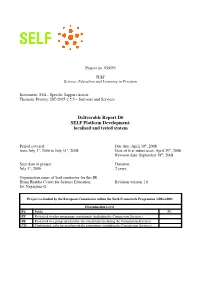
Deliverable Report D6 SELF Platform Development: Localised and Tested System
Project no. 034595 SELF Science, Education and Learning in Freedom Instrument: SSA - Specific Support Action Thematic Priority: IST-2005-2.5.5 ± Software and Services Deliverable Report D6 SELF Platform Development: localised and tested system Period covered: Due date: April 30th, 2008 from July 1st, 2006 to July 31st, 2008 Date of first submission: April 29th, 2008 Revision date: September 18th, 2008 Start date of project: Duration: July 1st, 2006 2 years Organisation name of lead contractor for this IR Homi Bhabha Center for Science Education Revision version 1.0 Dr. Nagarjuna G. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme (2002-2006) Dissemination Level PU Public PU PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) RE Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) Table of Contents Acknowledgements ......................................................................................................................... 3 1 Introduction .................................................................................................................................. 4 2 Roadmap and Development Methodology ................................................................................... 5 3 Setting up the Server Infrastructure .............................................................................................. 6 3.1 Technical specifications -

SOFTWARE LIBRE Pollíticas Del Estado Venezolano
SOFTWARE LIBRE Pollíticas del Estado Venezolano. El Estado Venezolano se apropia de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y las tecnologías de información y comunicación para ponerlas al alcance de todos y transformarlas en herramientas que sirvan para el desarrollo económico, social y político del país. Dentro del universo de las tecnologías de comunicación e información (TICs) se encuentra el SOFTWARE. ¿Que es el software libre ? Son los programas que se encuentran dentro de un computador. El cerebro que hace funcionar el computador y que determina gran parte de la rapidez de los inmensos flujos de información dentro de cualquier sistema. Dos tipos de software Propietario: no permite modificar, estudiar, copiar o redistribuir el programa. Libre: permite que usted pueda modificar, estudiar, copiar o redistribuir el programa y ejecutarlo con cualquier propósito de tal manera que satisfaga sus necesidades. Caso Venezuela Actualmente, en Venezuela, los procesos y aplicaciones de la administración pública utilizan software propietario. Pero, algunas experiencias sirvieron para entender que el control de las operaciones medulares de nuestro país, no puede depender de las decisiones que toman las grandes corporaciones internacionales vinculadas con las innovaciones o las TICs. Por ello el gobierno venezolano decreto "el uso y aplicación del software libre en la administración publica" (3.390); para resguardar nuestra seguridad y soberanía. El software libre se ha consolidado como alternativa técnicamente viable y económicamente sostenible ante el software propietario y además constituye el sustrato tecnológico para construir una sociedad del conocimiento igualitaria, libre, solidaria, fraterna y sustentable. 4 Libertades se traducen en beneficios − Libertad para ejecutar el programa, es decir hacerlo funcionar con cualquier propósito. -

Seminario De Formación De Formadores En GNU/Linux Y Openoffice 1
Seminario de Formación de Formadores en GNU/Linux y OpenOffice 1. Software Libre: lecturas para el primer encuentro Software libre para una sociedad libre , Richard M. Stallman . Introducción de Lawrence Lessig (archivo softlibre enriquecido.pdf) Introducción al software libre , Jordi Mas Hernández y David Megías Jiménez (coordinadores) , de Jesús M. González Barahona , Joaquín Seoane Pascual y Gregorio Robles , © 2008, FUOC Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (archivos uoc_SL1.pdf, uoc_SL2.pdf y uoc_SL3_apendices.pdf) En el principio fue... la línea de comandos , de Neal Stephenson (archivo enelprincipio.pdf) Software libre vs software propietario . Ventajas y desventajas, de Culebro Juárez, Montserrat., Gómez Herrera, Wendy Guadalupe y Torres Sánchez, Susana, México, Mayo 2006. (archivo Juarez Montserrat - Software Libre Vs Software Propietario.PDF) 2. Software Libre: lecturas complementarias ¿Por qué usar programas abiertos? ¡Atención a las cifras!, de David A. Wheeler, revisado el 25 de enero de 2001(archivo xq_software_libre.odt) Software libre: técnicamente viable, económicamente sostenible y socialmente justo , de Jordi Mas i Hernàndez (archivo Hernandez Jordi - Software Libre Viable Sostenible Y Justo.PDF) Guía Práctica sobre Software Libre su selección y aplicación local en américa LATINA y el Caribe , de Fernando da Rosa y Federico Heinz, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , © UNESCO 2007 , ISBN 92-9089-103-3 . (archivo GSL.pdf) LA CATEDRAL Y EL BAZAR , por Eric S. Raymond -

Guía Práctica Sobre Software Libre Su Selección Y Aplicación Local En América LATINA Y El Caribe
Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe U N E S C O Sector Comunicación e Información UNESCO Montevideo Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Guía Práctica sobre Software Libre su selección y aplicación local en américa LATINA y el Caribe Fernando da Rosa Federico Heinz Guía Práctica sobre Software Libre su selección y aplicación local en américa Latina y el Caribe Los autores se hacen responsables por la elección y presentación de hechos que figuran en la presente publicación y por las opiniones que aquí expresan, las cuales no reflejan necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos, no implican de parte de la UNESCO juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. UNESCO Coordinador: Günther Cyranek Autores: Fernando da Rosa y Federico Heinz Otros colaboradores: Beatriz Busaniche y Gustavo Boksar Diseño de Portada e Imagen: Jorge Ambiado Crédito de las fotos: Foto de Linus Torvalds, Tomado de la Wikipedia bajo licencia GNU Free Documentation License con permiso de Martin Streicher, Editor en Jefe de LINUXMAG. Foto de Richard Stallman, Fotografía de Bill Ebbesen, licenciada como Dominio Público. Fotos de Latinoware 2006, LACFREE 2005, Jornadas Regionales 2004. Fotografías de Fernando da Rosa Mapa Conceptual del Software Libre: realizado originalmente por René Mérou, bajo licencia GPL. Modificado por Fernando da Rosa, Jorge Ambiado y Gustavo Boksar Por más información, por favor diríjase a: Günther Cyranek Sector de Comunicación e Información Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe Edificio MERCOSUR Dr. -

Software Libre - Para Trabajar En El Nivel Medio
Software libre - para trabajar en el nivel medio A nuestro amigo y compañero Lucho. Quien llegaba tarde a todos lados. Siempre corriendo, buscando su sueño. A Marcelo Duschkin, “Don Robot”... que antes de irse nos contagió su pasión por los chiches y nos mostró que la tortuga podía ser mucho más divertida de lo que parecía. Prólogo Iris Fernández, Franco Iacomella Software libre – para trabajar en el nivel medio es la obra de un grupo de profesionales interesados en la difusión de las ideas de la llamada “cultura libre”1 en el ámbito educativo. Entendemos que este concepto es un medio para formar personas comprometidas con el trabajo colaborativo, una vía para enseñar el valor del conocimiento y la cultura como bien común de la sociedad, que cada persona hereda de acuerdo a su contexto y donde los aportes que cada individuo realiza a estos bienes comunes no deben ser de carácter privado y exclusivo. Pensamos los bienes culturales como construcciones colectivas sin restricciones para su acceso, distribución y modificación. Creemos que la educación debe estar atravesada por esos valores y consideramos que la difusión de estas ideas en el ambiente educativo es el primer paso para introducir prácticas solidarias, colectivas y autónomas dentro de la sociedad. A través de esta obra intentamos acercar a los docentes de escuelas secundarias de Argentina una serie de conceptos y propuestas concretas de trabajo con software libre2, además de hacer una introducción al concepto de licencias de uso libre para materiales educativos, a través de las cuales los docentes pueden beneficiarse, al menos, de dos maneras: • Haciendo uso legítimo de obras creadas por sus colegas bajo licencias libres o en dominio público, • Compartiendo sus propias creaciones conservando la autoría y derechos sobre ellas, mediante la elección de una licencia que determine qué usos podrán hacer otras personas de su obra y cuales estarán reservados. -

Network Working Group J. Reynolds Request for Comments: 1700 J
Network Working Group J. Reynolds Request for Comments: 1700 J. Postel STD: 2 ISI Obsoletes RFCs: 1340, 1060, 1010, 990, 960, October 1994 943, 923, 900, 870, 820, 790, 776, 770, 762, 758,755, 750, 739, 604, 503, 433, 349 Obsoletes IENs: 127, 117, 93 Category: Standards Track ASSIGNED NUMBERS Status of this Memo This memo is a status report on the parameters (i.e., numbers and keywords) used in protocols in the Internet community. Distribution of this memo is unlimited. OVERVIEW This RFC is a snapshot of the ongoing process of the assignment of protocol parameters for the Internet protocol suite. To make the current information readily available the assignments are kept up-to- date in a set of online text files. This RFC has been assembled by catinating these files together with a minimum of formatting "glue". The authors appologize for the somewhat rougher formatting and style than is typical of most RFCs. We expect that various readers will notice specific items that should be corrected. Please send any specific corrections via email to <[email protected]>. Reynolds & Postel [Page 1] RFC 1700 Assigned Numbers October 1994 INTRODUCTION The files in this directory document the currently assigned values for several series of numbers used in network protocol implementations. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is the central coordinator for the assignment of unique parameter values for Internet protocols. The IANA is chartered by the Internet Society (ISOC) and the Federal Network Council (FNC) to act as the clearinghouse to assign and coordinate the use of numerous Internet protocol parameters. -

SELF Platform Development: System Design and Representation and Beta Release
Project no. 034595 SELF Science, Education and Learning in Freedom Instrument: SSA - Specific Support Action Thematic Priority: IST-2005-2.5.5 ± Software and Services Deliverable D5 SELF Platform Development: System design and representation and beta release Period covered: Date of first submission: May 31st 2007 From July 1st, 2006 to 31th May 2007 Date of revision: September 25th 2008 Start date of project: Duration: July 1st, 2006 2 years Organisation name of lead contractor for this Deliverable Homi Bhabha Center for Science Education Version 0.7 Nagarjuna G. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme (2002-2006) Dissemination Level PU Public PU PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) RE Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) Table of Contents Acknowledgements ......................................................................................................................... 3 Document History ........................................................................................................................... 4 1 Introduction .................................................................................................................................. 5 2 Software Selection for the Platform ............................................................................................. 6 2.1 ZOPE ......................................................................................................................................6 -

Descargar Comunicación Y Pedagogía 246-247
www.primerasnoticiastv.comp Estad atent@s a esta nueva plataforma de tv on line de la Asociación de Prensa Juvenil. Un espacio de comunicación audiovisual interactiva que trata de informar, formar y entretener, potenciando el periodismo juvenil ciudadano y la participación además de informarte de las novedades de la Asociación de Prensa Juvenil. Por supuesto, estáis invitad@s a colaborar enviando vuestros vídeos y noticias. Para contactar con el equipo de Primeras Noticias tv puedes utilizar el formulario que te facilita el propio programa. Un programa de Subvencionado por C&P DIRECTOR Alejandro Aliaga Alcolea Y duran, duran... CENTRO DE COMUNICACIÓN l Software Libre llegó para quedarse. Por mucho que nos quieran convencer los Y PEDAGOGÍA defensores del software privativo, a la pruebas nos remitimos. Nadie puede negar, Director tras años de implementación en gran parte de las Comunidades Autónomas espa- José D. Aliaga Serrano E ñolas, que el Software Libre está por debajo de los programas de pago en cuanto a presta- ciones, si no todo lo contrario: el empuje dado por la comunidad de Internet les pone, mu- CONSEJO chas veces, por delante. Eso sin hablar de su gratuidad... Además, el Software Libre puede DE REDACCIÓN alargar la vida de nuestros ordenadores. No sólo no cuesta ni un euro, sino que tampoco J. Ignacio Aguaded Gómez hemos de invertir en hardware... Universidad de Huelva Carmen Alba El único problema es que no todo el profesorado está al tanto de esto último. Por ello, Universidad Complutense desde Comunicación y Pedagogía se ha enfocado su especial anual dedicado al Software de Madrid Libre a la reutilización de viejos PCs. -

Software Libre Para Gente Pequeña.Pdf
Software Libre para gente pequeña Es un libro destinado a chicos de 3 a 12 años, propuestas de actividades sobre herramientas, software y contenidos educativos libres. Cada capítulo presenta grados de dificultad creciente y se orienta a niños de mayor edad, o más habituados a utilizar una computadora, comenzando desde los 3 años para el primer capítulo y llegando a los 99 en el final. Participaron en la elaboración de este libro: Fernando Pelillo, Patricio Acevedo, María Eugenia Núñez, María Jesús Rodríguez Arenas, Marisa Conde, Daniel Ajoy, Alejandro Joos, Óscar Noé Rodríguez Martínez, Ivan Zigaran, Emmanuel Cerino, Franco Iacomella, Iris Fernández, Liliana Saidón, Mabel Alejandra Barbella, Federico Heinz, María del Carmen Vázquez y Javier Castrillo. Otros proyectos similares, destinados a públicos diferentes, pueden descubrirse en http://sembrandolibertad.org.ar 1 Prólogo Este es un libro creado por un grupo de posible falta, incluimos enlaces 'ue lle#en a personas apasionadas por el software libre y los lectores m(s curiosos a seguir con muchas ganas de transmitir esa pasión a aprendiendo sobre cada uno de los temas. otras personas. )os autores somos originarios de #arios Nos propusimos recopilar en un libro pa%ses: *rgentina, Ecuador, España, +,-ico, destinado a chicos de 3 a ! años, propuestas Chile, /ruguay. Eso e-plica la diferencia de interesantes sobre herramientas, software y #ocabulario entre uno y otro cap%tulo. contenidos educati#os libres. $uscamos hacer Escribir es algo muy parecido a pintar un algo bre#e y atracti#o, donde cada cap%tulo cuadro. Elegir el pincel y el color e-acto, y la brinde un paso a paso de una actividad, sin cantidad de agua 0usta, me1clando un po'uito necesidad de definiciones o de mostrar la de uno y otro recipiente, es una tarea cuyos esencia de la herramienta. -

Commons, Die Idee Der Gemeinschaftlichen Verantwor- Tung Für Gemeingüter, Eine Renaissance Erleben – Nicht Erst Seit Dem Wirtschaftsnobelpreis 2009 Für Elinor Ostrom
2036 Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) � Die »Occupy«-Bewegung trägt ein Unbehagen auf die Straße – weltweit. Sie stellt Profitmaxi- mierung an den Pranger und der Politik einen Misstrauensantrag. Denn die Preise für Lebens- mittel, Wasser und Böden steigen, und begrenzt verfügbare Güter, wie die Meere oder Wälder, werden rücksichtslos ausgebeutet. Wissen und Ideen indes, unsere wichtigsten produktiven Ressourcen, sind zwar in Fülle vorhanden – doch sie werden behandelt, als wären sie knapp. Die ernüchternde Diagnose lautet: Sowohl Markt als auch Staat versagen. Deshalb verwundert es nicht, dass die Commons, die Idee der gemeinschaftlichen Verantwor- tung für Gemeingüter, eine Renaissance erleben – nicht erst seit dem Wirtschaftsnobelpreis 2009 für Elinor Ostrom. Commons sind wichtiger denn je. Sie beruhen nicht auf der Idee der Knappheit, sondern schöpfen aus der Fülle. Sie sind produktiv, ohne in erster Linie für den Markt zu produzieren. Sie existieren durch und für die Menschen und lösen konkrete Probleme. Für eine neue Politik Dieser Band mit Beiträgen von 90 internationalen Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft stellt ein modernes Konzept der Commons vor, das klassische Grund- annahmen der Wirtschafts- und Gütertheorie radikal in Frage stellt und ein Wegweiser für eine jenseits von neue Politik sein kann. � Markt und staat Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) Commons Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 1.1. Auflage: transcript Verlag, Bielefeld 2012 Dieses Werk erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz »BY SA 3.0. -

Public Money for Public Software the Battle for Linux in Munich DR
ONLINE-PUBLIKATION Markus Euskirchen Public Money for Public Software The battle for Linux in Munich DR. MARKUS EUSKIRCHEN is an advisor on matters relating to the Internet and digital justice at the Rosa-Luxemburg-Stiftung’s Institut für Gesellschaftsanalyse. He contributes to the blog http://netzfueralle.blog.rosalux.de IMPRINT ONLINE-Publikation 8/2018 is published by the Rosa-Luxemburg-Stiftung Responsible: Henning Heine Franz-Mehring-Platz 1 · 10243 Berlin, Germany · www.rosalux.de ISSN 2567-1235 · Editorial deadline: September 2018 Translation: Sally McPhail for lingua•trans•fair Proofreading: Marion Greenway Allen for lingua•trans•fair Layout/Production: MediaService GmbH Druck und Kommunikation CONTENT 1 Introduction 2 2 Unboxing open source 3 3 The history of GNU/Linux: Free Software for all 6 3.1 Hippies and mainframe computers 6 3.2 The PC as a technological expression of the neoliberal response 6 3.3 GNU/Linux, the anomaly in the regime of intellectual property 7 4 Cause and motivations for the change to a Linux-based system 8 4.1 Infrastructure sovereignty: Avoiding a lock-in 8 4.2 Stability and security 9 5 User-friendliness and compatibility: weak points to do with the system change in Munich 11 5.1 User sensitivities 11 5.2 Strategic and tactical problems 11 5.3 The discussion: LiMux as a whipping boy for all administrative blips 12 6 What can be done? How can it be helped? 14 6.1 Expanding the menu 14 6.2 Making positive impacts visible and factoring them in 14 6.3 Making digital administrative practice generally available and not privatizing it 15 7 Summary 17 3 1 INTRODUCTION In 2003, the City of Munich began to change over its administrative software from Microsoft to open source software, completed the changeover in 2013, and then decided at the end of 2017 to return to Microsoft.