Hotzenwald Und Hochrhein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amtsblatt Vom 17. Juli 2020
aktuell AMTSBLATT DER STADT ST. BLASIEN MIT DEN ORTSTEILEN MENZENSCHWAND UND ALBTAL FREITAG, 17. JULI 2020 / NR. 29 45. JAHRGANG HOHER BESUCH ABSCHIEDSFEIER Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am ver- gangenen Freitag St. Blasien besucht. Bei einer Dom- führung mit Thomas Mutter erhielt der Landesvater Am Sonntag kam die Domfestspielfamilie zu einer dabei spannende Einblicke in die Geschichte und Be- spontanen Abschiedsfeier für Pater Klaus Mertes auf deutung der Kuppelkirche. dem Domplatz zusammen. Zum Abschluss des Tages trug sich der Ministerpräsi- Die beiden Ehrenbürger Wolfgang Endres und Johann dent im Beisein von Landrat Dr. Martin Kistler und Bür- Meier erinnerten dabei an das Festspieljahr 2018 und germeister Adrian Probst auch in das Goldene Buch der Mertes‘ Zeit als Fürstabt. Landrat Dr. Kistler dankte dem Stadt ein. Kollegsdirektor für sein großes Engagement, das weit über die Grenzen St. Blasiens Beachtung und Anerken- nung fand. Jubilare der Woche Er verlieh ihm hierfür die Medaille des Landkreises in Silber. Bürgermeister Adrian Probst unterstrich in seiner Wir gratulieren recht herzlich Dankes- und Abschiedsrede seine Ho nung auf ein Wie- unseren Jubilaren. dersehen in der Domstadt. Flora Schmidle, Hasenmat 27 19.07.1945 75 Jahre In diesem Sinne wünscht St. Blasien Pater Mertes alles Wolfgang Weber, Kirchweg 4 Gute und Gottes Segen! 20.07.1950 70 Jahre Allen Jubilaren herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 2 | FREITAG, 17. JULI 2020 Mitteilungsblatt der Gemeinde St. Blasien Notrufe Bereitschaftsdienste · Ärzte · Apotheken Rathaus St. Blasien Apotheken-Notdienste Am Kurgarten 11, 79837 St. Blasien 0 76 72 / 414 40 (von 8.30 Uhr bis folgenden Tag 8.30 Uhr) Öf nungszeiten: Samstag, 18.07.2020 Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Tit see-Apotheke Dienstag bis Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Jägerstr. -

Albbruck, Unsere Gemeinde
Albbruck, unsere Gemeinde Albbruck Buch Birkingen Schachen Birndorf Unteralpfen Albbruck, unsere Gemeinde 1 Herzlich willkommen in Albbruck, unserer Gemeinde! Diese Präsentation soll einen kurzen Einblick geben in die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in unserer Gemeinde, aber auch im nahen Umkreis. Sie soll dem Einheimischen wie dem Besucher Ideengeber sein und Anreiz, Neues zu entdecken und Altbekanntes mit anderen Augen zu sehen. Viel Spaß! Stefan Kaiser Bürgermeister Albbruck, unsere Gemeinde 2 Inhaltsverzeichnis 1. Die Gesamtgemeinde 5. Wandervorschläge 2. Die Ortsteile 6. Touren-Vorschläge 2.1. Albbruck mit dem Fahrrad 2.2. Birkingen 7. Touren-Vorschläge 2. 3. Birndorf mit dem Auto 2.4. Buch 8. Auf den Spuren der 2.5. Schachen Salpeterer 2. 6. Unteralpfen 9. Sagen, Legenden und 3. Geschichtliche Hintergründe Geschichten aus und 4. Die Iburg um Albbruck Albbruck, unsere Gemeinde 3 1. Die Gesamtgemeinde Albbruck zentrale Lage am Hochrhein (320 – 700 m.ü.M.), am Südhang des ShSchwarzwa ldes un ddd des Hotzenwaldes gegründet am 01.01.1975 aus den Ortsteilen Albbruck, Birkingen, Buch und Unteralpfen derzeit ca. 7.500 Einwohner hervorragende Wandermöglichkeiten vielfältige Ausflugsmöglichkeiten in den Schwarzwald , an den Bodensee , in die Schweiz oder das Elsaß Albbruck, unsere Gemeinde 4 1.1. Hintergründe Das Albtal Das steil abfallende Albtal markiert die östliche Grenze des Hotzenwaldes und ist seit 1943 Landschaftsschutzgebiet. Neben den imposanten Felswänden machen urtümliche, bodensaure Mischwaldbestände (Nadelholz, Eiche, Ahorn und Linde) den besonderen Reiz des Tales aus. Lange war das Albtal unpassierbar, der Weg von Albbruck nach St. Blasien führte über Birndorf und Unteralpfen nach Niedermühle. Erst ab 1854 wurde die Albtalstraße erbaut, der schwierigste Abschnitt Hohenfels-Tiefenstein machte fünf Felstunnels erforderlich. -

Hochrhein – Hotzenwald – Hochschwarzwald Ihre Freizeitbusse Im Südschwarzwald
Kontaktadressen Tour West: „Erfahren” Sie mit KONUS und dem WTV die Sehenswürdigkeiten des Landkreises Waldshut! 79713 Bad Säckingen, Tourismus GmbH, Waldshuter Straße 20, Tel.: 07761-56830, Genießen Sie unbeschwertes Reisen durch die einzigartige Landschaft zwischen E-Mail: [email protected] Feldberg und Hochrhein und erkunden Sie den Südschwarzwald einmal stress- 79872 Bernau, Tourist-Information, Rathausstraße 18, frei ohne Auto. Kombinieren Sie Ihre Tour mit einer Wanderung oder einer Tel.: 07675-160030, E-Mail: [email protected] Radtour bei uns im Naturpark Südschwarzwald. Mit den für Sie ausgewählten Fahrplanausschnitten für Bus und Bahn können Sie Ihren ganz individuellen 79875 Dachsberg-Wittenschwand, Tourist-Information, Rathausstr. 1, Ausflug planen; mit einer attraktiven 24-Stunden-Karte* des WTV oder sogar Tel.: 07672-990511, E-Mail: [email protected] kostenlos mit der KONUS-Gästekarte. Wir wünschen Ihnen erlebnisreiche 79733 Görwihl, Hotzenwald Tourist-Information, Hauptstraße 54, Touren im Landkreis Waldshut. Tel.: 07754-70810, E-Mail: [email protected] Ihr Waldshuter Tarifverbund und der Landkreis Waldshut 79837 Häusern, Tourist-Information, St. Fridolinstraße 5, Tel.: 07672-931415, E-Mail: [email protected] * wtSOLO24 (1 Pers. + 2 bzw. alle eigenen Kinder) für 6,70 E/bis 2 Zonen, 8,70 E alle 6 Zonen wtMULTI24 (bis 5 Personen) für 14,10 E/bis 2 Zonen, 21,50 E/alle 6 Zonen 79737 Herrischried, Hotzenwald Tourist-Info, Hauptstraße 28, wtFAMILY24 (2 Erwachsene + 2 Kinder bzw. alle eigenen Kinder 15. Geb.) für 8,90 E/bis 2 Zonen, Tel.: 07764-920040, E-Mail: [email protected] 13,40 E/alle 6 Zonen. 79862 Höchenschwand, Kurverwaltung, Stand: 01.01.2017 Dr. -

Reisemobilstellplätze Roadtrip Durch Den Südschwarzwald
Komm mit auf unseren Übersicht Mit dem Reisemobil durch Roadtrip über die schmalen die FerienWelt Südschwarzwald und eindrucksvollen Reisemobilstellplätze Schluchtenstraßen des Bad Säckingen 79713 Willkommen im südlichsten Zipfel des Schwarzwaldes! Südschwarzwaldes. Reisemobilstellplatz am Rheinufer | Austraße 28 Bei uns gibt es sie noch – die ursprüngliche Natur. Tiefe Entdecke die Route 79872 Schluchten, wilde Bergflüsse, stille Gipfel und mystische auch online! Bernau im Schwarzwald Wälder grenzen an das weite Tal des Hochrheins mit seinen Sommerstellplatz | Innerlehen, Rathausstr. 18 32 lebendigen und historischen Orten – ganz nah an der Grenze Unsere Playlist für Deinen Winterstellplatz | Innerlehen, Rathausstr. 18 15 zur Schweiz. Roadtrip bei Spotify! Dachsberg-Wilfingen 79875 Auf unserer Tour erlebst Du Augenblicke der besonderen Landvergnügen-Stellplatz Bärenhof | Birkenstr. 6 4 ( ) Art. Wir geben Dir Tipps für eine gemütliche Einkehr, einen Herrischried 79737 fantastischen Weitblick oder einen versteckten Pfad – für Reisemobilplatz | Liftstr. 71 10 ein besonderes Dufterlebnis oder eine sportliche Heraus- Campingplatz Lochmatt | Niedergebisbacherstr. 2 2 forderung. Lass‘ Dich überraschen und entdecke unsere Heimat – die FerienWelt Südschwarzwald. Hohentengen 79801 Stellplatz Lienheim | Rümikoner Str. 18 4 Wir freuen uns auf Dich! Stellplatz Hohentengen | Badstr. 21 4 Höchenschwand 79862 Wohnmobilstellplatz | Am Natursportzentrum 10 20 Laufenburg 79725 Wohnmobilstellplatz | Andelsbachstraße 6 Murg 79730 Reisemobilplatz | Am Freibad 15 Rickenbach 79736 Camping Rüttehof | Rüttehof 5 Kontaktstelle FerienWelt Südschwarzwald e.V. 79761 Tourismus und Kulturamt Bad Säckingen Waldshut-Tiengen Waldshuter Straße 20, 79713 Bad Säckingen Wohnmobilpark Rhein-Camping | Jahnweg 22 44 Telefon 07761 56830 Schlüchttal Naturcamping | Neubergweg 39 8 [email protected] Wehr 79664 www.ferienwelt-suedschwarzwald.de Wohnmobilstellplatz im Park | Ludingarten 7 Weilheim-Nöggenschwiel 79809 Parkplatz bei der Gret-Stube | Fohrenbachstr. -

Der Hotzenwald Im Hotzenland
Der Hotzenwald im Hotzenland Aufsatz über die Entstehung der Bezeichnun- gen Hotzen (für die Bewohner des südöstli- chen Schwarzwaldes), Hotzenland und Hot- zenwald sowie über die Ausdehnung der Re- gion. Verfasser: Gerhard Boll Waldshut-Tiengen/Gurtweil, 2012 3. Auflage 2017 Titelbild: Blick von der Burg Wieladingen in das Tal der Murg Der Hotzenwald im Hotzenland 2 Gerhard Boll, Gurtweil Inhalt DER HOTZENWALD IM HOTZENLAND 1 Hotzen 1 Der rotwelsche „Houtz“ 2 Die Familiennamen „Hotzen“ , „Hotz“ und „Hotze“ 3 Die „Hotzen“ von Dorsten 4 Die Hosen der Hauensteiner 5 Der Hotzen – ein rauhes Tuch 6 Kleider machen „Hotzen“ 8 Hotzenland 9 Hotzenwald 12 Ausdehnung des Hotzenwaldes 13 Vorwort zur aktuellen Auflage. Die Recherchen zu den Begriffen „Hotzen“, „Hotzenland“ und „Hotzen- wald“ sind nie abgeschlossen, da in den Archiven noch unbekannte Men- gen an diesbezüglich ungesichteten Akten und Büchern schlummern. Wenn neue und für diesen Aufsatz relevante Unterlagen auftauchen, wer- den diese von Zeit zu Zeit in eine neue Auflage eingearbeitet. Auslöser für die zweite Auflage war ein Zeitungsartikel im Albbote Nr. 97 vom April 2016 zur Erstnennung des Begriffs „Hotzenwald“ in der Revolu- tionsschrift des Hans Guckinofa. Dieser Druck aus der Zeit der 1848-er Revolution wurde im betreffenden Abschnitt mit berücksichtigt. Es wurden auch andere Fundstellen zum Thema zusätzlich mit eingebaut oder bereits bekannte Quellen neu beleuchtet. Insbesondere wurde ein Abschnitt zur ständig kontrovers diskutierten Ausdehnung des Hotzenwaldes angefügt. In dieser 3. Auflage wurde der Fund einer handschriftlichen Nennung des Begriffs „Hotze“ durch den Pfarrer Kleber von Dogern aus dem Jahr 1816 eingearbeitet. Der Hotzenwald im Hotzenland 1 Gerhard Boll, Gurtweil Der Hotzenwald im Hotzenland Die Bezeichnung „Hotzen“ für die Bevölkerungsgruppe im südöstlichen Schwarzwald ist inzwischen über zweihundert Jahre alt, wenn man vom frühesten schriftlichen Nachweis des Begriffs in dieser Bedeutung ausgeht. -
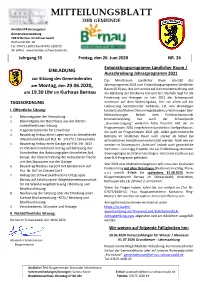
Mitteilungsblatt Der Gemeinde
MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE Amtsblatt • Herausgeber: Gemeindeverwaltung 79872 Bernau im Schwarzwald Rathausstraße 18 Tel. 07675 1600 0 Fax 07675 1600 99 INTERNET: www.bernau-schwarzwald.de Jahrgang 55 Freitag, den 26. Juni 2020 NR. 26 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum / EINLADUNG Ausschreibung Jahresprogramm 2021 zur Sitzung des Gemeinderates Das Ministerium Ländlicher Raum schreibt das am Montag, den 29.06.2020, Jahresprogramm 2021 zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) aus, das sich erneut auf die Innenentwicklung und um 19.30 Uhr im Kurhaus Bernau die Belebung der Ortskerne konzentriert. Deshalb liegt für die Förderung von Anträgen im Jahr 2021 der Schwerpunkt TAGESORDNUNG wiederum auf dem Wohnungsbau, hier vor allem auf der Umnutzung leerstehender Gebäude, z.B. von ehemaligen I. Öffentliche Sitzung: landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden zu Wohnungen bzw. Mietwohnungen. Neben dem Förderschwerpunkt 1. Bekanntgaben der Verwaltung Innenentwicklung hat auch der Schwerpunkt 2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten „Grundversorgung“ weiterhin hohe Priorität. Mit der im nichtöffentlichen Sitzung Programmjahr 2020 eingeführten Sonderlinie Dorfgasthäuser, 3. Frageviertelstunde für Einwohner die auch im Programmjahr 2021 gilt, sollen gastronomische 4. Bauantrag Anbau eines Lagerraums an bestehende Betriebe im ländlichen Raum noch stärker als bisher bei Maschinenhalle auf Flst. Nr. 1717/2 / Schwendele erforderlichen Investitionen unterstützt werden. Nach wie vor 5. Bauantrag Anbau einer Garage auf Flst. Nr. 3415 werden im Schwerpunkt „Arbeiten“ jedoch auch gewerbliche im Ortsteil Innerlehen/ Antrag auf Befreiung der Vorhaben - vorrangig Projekte, die zur Entflechtung störender Vorschriften des Bebauungsplans Innerlehen Süd Gemengelagen im Ortskern beitragen- mit einem Zuschuss aus bezügl. der Überschreitung der bebaubaren Fläche dem ELR-Programm gefördert. und des Stauraums vor der Garage Wer 2021 eine Maßnahme beginnen will, muss den konkreten 6. -

Die Alten Pfarreien Des Hotzenwaldes
Die alten Pfarreien des Hotzenwaldes Autor(en): Jehle, Fridolin Objekttyp: Article Zeitschrift: Vom Jura zum Schwarzwald : Blätter für Heimatkunde und Heimatschutz Band (Jahr): 41 (1966-1967) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-747383 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Die alten Pfarreien des Hotzenwaldes von Fridolin Jehle Die Kirchengeschichte des Hotzenwaldes lässt sich hinsichtlich der Pfarreiorganisation in zwei grosse Zeitabschnitte einteilen. Die erste dieser Perioden beginnt mit der Gründung der einzelnen Pfarreien und Festlegung ihres räumlichen Umfanges, die gleichzeitig mit der Erschliessung des Waldes während der einzelnen Siedlungsepochen erfolgt. -

Freie Bauern Auf Dem Wald — Vom Kampf Der Salpeterer Im 18
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br. Jahr/Year: 2002 Band/Volume: NF_18_1 Autor(en)/Author(s): Hug Wolfgang Artikel/Article: Freie Bauern auf dem Wald - vom Kampf der Salpeterer im 18. Jahrhundert 171-184 ©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at Freie Bauern auf dem Wald — vom Kampf der Salpeterer im 18. Jahrhundert von WOLFGANG HUG, Freiburg i. Br. Zusammenfassung: Der Beitrag beschreibt die politische Situation der bäuerlichen Bevölkerung des im 18. Jahrhundert zu Vorderösterreich gehörenden Hotzenwalds. Er schildert die Privilegien der einstigen „Freibauern" in Form ihrer Selbstverwal- tungsorganisation, den sogenannten „Einungen", und ihres Repräsentanten, des „Redmanns". Die Sonderrechte der Hotzenwälder Bauern und ihre Bedrohung von außen waren mehrmals Anlass für heftigste Auseinandersetzungen mit der zuständigen Landesregierung in Wien und mit der Abtei St. Blasien — überliefert als die „Salpe- terer-Aufstände". 1 Einleitung Am 9. Oktober des Jahres 1755 erhielt der Waldvogt der Grafschaft Hauenstein ein Schreiben der Landesregierung. Als deren höchster Vertreter im Südschwarzwald amtierte er in Waldshut. Sein Amtsbezirk bestand aus dem Hotzenwald (wie die Region seit dem 19. Jahrhundert genannt wird), den Talvogteien Todtnau und Schönau und den vier Waldstädten am Hochrhein. Das Schreiben enthielt einen Haftbefehl für alle diejenigen Familien, die sich als Erzrebellen den Aufrufen der Regierung widersetzt hatten, Ruhe und Ordnung zu wahren (bzw das, was die Regierung dafür hielt). Betroffen waren 27 namentlich aufgeführte Familien in ins- gesamt 13 Dörfern auf dem Wald (Birndorf, Buch, Dogern, Eschbach, Engel- schwand, Görwihl, Hogschür, Hierbach, Kiesenbach, Oberalpfen, Unteralpfen, Rütte und Waldkirch). -

Black Forest and Sea (M-ID: 2637) from €1,340.00 Dates and Duration (Days) on Request 10 Days
+49 (0)40 468 992 48 Mo-Fr. 10:00h to 19.00h Black Forest and Sea (M-ID: 2637) https://www.motourismo.com/en/listings/2637-black-forest-and-sea from €1,340.00 Dates and duration (days) On request 10 days A tour that is not exactly obvious at first sight. On the one hand we will experience the Black Forest and the sea intensively and get to know Lake Constance, also affectionately called the Swabian Sea. In addition, the sources of the Danube and their infiltration Nagoldstausee we come to Freudenstadt and Bad and also the mighty Rhine Falls will be among our goals. Of Rippoldsau to head for the quarter again via the course, we will also explore the winding roads that are just Schwarzwaldhochstraße. ( about 260km) waiting to be discovered, and we will travel along wine roads and winding forest roads to clear heights with Day 4: Through the witches hole to the Hex vom Dasenstein wonderful views and distant views. So we will of course Today we cross the northern and southern Black Forest. make a stop every now and then to let our eyes feast or to Via Löcherberg, Strittberg and Gscheid we reach Waldkirch, let the photographer's heart beat faster. from where we take a highlight, the Kandel from the north side. With a dream route it goes straight on, over St. Peter At the end of the tour, it is probably only the strained sitting and St. Märgen, with always wonderful views, into the flesh that prevents withdrawal symptoms. Hexenloch, to Dreistegen. -
Download (PDF)
ERLEBNISSE Mehr als 100 TOP-TIPPs ERLEBNISFÜHRER zu unseren ErlebnisWelten – von Aktivitäten, Kulturerlebnis Wir sind die FerienWelt Bürgermeisteramt Albbruck www.ferienwelt-suedschwarzwald.de Schulstraße 6 79774 Albbruck Tel. 07753 - 930-104 Tourismus- und Kulturamt Tourismus- und Kulturabteilung Bad Säckingen Laufenburg (Baden) Waldshuter Straße 20 Hauptstraße 26 79713 Bad Säckingen 79725 Laufenburg Tel. 07761 - 5683-0 Tel. 07763 - 806-140 oder -141 Tourist-Information Gemeindeverwaltung Bernau im Schwarzwald Murg Innerlehen, Rathausstr. 18 Hauptstraße 52 79872 Bernau im Schwarzwald 79730 Murg Tel. 07675 - 160030 Tel. 07763 - 930-16 Tourist-Information Hotzenwald Tourist-Info Dachsberg und Ibach Rickenbach Rathausstraße 1 Hauptstraße 7 79875 Dachsberg 79736 Rickenbach Tel. 07672 - 990511 Tel. 07765 - 9200-17 Hotzenwald Tourist-Info Tourist-Information Görwihl Waldshut-Tiengen Hauptstraße 54 Wallstraße 26 79733 Görwihl 79761 Waldshut-Tiengen Tel. 07754 - 708-10 Tel. 07751 - 833-200 Hotzenwald Tourist-Info Tourist-Information Herrischried Wehr Hauptstraße 28 Hauptstraße 14 79737 Herrischried 79664 Wehr Tel. 07764 - 9200-40 oder -41 Tel. 07762 - 808-602 Tourist-Information Tourist-Information Höchenschwand Roseneck Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 3 Josef-Raff-Platz 79862 Höchenschwand 79809 Weilheim-Nöggenschwiel Tel. 07672 - 4818-0 Tel. 07755 - 1553 Dieses Projekt wurde gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union (ELER). Europäischer Landwirtschaftsfonds -

The Erdmannshöhle Near Hasel, SW Germany: Karst Environment and Cave Evolution Arnfried Becker1*, Karsten Piepjohn2 and Andrea Schröder‑Ritzrau3
Becker et al. Swiss J Geosci (2020) 113:9 https://doi.org/10.1186/s00015-020-00363-5 Swiss Journal of Geosciences ORIGINAL PAPER Open Access The Erdmannshöhle near Hasel, SW Germany: karst environment and cave evolution Arnfried Becker1*, Karsten Piepjohn2 and Andrea Schröder‑Ritzrau3 Abstract The Erdmannshöhle is located at the NE margin of the Dinkelberg plateau in SW Germany. With a length of 2315 m, it is the longest cave in the deep open karst area near the village of Hasel. Three main cave levels developed in mod‑ erately SW‑dipping, thinly bedded and fractured limestones of the Upper Muschelkalk (Triassic). The youngest cave level containing the cave stream is still active. Eighteen samples for U/Th dating were taken from the oldest and the intermediate cave levels. At the oldest cave level, the ages range from 162 to 110 ka, indicating speleothem growth starting in the middle Beringen Glaciation and terminating at the end of the Eem Interglacial. At the intermediate cave level, the ages range from 100 to 12 ka, i.e. early Birrfeld Glaciation to Younger Dryas Stadial. The age dating shows that speleothem growth did not cease completely during long periods of harsh climate conditions during the Beringen and Birrfeld glaciations and that permafrost terminating speleogenesis and speleothem growth was thus probably established only temporarily over relatively short periods. A conceptual model for the Middle Pleistocene to Holocene development of the Erdmannshöhle is presented within the framework of modern Quaternary lithostratig‑ raphy. This model facilitates a frst correlation of the cave evolution with the Middle to Late Pleistocene depositional record in the Möhlinerfeld, which is a key area for modern Quaternary lithostratigraphy in Switzerland and Southern Germany. -

Amphibien Und Reptilien Im Hotzenwald Von KLEMENS FRITZ & MATHIAS KÜSTER
©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at Amphibien und Reptilien im Hotzenwald von KLEMENS FRITZ & MATHIAS KÜSTER Zusammenfassung: Der Beitrag schildert die gegenwärtige Bestandssituation der im Hotzenwald vorkommenden 9 Amphibien- und 8 Reptilienarten und bewertet historische Funddaten heute im Gebiet nicht mehr nachgewiesener Arten. Ferner wird auf die Lebensweise der einzelnen Arten, ihre Gefährdung und auf mögliche Schutzmaßnahmen eingegangen. 1 Einleitung Wie nur wenige andere Schwarzwaldgebiete ist der Hotzenwald noch reichlich mit natürlichen oder naturnahen Lebensräumen ausgestattet: Moore, Flügelginsterwei- den, Magerrasen, Feuchtwiesen, Wassergräben, ungestörte Bachläufe, ICleingewäs- ser, strukturreiche Wälder, Steinriegel, Felsen und Blockhalden ergeben ein abwechslungsreiches Landschaftsbild (Abb. 1 u. 2; Tafel 5/1 u. 2). Durch eine star- ke Intensivierung der Grünlandnutzung in den letzten Jahrzehnten und durch großflächige Aufforstungen, insbesondere in den 60er Jahren, ist aber das früher recht dichte Netz an naturnahen Kleingewässern auch im Hotzenwald inzwischen recht dünn geworden. Leider muss man feststellen, dass auch heute noch wertvolle Amphibien-Laichgewässer mit Erdaushub und Bauschutt verfüllt werden oder man Abb. 1: Der Hierholzer Weiher, Laichgewässer für Erdkröte, Grasfrosch, Berg- und Fadenmolch. Im Vordergrund: Feuchtwiese und Schilfgürtel, von Amphibien bevorzugte Lebensräume. Im Hin- tergrund erkennt man, wie nahe die Wohnbebauung bereits an den Weiher heran reicht. Die einstigen Vorkommen von Geburtshelferkröte und Wasserfrosch sind hier in den 1980er Jahren erloschen. (Foto: K Fritz, 1.10.1989) ©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at 108 K. FRITZ & M. KÜSTER Abb. 2: Feldgehölz mit Steinriegel und Brachestreifen. Hier kann man Waldeidechse und Blindschleiche, gelegentlich auch Zauneidechse und Schling- natter beobachten.