Performative Lyrik Und Lyrische Performance
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die „Fantas“: Väter Des Deutschen Hip-Hops
Deutsch Aktuell Top-Thema – Manuskript Die „Fantas“: Väter des deutschen Hip-Hops Rap auf Deutsch? Vor 30 Jahren gab es das kaum. „Die Fantastischen Vier“ machten es trotzdem – auf ihre ganz eigene Art. Das gefiel nicht jedem. Doch heute sind sie die bekannteste Hip-Hop-Band Deutschlands. Sie haben deutschen Rap populär gemacht: Andreas Rieke, Michael Bernd Schmidt, Thomas Dürr und Michael Beck, besser bekannt als And.Ypsilon, Smudo, Thomas D. und Michi Beck. Zusammen sind sie „Die Fantastischen Vier“ oder – wie ihre Fans sie nennen – die „Fantas“. Für die „Weiterentwicklung und Pflege des Deutschen als Kultursprache“ haben sie sogar den Jacob-Grimm-Preis bekommen. Seit 30 Jahren machen „Die Fantastischen Vier“ gemeinsam Musik. Angefangen hat alles mit einem Konzert am 7. Juli 1989. Damals spielten sie noch vor 50 Leuten in einem Kindergarten. Heute sind ihre Konzerte regelmäßig ausverkauft. Ihren ersten großen Erfolg hatte die Band aus Stuttgart mit der Hitsingle „Die da?!“ und dem Album „4 gewinnt“. Von Anfang an entwickelten „Die Fantastischen Vier“ ihren eigenen Stil, der nicht immer zum „typischen“ Hip-Hop passte. Manche ihrer Songs waren lustig, die Musiker trugen bunte Kleidung und hüpften über die Bühne. Das sorgte bei anderen Hip- Hoppern für Kritik. Sie fanden die Musik der „Fantas“ zu kommerziell und nicht sozialkritisch genug. Über die Bühne hüpfen sie immer noch, aber die bunte Kleidung ist inzwischen Vergangenheit. Auch Musik und Texte haben sich mit jedem Album verändert. 18 Alben haben „Die Fantastischen Vier“ inzwischen herausgebracht. Außerdem haben sie zahlreiche Musikpreise gewonnen. Heute zweifelt niemand mehr daran, dass die „Fantas“ zu den großen deutschen Bands gehören. -

Und Weiblichkeitskonstruktionen Deutschsprachiger Rapper/-Innen
Universitätsverlag Potsdam Martin Reger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen deutschsprachiger Rapper/-innen Eine Untersuchung des Gangsta-Raps Soziologische Theorie und Organization Studies | 2 Martin Reger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen deutschsprachiger Rapper/-innen Soziologische Theorie und Organization Studies | 2 Martin Reger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen deutschsprachiger Rapper/-innen Eine Untersuchung des Gangsta-Raps Universitätsverlag Potsdam Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Universitätsverlag Potsdam 2015 http://verlag.ub.uni-potsdam.de/ Universitätsverlag Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam Tel. +49 (0)331 977 2533, Fax -2292 E-Mail: [email protected] Die Schriftenreihe Soziologische Theorie und Organization Studies wird herausgegeben von Maja Apelt und Jürgen Mackert. ISSN (print) 2363-8168 ISSN (online) 2363-8176 Zugl.: Potsdam, Univ., Masterarbeit, 2014 Satz: Elisabeth Döring, wissen.satz Druck: docupoint GmbH Magdeburg Umschlagabbildung: https://pixabay.com/de/hip-hop-rap-mikrofon-musik-passion- 264396/ (CC0 Public Domain) Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Lizenzvertrag lizenziert: Namensnennung 4.0 International Um die Bedingungen der Lizenz einzusehen, folgen Sie bitte dem Hyperlink: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ISBN 978-3-86956-342-8 Parallel online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam URN urn:nbn:de:kobv:517-opus4-81630 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-81630 Vorwort Das vorliegende Buch druckt die Masterarbeit in Soziologie ab, die ich am Lehrstuhl für Geschlechtersoziologie an der Univer- sität Potsdam geschrieben habe. Da die Arbeit im Sommersemester 2014 verfasst wurde, konnte nur Datenmaterial untersucht werden, das bis zu diesem Zeitpunkt verfügbar war. -

MDR HARZ OPEN AIR Am 3. September 2016 Mit NIEDECKENS BAP, STEFANIE HEINZMANN, JAMIE-LEE Und 108 FAHRENHEIT
Pressemitteilung der Stadt Wernigerode und der Wernigerode Tourismus GmbH Wernigerode, 24.05.2016 MDR HARZ OPEN AIR am 3. September 2016 mit NIEDECKENS BAP, STEFANIE HEINZMANN, JAMIE-LEE und 108 FAHRENHEIT Die Besetzung für das fünft MDR HARZ OPEN AIR am 3. September 2016 im Bürgerpark Wernigerode steht. Neben NIEDECKENS BAP und STEFANIE HEINZMANN treten JAMIE-LEE und die Gruppe 108 FAHRENHEIT bei dem größten Konzertereignis in Wernigerode in diesem Jahr auf. Nach den erfolgreichen Open Air Veranstaltungen der letzten Jahre mit Lena, Silly, Karat, Christina Stürmer, Jan Josef Liefers sowie Dirk Michaelis und Revolverheld im vergangenen Jahr, ist für dieses Jahr erneut eine hochkarätige Besetzung gelungen. Zum fünften Mal wird am 3. September 2016 von der Stadt Wernigerode, der Wernigerode Tourismus GmbH und der Park und Garten GmbH (Bürgerpark) gemeinsam mit MDR SACHSEN-ANHALT zum MDR HARZ OPEN AIR eingeladen. Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher nutzten in den Vorjahren das Ambiente des Bürgerparks und die musikalischen Top-Stars für einen entspannten Abend bei toller Live-Musik. Zum diesjährigen Jubiläum des 5. MDR HARZ OPEN AIR kommt mit BAP, auch unter dem Namen NIEDECKENS BAP bekannt, ein besonderer Jubilar und eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands nach Wernigerode. Bandleader Wolfgang Niedecken feiert in diesem Jahr seinen 65. und die Band selbst ihren 40. Geburtstag. In diesen 40 Jahren gab es für die Kölschrockband Erfolge über Erfolge. Von den 23 BAP-Alben erreichten 19 die Top 10, elf wurden Nummer 1 der Charts. Die Band hat in ihrer Karriere mehr als 5,9 Millionen Tonträger verkauft und ist damit eine der Gruppen mit den meistverkauften Tonträgern in Deutschland. -

Stuttgart Kultur
REGION 2019 STUTTGART KULTUR Platz da! Warum Kunst nicht nur Raum, sondern Raum auch Kunst braucht Fanta-4-Urgestein Fantastisches Ländle Smudo im Interview 18 TEXT Gordon Detels ICH SAG'S DIR GANZ KONKRET Seit dem 9. Juli feiert eine Ausstellung im StadtPalais die Fantastischen Vier. Die 30 Jahre vorher, am 7. Juli 1989, ihren ersten Bühnenauftritt hatten. Ein Gespräch mit Rapper Smudo über die kulturelle Petrischale Stuttgart und das Musikgeschäft von heute 30 Jahre Die Fantastischen Vier. Wenn Sie das hören, freu- lich nur bedingt. Aber ich liebe auch die subversive Energie, en Sie sich oder zucken Sie zusammen ob der großen Zahl? die sich heute wie damals in der Musik fi ndet, und gerade dem Gerade noch 25 Jahre, davor 20 Jahre: Manchmal kommt es Bruch mit Gewohntem kann ich immer viel abgewinnen. Das mir vor, als hangeln wir uns von Jubiläum zu Jubiläum. Mich dann und wann auftretende Alt-Gefühl hat weniger mit dem selbst schockt die Zahl nicht, aber mir fällt auf, dass Umste- Hören der Musik als mit den Ritualen der Hip-Hop-Kultur hende immer staunend die Braue heben, wenn ich erwähne, zu tun. Im Alltag heißt das für mich: Bordeaux vor Blunt. dass wir dieses Jahr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Ist das Musikgeschäft heute anders als damals? Fühlt sich das „Auf der Bühne stehen“ noch gut an Heute ist man als Künstler mit seiner Vermarktung sehr viel oder kommen Sie sich manchmal alt vor? Hip-Hop gilt näher und direkter an seinen Fans. Das ist gut. Weniger immerhin als Jugendkultur. schön ist, dass die Umsätze deutlich geringer sind und es für Es gibt natürlich meine Betrachtung über aktuellen jungen Marketingpartner wie Plattenfirmen und Verlage immer Hip-Hop und dessen Perspektiven von blinder Partywut und schwieriger wird, den langfristigen Talentauf au zu fi nan- solventem Über-die-Stränge-Schlagen. -

Tiefrote Zahlen in Hohsaas Ler
AZ 3900 Brig | Samstag, 7. November 2015 Nr. 258 | 175. Jahr gang | Fr. 2.50 Wissen, was im Wallis läuft! www.1815.ch Re dak ti on Te le fon 027 922 99 88 | Abon nen ten dienst Te le fon 027 948 30 50 | Mediaverkauf Te le fon 027 948 30 40 Auf la ge 2 2 213 Expl. INHALT Wallis Wallis Sport Wallis 2 – 16 Traueranzeigen 14 Ausgezeichnet Erfolg Und jetzt? Ausland 17/21 Wirtschaft/Börse 18 Der Zermatter Kurdirektor David Constantin und seine Christian Constantin und der Schweiz 19 Daniel Luggen konnte diese Jungs von Lineli Solutions FC Sitten sind wohl in den Sport 25 – 27 TV-Programme 28/29 Woche gleich zwei Preise in gewannen den renommier - UEFA-Sechzehntelfinals. Und Wohin man geht 30/31 Empfang nehmen. | Seite 9 ten Edi.-Preis. | Seite 13 Super League? | Seite 25 Wetter 32 Saas-Grund | Bergbahnen Hohsaas mit überraschend unerfreulichem Ergebnis KOMMENTAR Ausgezeichnet Wir Walliser sind richtige Nörg - Tiefrote Zahlen in Hohsaas ler. Das ist an und für sich nichts Schlechtes. Unbeeindruckt von Hypes und Trends bleibt der Griesgram mit beiden Beinen auf dem Boden. Die Erwartungs - haltung hält er tief, die Fallhöhe ist somit gleich null. Diese Hal - tung schützt uns vor Schnapside - en und anderen unausgegorenen Träumereien. Gleichzeitig bringt sie den Nachteil mit sich, dass es – wenn überhaupt – nur schwerfällig vorwärtsgeht. Ausgehend von diesem Klischee liegt eine aussergewöhnliche Wo - che hinter uns. Gleich zwei Walli - ser Delegationen durften auf na - tionalen Bühnen Branchenpreise entgegennehmen. Das Projekt «150 Jahre Erstbesteigung Mat - terhorn» erhielt den «Milestone», Schwieriges Umfeld. Die Bergbahnen Hohsaas AG lieferten trotz viel Schnee und Vorzeigepanorama ein enttäuschendes Ergebnis ab. -

Pressemitteilung
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH Große Elbstr. 277a ∙ 22767 Hamburg Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com PRESSEMITTEILUNG Hamburger Kultursommers 2015 auf der Trabrennbahn Bahrenfeld vom 18. bis 30. August mit acht Open Air-Veranstaltungen. Hamburg, 29. Juni 2015 – Die Veranstaltungsreihe „Hamburger Kultursommer“ auf der Trabrennbahn Bahrenfeld geht in diesem Sommer in ihre sechste Runde in Folge. Von Mitte bis Ende August stehen insgesamt sieben Konzerte und ein Poetry Slam auf dem Programm. Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel auf einem bis zu 15.000 Besucher fassenden Teilareal der Trabrennbahn statt, auf dem dann die größte Open Air-Bühne Hamburgs stehen wird. Das Programm reicht von Punkrock über Pop bis hin zu Rap und bietet damit einem breiten Publikum großartige Konzert- erlebnisse unter freiem Himmel. Den Anfang des diesjährigen Kultur- sommers macht am 18. August die dritte Auflage des Punkrockfestivals Hamburg Crash Fest mit The Offspring , Flogging Molly , Donots , The Menzingers und The Smith Street Band . Einen Tag später, am 19. August , feiert die Hamburger Band Revolverheld mit ihren Fans auf der Trabrennbahn einen ganz besonderen Abend: das „Finale“ ihrer „Immer in Bewegung“-Tour und -Platte mit alten und neuen Hits. Fast nahtlos geht es am 21. August mit dem „Castival“ weiter: Nach seiner erfolgreichen „Hinterland“-Tour zum gleichnamigen Nummer-1-Album lässt es der angesagte Deutschrapper Casper auch Open Air krachen. Und weil für ihn zu einem guten „Castival“ auch immer andere Künstler gehören, hat er sich noch ein paar gute Freunde eingeladen: Thees Uhlmann & Band sowie Haftbefehl werden live dabei sein. 1 FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH Große Elbstr. -

Kollegah the Boss’: a Case Study of Persona, Types of Capital, and Virtuosity in German Gangsta Rap
Popular Music (2019) Volume 38/3. © Cambridge University Press 2019, pp. 457–480. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. doi:10.1017/S0261143019000473 ‘Kollegah the Boss’: A case study of persona, types of capital, and virtuosity in German gangsta rap MICHAEL AHLERS Leuphana University, Lueneburg, Germany E-mail: [email protected] Abstract The article begins with a short history of German gangsta rap, followed by an overview of central the- ories and key concepts in hip-hop studies. It then focuses on a case study of a German gangsta rapper called Kollegah, who became one of Germany’s most commercially successful artists of the past few years. The case study is divided into three parts: the first involves a deconstruction of both his artistic persona and his strategies of appropriating hip-hop cultures. This is followed by a closer look at two Kollegah productions, focusing on his rhyming and signifying skills. By adding a cursory qualitative media analysis of both Internet fan forums and print and television artefacts about Kollegah, very contradictory reactions can be depicted. The article is finally able to illustrate that this artist makes great use of a (typically German?) flavour of virtuosity and that he can draw from a very unique set of capital. Kollegah is viewed as representing a successful strategy of cultural appropriation and the use of different types of capital within the network of music business in its post-digital era. -

Kollegah K.O.L.L.E.G.A.H Download
Kollegah k.o.l.l.e.g.a.h download click here to download Download:www.doorway.ru+-+Kollegah+%%rar. Download: www.doorway.ru LIKE MEINE FB SEITE UM AUF DEM NEUESTEN STAND ZU SEIN^^. Download: www.doorway.ru Schreibt in die Kommentare welches Album ihr als nächstes wolt.:) P.s. Kollegah - Kollegah jetzt als MP3 in top Qualität herunterladen. Komplette Alben und Format: MP3-Download|Verifizierter Kauf. Ich will nicht viel Seit heute ist das langerwartete Snippet zum Album KOLLEGAH draußen. Es ist wiedermal. Kollegah Big Boss 04 Kollegah Big Boss Strassenapotheker In der Hood Kokamusik DOWNLOAD VIA www.doorway.ru Kollegah - Kollegah Songtext [Hook] K-O-Doppel-L-E-G-A-H Yeah Bitches sind am diskutieren, aber die Goldkette ist frisch poliert Kollegah, Kollegah. Дата выпуска: Битрейт: kbps. Продолжительность: 1. Kollegah - Eure Hoheit () 2. Kollegah - Kollegah () 3. See also MusicBrainz (release) [MusicBrainz (release)] ; MusicBrainz (artist) [MusicBrainz (artist)] ; Amazon [Amazon]. Identifier. FreeDownloadMp3 - Kollegah free mp3 (wav) for download! Newest Kollegah ringtones. Collection of Kollegah albums in mp3 archive. Alles zu Kollegah: Alben, News, Videos und Tourdaten im Tonspion. Hier kannst du Musik von Kollegah hören und ähnliche Musik entdecken. Kollegah - MP3 Download kostenlos. als Radio-Mitschnitt mit der TuneStar Mitgliedschaft. Alle Titel in CD Qualität! Übersicht; Alben; Titel; Biographie. Download free Kollegah Kollegah Komplettes Album Download MP3 and MP4 - mp3bik. Switch browsers or download Spotify for your desktop. Also known under the guises of T.O.N.I. and Der Boss, Kollegah's rhythmic and humorous "pimp rap". "Kollegah" by Kollegah sampled Kollegah's "Boss Der Bosse". Listen to both songs on 0 Votes. -

Die Fantastischen 4 © PPVMEDIEN 2010
INTERVIEINTERVIEW: DIE FANTASTIscHEN 4 © PPVMEDIEN 2010 Die Fantastischen 4 Alles läuft rund Sie gelten als Pioniere des deutschsprachigen HipHop. Und auch wenn es um ihre Live- H O P P E R T shows geht, sind die 1989 in Stuttgart gegründeten Fantastischen Vier nie um eine tech- I nische Innovation verlegen. Nach drei Jahren Pause gibt es endlich wieder eine Hallentour der Sprachkünstler. Mit der „Für Dich Immer Noch Fanta Sie“-Tour – benannt nach ihrem aktuellen Studioalbum – warten die Rap-Veteranen mit völlig neuen Perspektiven auf. FOTO: IMAGO, UL 26 SOUNDCHECK 01|11 WWW.SOUNDCHECK.DE © PPVMEDIEN 2010 4 n Auch im 21. Jahr ihrer Bandgeschichte haben Die Fantastischen Vier noch nichts von ihrem Feuer verloren und schaffen es wieder sich sowohl neu zu erfinden als auch unverkenn- bar 100 Prozent nach sich zu klingen. In der Qualität von „Für dich immer noch Fanta Sie“ werden Smudo, Michi Beck, And. Ypsilon und Thomas D ihr Fans noch lange verzaubern. das Album SC: Das erinnert an die 360°-Bühne von U2. Smudo: U2 haben eine so schwere Bühne bauen lassen, dass sie sie nicht in allen Stadien in die Mitte der Halle setzen konnten, sondern schon mal auf den Rand ausweichen mussten – was ja nicht der Sinn einer 360-Grad-Bühne ist. So eine Bühne wie U2 sie hat, kostet um die 20 Millionen Euro. Ohne den BlackBerry-Deal, den sie abge- schlossen haben, hätten sie das nach zweiein- halb Jahren Welttournee wohl immer noch nicht bezahlt. Das ist also selbst für eine Band wie U2 ein ziemliches Manöver. Und Die Fantastischen Vier spielen nun mal nicht weltweit. -

<Title of Work, Centered
Der Unterricht für die Unterschicht: Voices from the Margins in German Gangster Rap by Alexandra Smith, BA A Thesis In GERMAN Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS Approved Anita McChesney Chair of Committee Stefanie Borst Charles Grair Dominick Casadonte Interim Dean of the Graduate School May, 2013 Copyright 2013, Alexandra Smith Texas Tech University, Alexandra Smith, May 2013 ACKNOWLEDGMENTS This thesis would not have been possible without the guidance and assistance of several individuals who have contributed their time and support in the preparation and completion of this project. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to my thesis advisor and chair of my committee, Dr. Anita McChesney. Her unwavering support, guidance, and encouragement have been utterly invaluable to me throughout my time in the Texas Tech University German program. Moreover, her invaluable wisdom, insight, and unwavering patience have aided me on every level throughout the creation of this work in particular. Her example will continue to serve as a source of inspiration for me as I further my education and professional development. I would also like to thank my committee members, Dr. Charles Grair and Dr. Stefanie Borst, for sharing their vast knowledge with me, both in- and outside of class, and especially for contributing their invaluable feedback to this project. I would also like to thank Dr. Marlene Selker for helping me to develop my knowledge of German literature and culture via courses on both the undergraduate and graduate level, as well as in person. -

Dj Sweap & Dj Pfund
DJ SWEAP & DJ PFUND 500 DJ SWEAP & DJ PFUND 500 (GOLDEN LIGUE / ZH) “Switzeland`s most Popular DJ Team” The two young fellows DJ Sweap and DJ Pound 500 have Theyre DJ-Sets are spread very wide from new heavy rotation reached celebrity status far over the swiss borders. For over a RapMusic to R&B, Electro, Disco, Dirty South, Dancehall and 4 decade they have been successfully realesing several mixtapes sure Alltime Classics to reach the expectations of any crowed at and have been playing in the finest clubs all over Switzerland, any club. That means satisfaction is garanteed to every event Germany, UK, Russia and France. concept of an organizer. Gaining a wider audience has been a focus since the begging of Highlights of some Club-Gigs are Events together with very well theyre partnership. They reached this goal by working together known international Rapstars and DJs like A-Trak, Whoo Kid, with famous artists such as Kool Savas, Sido, Azad, Olli Banjo, Revolution, Ghostface Killa, 50 Cent, Clinton sparks, Sido, Com- Fler or Harris and as well as together with the swiss heavy weights mon, M.O.P, Masta Ace, Stress etc. Griot, Stress, Wicht and E.K.R.. Through all these releases they have managed to be recognized as the most successful DJ Team Since December 2007 the current release and another mixtape of Switzerland. of the year “Fler presents DJ Sweap and DJ Pound 500 - Wir Nehmen auch Euro” as been achieved together with the most One of the biggest highlights has been the guest apperance at successful German hip-hop label Aggro Berlin (www.aggroberlin. -
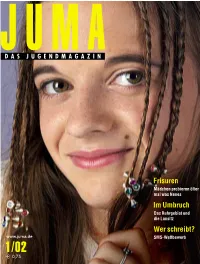
JUMA 1/2002 S 02-03 Editorial
S 01 Titel.korr 2 22.11.2001 9:29 Uhr Seite 1 JUMA DAS JUGENDMAGAZIN Frisuren Mädchen probieren öfter mal was Neues Im Umbruch Das Ruhrgebiet und die Lausitz Wer schreibt? www.juma.de SMS-Wettbewerb 1/02 e 0,75 S 02-03 Editorial. korr 2 23.11.2001 11:57 Uhr Seite 2 Inhalt Moment mal! 4–7 Mit dem Roller durchs Ruhrgebiet Neues aus dem alten „Revier“ 8–12 Mach mit: Schick uns eine SMS! 13 Zukunft mit Fragezeichen Leben in der Lausitz 14–17 Allein sein Warum Jugendliche Single sind 18–20 Simone: Wach werden! 21 Nicht für die Schule ... Schulprojekt in Berlin 22–26 E-Mail-Freundschaft durch JUMA 27 Essen, fressen, tafeln 28–29 Öfter mal was Neues Was man mit Haaren machen kann 30–33 Einfach tierisch! 34–35 Schulsport im Abseits? Wenig geliebter Unterricht 36–39 Abgefahren – nicht angekommen Unfälle junger Fahrer 40–42 Jeder Minigolfsportler kennt das Geheimnis der Bälle: Mach-mit-Auflösung 43 Sie unterscheiden sich in Größe, Oberfläche Szene 44–45 und Härte. Brieffreunde 46 Leserbriefe 47 Impressum Redaktion JUMA: Frankfurter Str. 40, 51065 Köln, Telefon: +221/96 25 13-0; Telefax: +221/96 25 13 – 4 oder – 14 JUMA im Internet: http://www.juma.de E-mail: [email protected] Redaktion: Christian Vogeler (verantwortlicher Redakteur), Dr. Jörg-Manfred Unger, Kerstin Harnisch Pädagogische Beratung: Diethelm Kaminski, Bundes- verwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Köln Layout: Helmut Hagen Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Peter Conrady, Universität Dortmund; Dietrich Becker, Auswärtiges Amt; Prof. Dr. Inge Schwerdt- feger, Universität Bochum; korrespond. Mitglied: Dr.