Also Sprach Zarathustra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nietzsche and Eternal Recurrence: Methods, Archives, History, and Genesis
University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School April 2021 Nietzsche and Eternal Recurrence: Methods, Archives, History, and Genesis William A. B. Parkhurst University of South Florida Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the Philosophy Commons Scholar Commons Citation Parkhurst, William A. B., "Nietzsche and Eternal Recurrence: Methods, Archives, History, and Genesis" (2021). Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/8839 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Nietzsche and Eternal Recurrence: Methods, Archives, History, and Genesis by William A. B. Parkhurst A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the Doctor of Philosophy in Philosophy Department of Philosophy College of Arts and Sciences University of South Florida Major Professor: Joshua Rayman, Ph.D. Lee Braver, Ph.D. Vanessa Lemm, Ph.D. Alex Levine, Ph.D. Date of Approval: February 16th, 2021 Keywords: Fredrich Nietzsche, Eternal Recurrence, History of Philosophy, Continental Philosophy Copyright © 2021, William A. B. Parkhurst Dedication I dedicate this dissertation to my mother, Carol Hyatt Parkhurst (RIP), who always believed in my education even when I did not. I am also deeply grateful for the support of my father, Peter Parkhurst, whose support in varying avenues of life was unwavering. I am also deeply grateful to April Dawn Smith. It was only with her help wandering around library basements that I first found genetic forms of diplomatic transcription. -
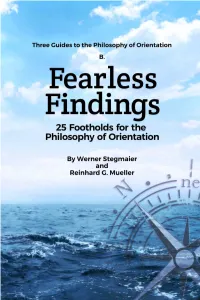
25 Footholds for the Philosophy of Orientation
Werner Stegmaier and Reinhard g. Mueller Fearless Findings first Edition October 2019 first Printing Three Guides to the Philosophy of Orientation B. Fearless Findings 25 Footholds for the Philosophy of Orientation By Werner Stegmaier and Reinhard g. Mueller Hodges Foundation for Philosophical Orientation Nashville, Tennessee ISBN 978-1-7341435-0-8 The Hodges foundation for Philosophical Orientation Copyright © 2019 - All rights reserved Published in the United States I A Realistic Philosophy for Our Current Time 1. The Aim Contrary to the usual, the philosophy of orientation does not uncover any abysses, raise any moral claims, design any utopias, pursue any politics, give any advice, or offer any self- help philosophy nor does it constrain philosophy to merely making terms more precise. It responds to the problems of the ever-increasing complexity, confusion, unsurveyability, and uncertainty of our current world: it soberly and calmly describes how we successfully orient ourselves in this world under these conditions. Like never before, it philosophically focuses on orientation itself, which is now spoken of everywhere. The philosophy of orientation is a realistic philosophy for our current time. It helps us navigate through our bewildering world. 2. Orientation as the Origin and Unity of Cognition and Action Human orientation precedes cognition and action, i.e. the issues of theoretical and practical philosophy. To be capable of recognizing and acting, one must already be oriented. In one‘s orientation, cognition and action cannot be separated. Both emerge from it. The philosophy of orientation proceeds from a new beginning and a new unity of philosophy. 3. The Temporary Unity of a Process Our orientation is a comprehensive unity, which includes a multitude of processes running in flexible structures. -

Law, Politics and Paradox Orientations in Legal Formalism
Faculty of Law University of Helsinki Law, Politics and Paradox Orientations in Legal Formalism Hanna Lukkari Doctoral dissertation To be presented for public discussion with the permission of the Faculty of Law of the University of Helsinki, in Lecture Hall P674, Porthania, on the 25th of September 2020 at 12 o’clock. Helsinki 2020 ISBN 978-951-51-6349-3 (paperback) ISBN 978-951-51-6350-9 (PDF) Unigrafia Helsinki 2020 2 In memory of Sari 3 Abstract The aim of this dissertation is to analyze the significance of the logical phenomenon of paradox for law and its relation to politics. I examine a selection of formal legal and political theories that in different ways understand law as a totality of norms, communications or behaviors, how paradox emerges in these theories, and what implications their understanding of paradox has for the relationship between law and politics. I argue that these legal and political theories can be meaningfully and in a novel way grouped according to their orientation to legal totality and paradox. To my knowledge, there is no research systematically mapping orientations to paradox in legal theory. It is the objective of this dissertation to fill this lack. Paradox presents challenges for formal thought, i.e. thought that analyzes the logic of totalities. Law, considered as a totality or form, gathers a plurality of entities under a common denominator and into a legal order. It is in reflecting on such formalization that we encounter paradoxes. This work aims to contribute to a growing literature on the implications of formalism for contemporary social and political thought by providing a legal theoretical perspective hitherto missing in these discussions. -

ADVERTIMENT. Lʼaccés Als Continguts Dʼaquesta Tesi Doctoral I La Seva Utilització Ha De Respectar Els Drets De La Persona Autora
ADVERTIMENT. Lʼaccés als continguts dʼaquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials dʼinvestigació i docència en els termes establerts a lʼart. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix lʼautorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No sʼautoritza la seva reproducció o altres formes dʼexplotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des dʼun lloc aliè al servei TDX. Tampoc sʼautoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. -

Werner Stegmaier Das Zeichen X in Der Philosophie Der Moderne
Werner Stegmaier Das Zeichen X in der Philosophie der Moderne t. Zeichen-Kunst, Dinge und Orientierung Zeichen-Kunst ist notwendig, wenn Zeichen nicht für Dinge, sondern für Zeichen und zuletzt für Unbekanntes stehen. Setzt man Dinge, Ereignisse, Handlungen vor den Zeichen voraus, muß man doch einräumen, daß sie erst durch Zeichen mitteilbar und so auch erst allgemein bekannt werden.' Wenn Dinge, Ereignisse, Handlungen aber erst durch Zeichen mitteilbar und bekannt wer- den, ist der Bezug auf sie philosophisch zweitrangig; man wird sich dann vor den Dingen mit den Zeichen befassen müssen. Vielleicht wird es dann aber auch schon ausreichen, sich mit den Zeichen zu befassen. Josef Simons Philosophie des Zeichens macht das denkbar. Das Zeichen ist, so Simon, »vor den Dingen, indem es für eine wesent- lich nicht zu Ende kommende Bestimmung der Dinge steht..2 Dinge sind danach durch Zeichen und von Zeichen her bestimmt in einem Prozeß, der nicht zu Ende kommt und auch nicht zu Ende zu kommen braucht. Zeichen werden unmittelbar verstanden. Sind sie nicht unmittelbar verständlich, werden sie durch andere Zeichen verdeutlicht, so lange, bis die Zeichen hinreichend ver- ständlich sind, bis man zu wissen glaubt, was der andere »gemeint. hat. Aber man hat dann immer noch »nur seine Zeichen..3 Damit von Dingen die Rede sein kann, müssen die Zeichen nicht nach einer allgemeinen Regel verdeutlicht werden und auch nicht in einem allgemein bestimmten Zusammenhang untereinander stehen. Es genügt, daß im Prozeß der Verdeutlichung von Zeichen, so Simon, »Subjektivitäten. im Spiel sind, »die, als solche, Wege Vgl. Aristoteles, de int. 1, 16 a 3-8. -

God and the Quest for Authenticity
GOD AND THE QUEST FOR AUTHENTICITY IN MOSES MENDELSSOHN AND IMMANUEL KANT A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by James W. Haring _______________________________________ Gerald P. McKenny, Director Graduate Program in Theology Notre Dame, Indiana December, 2020 © Copyright 2020 James W. Haring GOD AND THE QUEST FOR AUTHENTICITY IN MOSES MENDELSSOHN AND IMMANUEL KANT Abstract by James W. Haring Though personal authenticity is an organizing ideal of late-modern Western societies, it also is a site of some of our most contentious disagreements, lacks coherence in many of its formulations, is not fully understood in all of its implications, and is often unidentified in its function as a marker of social distinction. There is a need for conceptual clarification and deeper historical understanding of the ideal of authenticity. Scholarship on authenticity has argued that it was birthed by nineteenth-century Romanticism and popularized in the counter-culture movements of the 1960’s. On this understanding, authenticity is distinct from previous moral ideals, especially rationalist ones, exemplified by Immanuel Kant’s notion of autonomy. But pre-romantic moral rationalism was itself motivated by an ideal of authenticity. Authenticity is not a deviation from the ideal of rational autonomy. On the contrary, rational autonomy is one of a long series of attempts to generate philosophical and religious programs which meet the requirements of authenticity understood as a norm of validity applicable across diverse but analogous domains, such as aesthetics, metaphysics, semantics, and ethics. -

Wintersemester 2014/15
Lehrveranstaltungen des Faches Philosophie im Wintersemester 2014/15 mit Erläuterungen und Literaturhinweisen Reihe zur Einführung www.junius-verlag.de »Die Einführungsbände des Junius Verlags lassen Experten zu Wort kommen, die ein Feld so überblicken, dass sie es auf eigene Verantwortung, gründlich und mit Gründen, aufzuklären verstehen.« Die Zeit Theodor W. Adorno Sigmund Freud John Stuart Mill Bildtheorie Literaturtheorien G. Schweppenhäuser Hans-Martin Lohmann Kuenzle/Schefczyk Pichler/Ubl Oliver Simons Giorgio Agamben Hans-Georg Gadamer Friedrich Nietzsche Biophilosophie Logik Eva Geulen Udo Tietz Werner Stegmeier Kristian Köchy Wilhelm Büttemeyer Hans Albert Arnold Gehlen Charles Sanders Peirce Biopolitik Theorien der Macht Eric Hilgendorf Christian Thies Helmut Pape Thomas Lemke Andreas Anter Karl-Otto Apel Johann Wolfgang Goethe Jean Piaget Theorien des Medientheorien Walter Reese-Schäfer Peter Matussek Ingrid Scharlau Computerspiels Dieter Mersch Hannah Arendt Antonio Gramsci Platon Gamescoop Philosophie der Karl-Heinz Breier Barfuss/Jehle Barbara Zehnpfennig Theorien des Designs Menschenrechte Aristoteles Jürgen Habermas John Rawls Claudia Mareis Menke/Pollmann Christof Rapp Iser/Strecker Wolfgang Kersting Erkenntnistheorie Moralbegründungen Augustinus Nicolai Hartmann Paul Ricœur Herbert Schnädelbach Konrad Ott Johann Kreuzer Martin Morgenstern Jens Mattern Feministische Ethik Theorien des Museums Michail Bachtin Friedrich August von Hayek Richard Rorty Saskia Wendel Anke te Heesen Sylvia Sasse Hans Jörg Hennecke Walter Reese-Schäfer -

Design As Inquiry Prospects for a Material Philosophy
Design as Inquiry Prospects for a Material Philosophy Björn Franke A thesis submitted in partial ful!lment of the requirements of the Royal College of Art for the degree of Doctor of Philosophy March, 2016 Royal College of Art 2 Copyright Statement "is text presents the submission for the degree of Doctor of Philosophy at the Royal Col- lege of Art. "is copy has been supplied for the purpose of research for private study, on the understanding that it is copyright material, and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. 4 Author’s Declaration During the period of registered study in which this thesis was prepared the author has not been registered for any other academic award or quali!cation. "e material included in this thesis has not been submitted wholly or in part for any aca- demic award or quali!cation other than that for which it is now submitted. Björn Franke, March 31, 2016 6 Abstract For many, design is the production of useful artefacts. Designing can however also provide a basis for exploration, speculation or critique. "is thesis develops this conception further by providing a theoretical framework for conceiving designing and design objects as a mode of and media for philosophical inquiry. Design is regarded as a material philosophy that explores and re#ects philosophical issues by situating them in the concrete and particular reality of human life rather than in a generalised and abstract realm. Design objects are equipment and media that can be understood in terms of their contextual references and consequences as well as the way in which they mediate human action, thinking and existence, and thus in terms of the worlds that they open up. -

Philosophy Philosophie 2020 NE 00232
PHILOSOPHY PHILOSOPHIE 2020 NE 00232 OURPUBLISHER PARTNERS degruyter.com Die Titelsind auch bei Ihrem Buchhändler erhältlich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean/ NEW JOURNAL Thetitles arealso availablefromyour regular supplier.For inquiries please contact: HGVHanseatische Gesellschaft Books: Americas Journals: Americas für VerlagsservicembH WalterdeGruyter,Inc. c/o TriLiteral, LLC/ WalterdeGruyter,Inc. c/o Turpin JOURNAL OF Holzwiesenstr.2 LSC Communications Subscription Office –Americas 72127Kusterdingen 100 Maple Ridge Drive,Cumberland, RI 02864, USA P. O. Box 361, Birmingham,Alabama35201- 0361,USA T+1(401)531.2800, F+1(401)531.2801 T+1(205)995.1567, F+1(205)995.1588 TRANSCENDENTAL PHILOSOPHY Orders and customerinquiries Toll Free: +1(800)405.1619 Toll free:+1(800)633.4931 (books): +49(0) 70 71 93 53-55 Orders: [email protected] [email protected] Orders and customerinquiries Customer Inquiries: [email protected] Edited by Sebastian Luft, Konstanstin Pollok, Andrea Staiti (journals): +49(0) 70 71 93 53-65 Customer Service(Americas): T+1(857)284.7073×121,F+1(857)284.7358 SUBSCRIPTION RATES FOR 2020 IHRE ANSPRECHPARTNER /PLEASECONTACT: DEUTSCHLAND,ÖSTERREICH, EUROPE, MIDDLE EAST, David Birkinshaw Senior Sales Manager, Max Meng (Ms) Sales Manager Print SCHWEIZ AFRICA Western US T+86 10 855 63694 [ ] M+1(617) 688-6081 M+86 186 107 50804 € 199.00 D / US$ 229.00 / £ 163.00 [email protected] [email protected] Online Martina Näkel Sales Director Anne O’Riordan Senior Sales Manager, T+49 (0)30