Die Eisenbahn in Windischeschenbach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gemeinde Reuth Bei Erbendorf Stadt
Bayerisches Breitbandzentrum Name der Kommune (Gemeinde/Stadt) Reuth b.Erbendorf Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) 09377149 Ansprechpartner Kommune (Breitbandpate) Bernhard Frummet Landkreis Tirschenreuth Regierungsbezirk Oberpfalz Fördersteckbrief Name Erschließungsgebiet: Reuth b. Erbendorf Ausbauender Netzbetreiber: Deutsche Telekom Folgende Felder sind nur bei Einteilung des Erschließungsgebiets in mehrere Lose auszufüllen: Name Los 1: Ausbauender Netzbetreiber 1: Name Los 2: Ausbauender Netzbetreiber 2: Name Los 3: Ausbauender Netzbetreiber 3: Name Los 4: Ausbauender Netzbetreiber 4: Name Los 5: Ausbauender Netzbetreiber 5: Datum 03.02.2015 Dokumentation der Infrastruktur gemäß Ziffer 9 der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR) Kumulierte Informationen zu dem oben genannten Erschließungsgebiet / zu den oben genannten Losen 1. Allgemeine Informationen zu dem Erschließungsgebiet / zu den Losen Gemeindeübergreifendes Projekt nein falls ja: beteiligte Kommune(n) Name AGS Allgemeine Projektbeschreibung Die Ortsteile sind an die Netzknoten Erbendorf, (Stichpunktartige Beschreibung der wesentlichen technischen Windischeschenbach und Friedenfels angeschlossen und wird Ausbaumaßnahmen in den EG/Losen) über KVZ (A1, A17, A18, A12, A24, A25, A6 und A7) versorgt. Zum KVZ A501 (Mitversorgung A1), A17, A518 (Mitversorgung A18), A24 (Mitversorgung A12), A25, A6 und A7 wird Glasfaserkabel verlegt. Errichtung, Montage- und Schaltarbeiten von 7 Multifunktionsgehäusen. Geplante Anzahl versorgbarer -

Mediadaten Preisliste Nr
92603 Weiden (Nielsen IV Bayern) 2020 MEdiadatEN Preisliste Nr. 55 | Gültig ab 1. Januar 2020 Preisliste Nr. 55 · Seite U2 LESERANALYSE REICHWEITEN 92603 Weiden i. d. OPf. (Nielsen IV Bayern) 257.000 72 % Leser Reich- weite 117.000 86.000 Leser Leser mit höherer in der Altersgruppe Schulbildung In der Oberpfalz zuhause. 30 bis 59 Jahre Ihr Partner für regionale Werbung. Mit unseren Medien und Dienstleistungen decken wir die gesamte Bandbreite der Informationskanäle mit traditioneller Zuverlässigkeit und zukunftsweisender Technologie ab – jeden 165.000 Morgen auf dem Frühstückstisch und unterwegs auf mobilen Leser Geräten. Täglich greifen 257.000 Leser1 zu einer unserer mit > 2000 € 1 Haushaltsnetto- Ausgaben. Mit einer Reichweite von 72 % sind wir in der 13.478.408 einkommen nördlichen Oberpfalz die Nummer 1 unter den Tageszeitungen. PI2 1Weitester Leserkreis, MA 2019 auf Onetz.de 2IVW 07/2019 Preisliste Nr. 55 · Seite U2-A ErscheinUNGSGEBiet TAGesZeitUNG 92603 Weiden i. d. OPf. (Nielsen IV Bayern) 9 93 Konnersreuth Marktredwitz Fichtelberg Waldsassen Nagel Pechbrunn Ebnath Waldershof Leonberg Fuchsmühl Neusorg Mitterteich Immenreuth Marienbad Kulmain Wiesau Tirschenreuth Mähring Speichersdorf Kemnath 2 4 Erbendorf Plößberg Bärnau Tachau Speinshart Windischeschenbach Pegnitz Kirchenthumbach Pressath Püchersreuth Neustadt a. d. Waldnaab Flossenbürg ČZ Eschenbach i. d. OPf. Parkstein Floß Altenstadt a. d. Waldnaab Auerbach Grafenwöhr Pilsen 1 Waldthurn i. d. OPf. 6 Mantel Pleystein Waidhaus Neuhaus Weiherhammer Weiden a. d. Pegnitz Königstein Freihung Etzenricht Edelsfeld Vohenstrauß Vilseck Moosbach 3 Hirschau Luhe-Wildenau Schnaittenbach Eslarn Neukirchen Tännesberg 3 Schönsee Sulzbach-Rosenberg Wernberg-Köblitz Hersbruck 7 Pfreimd Oberviechtach 72 Amberg Birgland Illschwang Nabburg Winklarn Ammerthal Schmidgaden 65 Kümmersbruck Thanstein Fensterbach Schwarzhofen 6 Lauterhofen Ursensollen Schwarzenfeld Kastl Rötz Ensdorf Neunburg Hohenburg Schwandorf Wackersdorf vorm Wald 9 Neumarkt Rieden Bodenwöhr Schmidmühlen Bruck i. -

Vorbericht Zum Haushaltsplan 2020
Stadt Kemnath Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 gem. § 3 KommHV - Kameralistik Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung – Statistik 4 1.1. Einleitung 4 1.2. Einwohnerstand 6 1.3. Fläche 8 2. Eckdaten Gesamthaushalt 2020 10 3. Grundlagen des Haushalts 2020 11 3.1. Hebesätze 11 3.2. Steuerkraft 15 3.3. Umlagekraft 15 4. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Verwaltungshaushalt 19 4.1. Grundsteuer A + B 19 4.2. Gewerbesteuer 20 4.3. Einkommenssteuerbeteiligung 21 4.4. Umsatzsteueranteil 22 4.5. Schlüsselzuweisung 23 4.6. Konzessionsabgabe 24 5. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Verwaltungshaushalt 25 5.1. Personalausgaben 25 5.2. Gewerbesteuerumlage 26 5.3. Kreisumlage 27 5.4. VG-Umlage 28 5.5. Schulverbandsumlagen 29 5.6. Zinsausgaben 30 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Seite 3 6. Kostenrechnende Einrichtungen 31 6.1. Kindertagesstätte Li-La-Löhle 31 6.2. Abwasserbeseitigung 33 6.3. Abfallbeseitigung 34 6.4. Bestattungswesen 34 6.5. Wasserversorgung 35 7. Ansatzerläuterungen Verwaltungshaushalt Einzelpläne 0 – 8 36 8. Zuführung zum Vermögenshaushalt 38 9. Investitionen im Vermögenshaushalt 2020 39 10. Entwicklung der Rücklagen 49 11. Entwicklung des Schuldenstandes 50 12. Kassenlage und Kassenkredit 52 13. Finanzplanung 53 13.1. Investitionsprogramm 2021 - 2023 53 13.2. Finanzplan 56 14. Zusammenfassung 57 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Seite 4 1. Einleitung - Statistik 1.1. Einleitung Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020 betritt die Stadt Kemnath finanztechnisches Neuland in bisher nicht vorstellbarer Höhe. Wenn beim letztjährigen Haushalt 2019 mit ei- nem Gesamtvolumen von rd. 39,2 Mio. € von einem Rekord gesprochen wurde, stellt der Entwurf des Haushalts 2020 mit einem Gesamtvolumen von 191.393.000 € alles bisher Da- gewesene in den Schatten. -

Antwort Der Bundesregierung
Deutscher Bundestag Drucksache 13/5379 13. Wahlperiode 01.08. 96 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Helmut Wilhelm (Amberg), Gila Altmann (Aurich), Egbert Nitsch (Rendsburg), Albert Schmidt (Hitzhofen) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN — Drucksache 13/5277 — Grenzübergang Waldsassen—Eger (Cheb) im Zuge der Bundesstraße B 299 Die Bundesstraße B 299 soll zwischen Mittenteich und dem Grenzüber- gang Waldsassen zur Tschechischen Republik ausgebaut werden. Hier- bei ist unter anderem eine Teilortsumgehung der Stadt Waldsassen auf der Trasse der ehemaligen Eisenbahnlinie Wiesau—Waldsassen- Schloppenhof/Slopany—Eger (Cheb) vorgesehen. 1. Wie hat sich auf dieser Straße das Verkehrsaufkommen zwischen 1988 und 1996 entwickelt? 2. Welcher Anteil entfällt hiervon auf den Pkw-Verkehr, welcher auf den Lkw-Verkehr? Die Stadt Waldsassen liegt rd. 5 km vor der Grenze zur Tschechi- chen Republik an der B 299; der Grenzübergang im Zuge der Bundesstraße war nach Kriegsende geschlossen worden. Die zu- führende Bundesstraße hatte daher nur lokale Verkehrsbedeu- tung. Erst im Rahmen der geänderten politischen Lage und der etappenweisen Öffnung des Grenzüberganges seit 1990 hat die Verkehrsbelastung (Kfz/24 h) wie folgt zugenommen: Jahr Personenverkehr' ) Güterverkehr' ) 1985 1334 87 1990 1511 159 1993 7 703 99 1995 6110 219 *) Zählstelle bei Str. - km 142,8. Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr vom 30. Juli 1996 übermittelt. Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. Drucksache 13/5379 Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 3. Welche Ausbauprojekte sind im genannten Straßenabschnitt in den letzten acht Jahren bereits verwirklicht worden und mit welchem Kostenaufwand? Der Ausbau der Bundesstraße 299 Mitterteich—Waldsassen er- folgte in fünf Bauabschnitten (BA II und III bereits vor 1988 fertig- gestellt). -

Feuerwehrmagazin Des Landkreis Tirschenreuth Ausgabe 17
LandkreisLandkreis TirschenreuthTirschenreuth Aus dem Inhalt: Feuerwehrdienstgrade im Landkreis OffiziellesOffizielles OrganOrgan Statistiken · Ehrungen · Personalien Ausbildung · Übungen · Aktuelles desdes KFVKFV TirschenreuthTirschenreuth Einsätze im Bild · Indienststellungen Mitglieder im KFV stellen sich vor 17.17. JahresausgabeJahresausgabe 20082008 Erfolgreiche Jugendfeuerwehren GRUSSWORT DES LANDRATES Mehr Frauen in die Feuerwehr – Unter dem Motto „Frauen am Zug“ sollen Mädchen und Frauen verstärkt für dieses Frauen am Zug! bürgerschaftliche Engagement gewonnen Der Deutsche Feuerwehrverband hat sich werden. Um das Netz der helfenden Hän- in seiner letzten Aktion intensiv mit dem de nicht auszudünnen, benötigen wir weib- Thema „Frauen in der Feuerwehr“ ausein- liche und männliche Einsatzkräfte, die in andergesetzt. Aber auch unsere Feuerweh- ihrer Vielseitigkeit dem vielfältigen Einsatz- ren im Landkreis Tirschenreuth werben für geschehen gleichkommen. mehr Frauen in ihren Reihen. Das ständig steigende Aufgabenspektrum Das Einsatzspektrum unserer Wehren reicht erfordert den gebündelten effektiven Ein- von der klassischen Brandbekämpfung satz aller Kräfte. Trotz der hohen körperli- über die Rettung und Bergung von Unfall- chen und technischen Anforderungen stel- opfern über Hilfen bei extremen Wetterver- len sich unsere Aktiven aber täglich den He- hältnissen bis hin zu Einsätzen im Umwelt- rausforderungen. und Naturschutzbereich, um nur einige In diesem Sinne darf ich an Sie appellieren, Schwerpunkte zu nennen. Um diesen ver- bewusst mitzuhelfen, unseren Helferinnen antwortungsvollen Dienst auch künftig im und Helfern ihren schweren Dienst zu er- bisherigen Umfang aufrecht erhalten zu leichtern. Nur dadurch wird es ihnen können, müssen die Feuerwehren ihre Res- weiterhin möglich sein, ihr Engagement sourcen stärken bzw. besser nutzen. Zu den auch praktisch umzusetzen. Ressourcen gehört auch die Minderheit der Für die geleistete Arbeit zugunsten der Ge- bundesweit nur ca. -
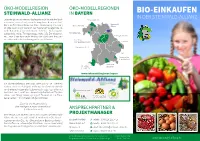
BIO-EINKAUFEN „Was Der Bauer Nicht Kennt, Das Frisst Er Nicht
ÖKO-MODELLREGION ÖKO-MODELLREGIONEN STEINWALD-ALLIANZ IN BAYERN BIO-EINKAUFEN „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Würde der Städ- IN DER STEINWALD-ALLIANZ ter kennen, was er frisst, er würde umgehend Bauer werden.“ Der erste Teil dieses Zitats von Oliver Hassencamp (dt. Autor) ist allgemein hin gut bekannt. Der zweite Satz spiegelt die ak- tuelle Situation unserer Lebensmittel wieder – Nahrungsmit- telskandale, weite Transportwege, hohe CO2-Emmissionen, etc. Diese Dinge kann jeder Verbraucher durch sein Konsum- verhalten und seine Ernährungsweise beeinflussen. www.oekomodellregionen.bayern Die Öko-Modellregion Steinwald setzt sich für den weiteren Ausbau einer nachhaltigen Ernährung ein. Denn die Vorteile von biologisch-regionalen Lebensmitteln liegen ganz klar auf der Hand: kein Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzen- Gefördert mit Mitteln des Freistaats Bayern schutz- und Düngemitteln, genügend Freiraum für die Tiere, durch das Bayerische Staatsministerium keine Gentechnik und regelmäßige Kontrollen. für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. „Essen ist eine Notwendigkeit, aber intelligent zu essen ist eine Kunst.“ (La Rochefoucauld) ANSPRECHPARTNER & Seit Herbst 2014 arbeiten die 16 Kommunen der Steinwald- PROJEKTMANAGER Allianz als eine von zwölf staatlich anerkannten Öko-Modell- regionen an dem Ziel, den Ökolandbau in Bayern zu fördern. Elisabeth Waldeck Telefon: 09682 18 22 19 - 15 Sie schaffen die notwendigen Strukturen, die die Erweiterung Steinwald-Allianz Telefax: 09682 18 22 19 - 22 des Angebots von biologischen -

Geothermal Prospection in NE Bavaria
Geo Zentrum 77. Jahrestagung der DGG 27.-30. März 2017 in Potsdam Nordbayern Geothermal Prospection in NE Bavaria: 1 GeoZentrum Nordbayern Crustal heat supply by sub-sediment Variscan granites in the Franconian basin? FAU Erlangen-Nürnberg *[email protected] 1 1 1 1 1 2 2 Schaarschmidt, A. *, de Wall, H. , Dietl, C. , Scharfenberg, L. , Kämmlein, M. , Gabriel, G. Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover Bouguer-Anomaly Introduction with interpretation Late-Variscan granites of different petrogenesis, composition, and age constitute main parts of the Variscan crust in Northern Bavaria. In recent years granites have gained attention for geothermal prospection. Enhanced thermal gradients can be realized, when granitic terrains are covered by rocks with low thermal conductivity which can act as barriers for heat transfer (Sandiford et al. 1998). The geothermal potential of such buried granites is primarily a matter of composition and related heat production of the granitoid and the volume of the magmatic body. The depth of such granitic bodies is critical for a reasonable economic exploration. In the Franconian foreland of exposed Variscan crust in N Bavaria, distinct gravity lows are indicated in the map of Bouguer anomalies of Germany (Gabriel et al. 2010). Judging from the geological context it is likely that the Variscan granitic terrain continues into the basement of the western foreland. The basement is buried under a cover of Permo- Mesozoic sediments (Franconian Basin). Sediments and underlying Saxothuringian basement (at depth > 1342 m) have been recovered in a 1390 m deep drilling located at the western margin of the most dominant gravity low (Obernsees 1) and subsequent borehole measurements have recorded an increased geothermal gradient of 3.8 °C/100 m. -
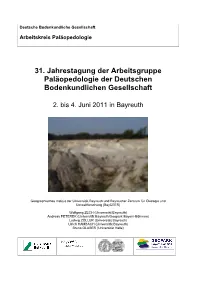
Agpp Bayreuth 2011
Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft Arbeitskreis Paläopedologie 31. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 2. bis 4. Juni 2011 in Bayreuth Geographisches Institut der Universität Bayreuth und Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) Wolfgang ZECH (Universität Bayreuth) Andreas PETEREK (Universität Bayreuth/Geopark Bayern-Böhmen) Ludwig ZÖLLER (Universität Bayreuth) Ulrich HAMBACH (Universität Bayreuth) Bruno GLASER (Universität Halle) Inhaltsverzeichnis Seite A. Programm A1 – A3 B. Arbeitsgruppensitzung am 2.6.11 B1 – B9 C. Einführung in das Exkursionsgebiet C1 – C41 D. Analysendaten 1. Fichtelgebirge und Oberpfalz D1 1. Halt: Schweinsbach (Braunerde-Podsol über Fersiallit) D1 – D7 2. Halt: Luisenburg (Blockmeere) D8 3. Halt: Schirnding (Kaolingrube mit Braunkohle) D9 – D11 4. Halt: Seedorf (reliktischer Pseudogley über fossilem Pseudogley-Ferrallit aus Phyllit) D12 – D17 5. Halt: Waldsassen (Mittagessen, Kirche) D18 6. Halt: Tirschenreuth, Rappauf (fossiler Ferrallit über Granitzersatz) D19 – D24 7. Halt: Windischeschenbach (KTB) D25 8. Halt: Kirchenthumbach (oberkreidezeitl. Boden) D26 2. Bindlach - Tschernozem D27-D33 - „Lößprofil“ D34-D39 Weitere Informationen zur Anmeldung, Anreise, Programm und Unterkunft finden sich unter http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/agpp2011/de/top/grü/html.php? id_obj = 12982 A. Programm Das Programm zur 31. Jahrestagung, zu der wir Sie herzlich einladen, umfasst: Donnerstag, 2.6.2011 14.30 – ca. 18.30 Uhr: Begrüßung und Arbeitsgruppensitzung, Hörsaal H 8, Gebäude Geowissenschaften I Ab 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Gasthof „Schwenk-Saal“ (5 Minuten Fußweg von der Universität) A1 Programm Freitag, 3.6.2011 Von 8.00 bis ca. 19.00 Uhr Exkursion zum Thema „Tertiäre Verwitterungsreste im Fichtelgebirge und in der Nördlichen Oberpfalz“. 1. Halt: Schweinsbach (Braunerde-Podsol über Fersiallit) 2. -

Linie 8440 Linie 8440 BAXI – Linie 8440 Altenstadt an Der Waldnaab
Linie BAXI – Linie 8440 09602 Altenstadt an der Waldnaab – Neustadt an der Waldnaab – Störnstein – 637 9797 8440 Püchersreuth – Parkstein – Kirchendemenreuth – Windischeschenbach Mo-Fr Anmeldeschluss 09:10 14:10 18:10 18:30 Bedienungseinschränkungen E1 E2 E3 Fahrt 006 010 014 016 Zug aus Richtung Marktredwitz 09:49 14:49 18:49 19:56 Zug aus Richtung Weiden i.d.OPf. 10:07 15:07 19:07 20:07 Altenstadt a.d.Waldnaab (Bf) 10:10 15:10 19:10 20:10 Altenstadt a.d.WaldnaabE Neustadt a.d.WaldnaabE StörnsteinE PüchersreuthE ParksteinE Pressath KirchendemenreuthE Windischeschenbach Falkenberg Reuth b. Erbendorf Sa So 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Anmeldeschluss 18:30 07:30 09:10 12:00 12:00 12:00 12:00 (Vortag) (Samstag) (Samstag) (Samstag) (Samstag) (Samstag) Fahrt 202 204 206 210 218 214 216 304 308 310 312 316 Zug aus Richtung Marktredwitz 06:42 08:28 09:49 14:49 16:49 18:49 19:56 08:28 10:49 14:49 17:49 19:56 Zug aus Richtung Weiden i.d.OPf. 07:08 08:18 10:07 15:07 17:06 19:07 20:07 08:18 11:07 15:07 18:08 20:07 Altenstadt a.d.Waldnaab (Bf) 07:10 08:30 10:10 15:10 17:10 19:10 20:10 08:30 11:10 15:10 18:10 20:10 Altenstadt a.d.Waldnaab Neustadt a.d.Waldnaab Störnstein Püchersreuth Parkstein Pressath Kirchendemenreuth Windischeschenbach Falkenberg Reuth b. Erbendorf * Für diese Fahrt am Montag gilt folgender Anmeldeschluss: Samstag, 12:00 Uhr! Bei diesen Fahrten ist bei den gekennzeichnten Haltestellen nur ein Einstieg möglich. -

Rund Um Den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren Im Fichtelgebirge Rund Um Den Ochsenkopf
Rund um den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren im Fichtelgebirge Rund um den Ochsenkopf Einleitung Vorwort S. 4 Gut zu wissen! S. 6 Fahrradmitnahme im Bus S. 7 Sieben auf einen Streich! Unsere Entdecker-Touren Übersichtskarte S. 8 1 Von Bischofsgrün bis Bad Berneck (sehr leicht) und über St. Georgen nach Bayreuth (mittelschwer) S. 10 Impressum 2 Fünf Quellen und drei Brunnen (schwer) S. 22 Idee und Ausarbeitung: VGN / S. Daßler, Gertrud Härer (Stand: 11 / 2018) 3 Seen- und Flusstour (leicht) S. 37 Bilder: Gertrud Härer, Susanne Daßler, Karin Allabauer, Karl Mistelberger 4 Von Bischofsgrün nach Pegnitz (mittelschwer) S. 41 Fehler in der Tourenbeschreibung? Korrekturen 5 Baden, Bahntrassenrollen, Besichtigen (mittelschwer) S. 57 können gerne an [email protected] geschickt werden. 6 Mit Seilbahn und Fahrrad hinauf auf den Ochsenkopf, Kartengrundlagen: Inkatlas.com, © OpenStreetMap Mitwirkende (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA) reich mäandrierend wieder hinunter (mittelschwer) S. 66 7 Historisches Weidenberg und mehr – solo oder im Gestaltung: WerbeAtelier Kolvenbach-Post Druck: Gutenberg Druck + Medien GmbH Anschluss an die Touren 2, 4 und 5 (mittelschwer) S. 72 Auflage: 7.500 Fotos Titelseite – links oben: Bad Berneck Marktplatz, Einkehren und genießen links unten: neuer Radweg zwischen Warmensteinach und Weidenberg, Einkehrmöglichkeiten S. 79 rechts: Ochsenkopfgipfel mit Wahrzeichen; © VGN/S. Daßler Fotos Rückseite – links: Felsen am Radweg, rechts: Wegeauswahl; © G. Härer 2 Tour 1 Bischofsgrün – Bad Berneck – Bad Berneck 329 369 Abzw. -

Rebuilding the Soul: Churches and Religion in Bavaria, 1945-1960
REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 _________________________________________________ A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy _________________________________________________ by JOEL DAVIS Dr. Jonathan Sperber, Dissertation Supervisor MAY 2007 © Copyright by Joel Davis 2007 All Rights Reserved The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 presented by Joel Davis, a candidate for the degree of Doctor of Philosophy, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. __________________________________ Prof. Jonathan Sperber __________________________________ Prof. John Frymire __________________________________ Prof. Richard Bienvenu __________________________________ Prof. John Wigger __________________________________ Prof. Roger Cook ACKNOWLEDGEMENTS I owe thanks to a number of individuals and institutions whose help, guidance, support, and friendship made the research and writing of this dissertation possible. Two grants from the German Academic Exchange Service allowed me to spend considerable time in Germany. The first enabled me to attend a summer seminar at the Universität Regensburg. This experience greatly improved my German language skills and kindled my deep love of Bavaria. The second allowed me to spend a year in various archives throughout Bavaria collecting the raw material that serves as the basis for this dissertation. For this support, I am eternally grateful. The generosity of the German Academic Exchange Service is matched only by that of the German Historical Institute. The GHI funded two short-term trips to Germany that proved critically important. -

Neuerscheinungen Zur Geschichte Regensburgs Und Der Oberpfalz Zusammengestellt Von Dr
Neuerscheinungen zur Geschichte Regensburgs und der Oberpfalz Zusammengestellt von Dr. Georg Völkl Wir veröffentlichten die uns im Berichtsjahr bekannt gewordenen Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Heimatkunde und Heimat- geschichte und nehmen Bezug auf die den gleichen Zusammenstellungen früherer Jahre vorausgeschickten Bemerkungen. Erneut ersuchen wir alle Mitglieder, uns auf alle einschlägigen Bücher, Schriften, Aufsätze aufmerksam zu machen und Abhand- lungen der Vereinsbücherei zu widmen. In das Verzeichnis der Neuerscheinungen können wir nur Schrift- werke aufnehmen, die uns zugehen. Alle Herausgeber und Verfasser diesbezüglicher Arbeiten — auch von Geschäftsjubiläumsschriften — werden gebeten, jeweils ein Stück dem Historischen Verein zu überlassen. Unsere große Vereinsbibliothek bietet durch die 125 Jahre um- fassende Sammlertätigkeit und durch den Tauschverkehr, der mehr als 200 gelehrte Gesellschaften umfaßt, eine reiche Fundgrube für Forscher. Daß uns alle Veröffentlichungen zugehen, ist um so wichtiger, da die von den Verlagen abzugebenden zwei Pflichtexemplare in München verbleiben, und zwar in der Staatsbibliothek und in der in aller- nächster Nähe untergebrachten Universitätsbibliothek. Anders ist dies in Franken und Schwaben; dort erhalten die Kreisbibliotheken das zweite Pflichtexemplar. Herzlicher Dank für die Unterstützung bei der Aufstellung dieses Verzeichnisses gebührt den Herren Stadtarchivar Josef Kick-Weiden, Oberstudienrat Dr. Xfitfa-Schwandorf, Staatsarchivar Dr. Scherl-Am- berg und Stadtarchivar Dr. Sydow