ISF Arbeitsbericht 2010 / 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bericht Überwachungsergebnisse Fische 2006 Bis 2014
Überwachungsergebnisse Fische 2006 bis 2014 Biologisches Monitoring der Fließgewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie Überwachungsergebnisse Fische 2006 bis 2014 Biologisches Monitoring der Fließgewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie BEARBEITUNG LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Postfach 100163, 76231 Karlsruhe Referat 41 – Gewässerschutz Uwe Bergdolt STAND Dezember 2015 Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Zustimmung der LUBW unter Quellenangabe und Überlassung von Belegexemplaren gestattet. ZUSAMMENFASSUNG 5 1 EINLEITUNG 7 2 AUSGANGSLAGE 8 2.1 Das fischbasierte Bewertungsverfahren fiBS 8 2.1.1 Fischökologische Referenzen 8 2.1.2 Fischereiliche Bestandsaufnahme 9 2.1.3 Bewertungsalgorithmus 10 2.1.4 Bewertungsergebnisse im Bereich von Klassengrenzen 12 2.2 Vorarbeiten bis 2010 13 2.2.1 Allgemeine Hinweise 13 2.2.2 Entwicklung des Messnetzes und des Fischmonitorings 14 3 FISCHBASIERTE FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG 16 3.1 Monitoringstellen-Bewertung 16 3.1.1 Zeitraum der fischBestandsaufnahmen 16 3.1.2 Plausibilisierung der Rohdaten 16 3.1.3 Monitoringstellen in erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern 19 3.1.4 Ergebnisse 19 3.2 Wasserkörper-Bewertung 21 3.2.1 Aggregationsregeln 21 3.2.2 Ergebnisse 24 4 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BEWERTUNGSERGEBNISSEN 27 4.1 Umgang mit hochvariablen Ergebnissen 27 5 KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN 28 5.1 Feinverfahren zur Gewässerstrukturkartierung 28 5.2 Monitoringnetz 28 5.3 Zeitraster der Fischbestandsaufnahmen 30 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 31 ANHÄNGE 34 Zusammenfassung Im vorliegenden Bericht werden die von der Fischereiforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg im Auftrag der LUBW bis zum Sommer 2014 in Baden-Württemberg durchgeführten Arbeiten zur ökologischen Fließ- gewässerbewertung auf Grundlage der Biokomponente Fischfauna gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erläutert und dokumentiert. -

Maßnahmenbericht Bodensee - Hegau
Maßnahmenbericht Bodensee - Hegau zum Hochwasserrisikomanagementplan Alpenrhein - Bodensee Inhalt: Beschreibung und Bewertung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos Ziele des Hochwasserrisikomanagements Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die verantwortlichen Akteure Zielgruppen: Kommunen, Behörden, Öffentlichkeit FLUSSGEBIETSBEHÖRDE Regierungspräsidium Tübingen Referat 53.2 - Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz Neckar-Bodensee 72072 Tübingen www.rp-tuebingen.de BEARBEITUNG Björnsen Beratende Ingenieure GmbH Niederlassung Augsburg Viktoriastr. 3, 86150 Augsburg www.bjoernsen.de BILDNACHWEIS Deckblatt: Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Stadt Konstanz STAND 12.02.2014 Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg Maßnahmenbericht „Bodensee-Hegau“ 1 Einführung 1 2 Abgrenzung der relevanten Gewässer im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 4 3 Beschreibung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos 7 3.1 Hochwassergefahrenkarten 7 3.1.1 Aufgabe und Vorgehen bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarten 7 3.1.2 Rechtliche Auswirkungen der Hochwassergefahrenkarten 10 3.1.3 Hochwassergefahrenkarten im Projektgebiet 10 3.2 Hochwasserrisikokarten 10 3.2.1 Aufgabe und Vorgehen bei der Erstellung der Hochwasserrisikokarten 10 3.2.2 Hochwasserrisikokarten im Projektgebiet 15 3.3 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten 26 3.3.1 Vorgehen zur Ermittlung der Schlussfolgerungen – verbale Beschreibung und Risikobewertung 26 3.3.2 Flächen mit bewertbaren Risiken im Projektgebiet und deren Risiken 31 -

Seeforelle – Arterhaltung in Den Bodenseezuflüssen
Interreg IV: Seeforelle – Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen Seeforelle - Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen Im Auftrag der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodensee-Fischerei (IBKF) AG Wanderfische 1 Interreg IV: Seeforelle – Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen aaa 2 Interreg IV: Seeforelle – Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen Interreg IV-Projektbericht Seeforelle - Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen Im Auftrag der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodensee-Fischerei (IBKF), AG Wanderfische R. Jehle, H. Kindle, R. Kistler, M, Klein, M. Konrad (Projektkoordinator), M. Kugler, H. Löffler, M. Michel (Vorsitz), R. Rösch, N. Schotzko, M. Schubert; D. Thiel. Autoren: S. Werner, P. Rey, J. Hesselschwerdt, A. Becker, J. Ortlepp (HYDRA, Büro Peter Rey, Konstanz) W. Dönni (Fischwerk, Luzern) M. Camenzind (AquaPlus, Zug) Projektarbeiten: Stefan Werner, John Hesselschwerdt, Peter Rey, Andreas Becker, Klaus Blasel, Piet Linde, Katarina Varga, Karin Mohr, Werner Dönni, Johannes Ortlepp, Uta Mürle, Lukas Boller, Romy Durst Fotos: HYDRA (P. Rey, J. Hesselschwerdt, M.Weber, C. Lott, S.Werner, K. Varga) Konstanz, den 13. Juni 2014 3 Interreg IV: Seeforelle – Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen aaa 4 Interreg IV: Seeforelle – Arterhaltung in den Bodenseezuflüssen Inhalt Zusammenfassung ..................................................................................................................................................................... 6 1 Auftrag und Zielsetzung .................................................................................................................................................... -

LKN 2 2021.Pdf
Heft 2 9. 7. 2021 ISSN 2626-0050 - BERICHTE · MEINUNGEN · HINTERGRÜNDE Schwerpunkt: Veterinärwesen und Verbraucherschutz Themen: Regionalmanagement Kultur Kommunale Inklusionsvermittler*innen Der Digitale Wertstoffhof Nachrichten: 72 Jahre Grundgesetz – Was hält unser Land zusammen? Personalien: Christoph Schauder ist neuer Landrat im Main-Tauber-Kreis Impressum HERAUSGEBER: Landkreistag Baden-Württemberg Panoramastraße 37, 70174 Stuttgart Telefon 07 11 / 22 46 20 Telefax 07 11 / 2 24 62-23 www.landkreistag-bw.de [email protected] REDAKTION: Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Alexis v. Komorowski, Michael Schlichenmaier und Nadine Steck STÄNDIGE MITARBEIT: Pressestellen der Landratsämter in Baden-Württemberg EMPFÄNGER: Die Mitglieder der Kreistage, des Landtags und des Bundestags, Geschäftsstelle, Panoramastraße 37, Stuttgart Landes- und Kommunalbehörden, Verbände und kommunalpolitisch interessierte Persönlichkeiten. Artikel, die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Redaktion. BILDNACHWEIS: Titelseite: Grafische Werke Stuttgart, Landratsämter, Jürgen Werner, Linda Weigele, Adobe Stock Rückseite: Landratsamt Heidenheim SATZ UND DRUCK: Offizin Scheufele Druck und Medien Tränkestraße 17, 70597 Stuttgart Gedruckt auf umweltfreundlich, chlorfrei hergestelltem Papier. INHALINHALTT THEMEN · Editorial Von Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Alexis v. Komorowski Seite 78 · Verwahrstellen – ein Baustein der Seuchenprävention -

Potenziale Der Wasserkraftnutzung Im Bodenseekreis
[Text eingeben] Potenziale der Wasserkraftnutzung im Bodenseekreis Amt für Wasser- und Bodenschutz April 2012 Seite 1 [Text eingeben] Inhalt 1 Einleitung und Anlass ................................................................................................... 3 2 Bedeutung der Wasserkraftnutzung im Bodenseekreis ................................................ 3 3 Datengrundlagen .......................................................................................................... 5 3.1 Wasserwirtschaftliche Daten .................................................................................. 6 3.1.1 Anlagenkataster Wasserbau (AKWB) .............................................................. 6 3.1.2 Hydrologische Daten ........................................................................................ 6 3.2 Gewässerökologie, Natur- und Artenschutz und Fischerei ..................................... 7 3.2.1 Natur- und Artenschutz .................................................................................... 7 3.2.2 Wasserrahmenrichtlinie .................................................................................... 7 3.2.3 Fischerei........................................................................................................... 7 3.3 Energiewirtschaftliche Daten .................................................................................. 8 3.3.1 Potenzialermittlung ........................................................................................... 9 3.3.2 Arbeitsvermögen am Standort -
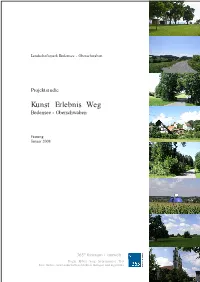
Projektstudie
Landschaftspark Bodensee - Oberschwaben Projektstudie Kunst Erlebnis Weg Bodensee - Oberschwaben Fassung Januar 2008 365° freiraum + umwelt Fregin · Kübler · Seng · Siemensmeyer · Treß Freie Garten- und Landschaftsarchitekten, Biologen und Ingenieure Landschaftspark Bodensee-Oberschwaben Projektstudie Kunst Erlebnis Weg Bodensee – Oberschwaben Januar 2008 Auftraggeber: Regionalverband Bodensee – Oberschwaben vertreten durch: Dr. Stefan Köhler, Projektkoordinator Landschaftsparks Bodensee – Oberschwaben Hirschgraben 2 88214 Ravensburg Auftragnehmer: 365° freiraum + umwelt Klosterstraße 1 88662 Überlingen Tel. 07551 / 949558-0 [email protected] www.365grad.com in Kooperation mit: Gunar Seitz Freier Künstler und Koordinator des Ortsrundweges Kluftern Hoher Weg 55 88048 Friedrichshafen – Kluftern Tel. 07544 / 740537 Bearbeitung: Dipl.- Ing. (FH) Bernadette Siemensmeyer Dipl.-Ing. (FH) Kristina Meinhold [email protected] Gunar Seitz [email protected] Begleitende Projektgruppe: Clifford Asbahr - Ortsvorsteher Kluftern, Karl–Heinz Beck - Bürgermeister Oberteuringen, Gebhard Geiger – Stadtbaumeister Markdorf, Dr. Stefan Köhler – Regionalverband Bodensee- Oberschwaben, Andreas Pflug UNB Landratsamt Bodenseekreis, Steffi Rosentreter – TBA, Abt. Grün Ravensburg, Dr. Tillmann Stottele – BSU-AUN Friedrichshafen, Prof. Dr. Andreas Zehle , KiK-Beirat Kluftern Landschaftspark Bodensee – Oberschwaben Projektstudie Kunst Erlebnis Weg Inhaltsverzeichnis Seite 1. Projekthistorie und Aufgabe der Studie ................................................................................. -

HWRMP Alpenrhein-Bodensee
Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Alpenrhein - Bodensee Dieser Kasten steht stellvertretend für ein Bild und ist 60 mm hoch und 190 mm breit. Die Position beträgt von links 2 cm und von oben 8,8 cm Flussgebietseinheit Rhein Inhalt: Beschreibung und Bewertung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos Ziele des Hochwasserrisikomanagements Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die verantwortlichen Akteure Zielgruppen: Europäische Kommission, Behörden, Kommunen und Öffentlichkeit FLUSSGEBIETSBEHÖRDE Regierungspräsidium Tübingen 72072 Tübingen www.rp-tuebingen.de BEARBEITUNG Regierungspräsidium Tübingen Referat 53.2 - Gewässer I. Ordnung Hochwasserschutz Neckar-Bodensee 72072 Tübingen www.rp-tuebingen.de BILDNACHWEIS Gemeinde Bodmann-Ludwigshafen INFRASTRUKTUR & UMWELT 2013 STAND Oktober 2015 Seite1 Erläuterungen zum Hochwasserrisikomanagementplan für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins Impressum Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- Württemberg Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher- schutz Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klima- schutz Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Saarland Thüringer -

Weiterentwicklung Des Bewertungsverfahrens "Hydrologische Güte" Als Expertensystem Zum Operationellen Einsatz Im Flussgebietsmanagement
Programm Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung (BWPLUS) Weiterentwicklung des Bewertungsverfahrens "Hydrologische Güte" als Expertensystem zum operationellen Einsatz im Flussgebietsmanagement Ch. Leibundgut, M. Eisele Institut für Hydrologie Universität Freiburg Förderkennzeichen: BWC 21013 Die Arbeiten des Programms Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung werden mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert April 2005 Inhalt Zusammenfassung.........................................................................................1 Summary .......................................................................................................1 1 Einführung..................................................................................................2 2 Methodik ....................................................................................................3 3 Softwareentwicklung..................................................................................7 4 Anwendung in Baden-Württemberg ..........................................................9 5 Diskussion und Schlussfolgerungen ........................................................10 Literatur.......................................................................................................13 Anhang 1: Ergänzung zur Methodik.......................................................... A1 Anhang 2: Ergebnisse in Baden-Württemberg - Abbildungen.................. A3 Anhang 3: Ergebnisse in Baden-Württemberg – Tabellen ........................ A6 Zusammenfassung -

LUBW Dokumentation
Überwachungsergebnisse Fische 2006 bis 2014 Biologisches Monitoring der Fließgewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie Überwachungsergebnisse Fische 2006 bis 2014 Biologisches Monitoring der Fließgewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie BEARBEITUNG LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Postfach 100163, 76231 Karlsruhe Referat 41 – Gewässerschutz Uwe Bergdolt STAND Dezember 2015 Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Zustimmung der LUBW unter Quellenangabe und Überlassung von Belegexemplaren gestattet. ZUSAMMENFASSUNG 5 1 EINLEITUNG 7 2 AUSGANGSLAGE 8 2.1 Das fischbasierte Bewertungsverfahren fiBS 8 2.1.1 Fischökologische Referenzen 8 2.1.2 Fischereiliche Bestandsaufnahme 9 2.1.3 Bewertungsalgorithmus 10 2.1.4 Bewertungsergebnisse im Bereich von Klassengrenzen 12 2.2 Vorarbeiten bis 2010 13 2.2.1 Allgemeine Hinweise 13 2.2.2 Entwicklung des Messnetzes und des Fischmonitorings 14 3 FISCHBASIERTE FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG 16 3.1 Monitoringstellen-Bewertung 16 3.1.1 Zeitraum der fischBestandsaufnahmen 16 3.1.2 Plausibilisierung der Rohdaten 16 3.1.3 Monitoringstellen in erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern 19 3.1.4 Ergebnisse 19 3.2 Wasserkörper-Bewertung 21 3.2.1 Aggregationsregeln 21 3.2.2 Ergebnisse 24 4 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BEWERTUNGSERGEBNISSEN 27 4.1 Umgang mit hochvariablen Ergebnissen 27 5 KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN 28 5.1 Feinverfahren zur Gewässerstrukturkartierung 28 5.2 Monitoringnetz 28 5.3 Zeitraster der Fischbestandsaufnahmen 30 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 31 ANHÄNGE 34 Zusammenfassung Im vorliegenden Bericht werden die von der Fischereiforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg im Auftrag der LUBW bis zum Sommer 2014 in Baden-Württemberg durchgeführten Arbeiten zur ökologischen Fließ- gewässerbewertung auf Grundlage der Biokomponente Fischfauna gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erläutert und dokumentiert. -

Begleitdokumentation Zum BG Alpenrhein / Bodensee (BW) Teilbearbeitungsgebiet 12 – Bodenseegebiet (BW) Unterhalb Schussen Bis Oberhalb Eschenzer Horn –
Begleitdokumentation zum BG Alpenrhein / Bodensee (BW) Teilbearbeitungsgebiet 12 – Bodenseegebiet (BW) unterhalb Schussen bis oberhalb Eschenzer Horn – Umsetzung der EG Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) Stand: Dezember 2015 BEARBEITUNG: Regierungspräsidium Tübingen (Flussgebietsbehörde) Referat 52 Konrad-Adenauer-Straße 20 72072 Tübingen REDAKTION: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg INHALTSVERZEICHNIS Einführung ............................................................................................................................. 4 Grundlagen und Ziele der Wasserrahmenrichtlinie ............................................................ 4 Gebietskulisse und Planungsebenen in Baden-Württemberg ............................................. 4 Vorgehensweise und Erarbeitungsprozess ........................................................................ 5 Information und Beteiligung der Öffentlichkeit ....................................................................... 6 Aufbau und Zielsetzung des Dokuments ............................................................................ 6 1 Allgemeine Beschreibung ............................................................................................... 7 1.1 Oberflächengewässer ............................................................................................. 8 1.2 Grundwasser .......................................................................................................... -

50 Jahre BUND Baden-Württemberg
Frühjahr 2013 FÜNFZIG 50 Jahre BUND Baden-Württemberg BUND Jubiläumsmagazin 2013 1 VORWORT riegel bioweine mehr als ein Liebe Leserinnen weinhändler und Leser, wer 50 wird, ist nicht alt. Wer 50 wird, hat viel er- Nachhaltigkeit ist ein gern benutztes Wort. Wie können wir lebt. Der BUND hat besonders viel erlebt. Und hat so wirtschaften, dass nach uns auch die nächste Generation das Privileg, angesichts seiner fast 80.000 Mitglie- ökonomisch sinnvoll in einer immer noch schönen und der und Unterstützer, der immer neuen Herausfor- lebenswerten Welt leben und arbeiten kann? Mit den damit derungen und der manchmal mühsam errungenen zusammen hängenden Fragen beschäftigt sich Peter Riegel seit Erfolge immer jung zu bleiben. Wir werden als die nicht richtig beschrieben ist. Mutbürger und -bürge- den Anfängen seines Unternehmerdaseins und sucht im Rahmen führende außerparlamentarische Kraft im Umwelt- rinnen stellen Partikularinteressen hintan und sind schutz wahrgenommen. Längst haben wir unsere bereit, sich sachkundig, beharrlich und gewaltfrei seiner Möglichkeiten nach passenden Antworten. von Anbeginn bewährte Strategie, immer zweiglei- einzumischen. Ein bleibender Wert an sich! Zumal sig zu fahren, auf viele andere Bereiche übertragen: Tugenden geprobt und gefestigt werden, die die + wir helfen Menschen in Südafrika und Südamerika Widerstand organisieren und zugleich Alternativen Gesellschaft braucht. Der Wissenschaftliche Beirat + wir bilden aus entwickeln. Wir sind seit 50 Jahren in Baden-Würt- der Bundesregierung zum Thema Globale Umwelt- + wir verkaufen 15% unserer Weine im Mehrwegsystem temberg in zentralen Fragen aktiv, vom Ausstieg aus veränderungen beschreibt in einem Gutachten von + wir wirtschaften nachhaltig am Standort Orsingen der Atomkraft bis zur Energiewende, vom Bemühen 2011, wie wichtig es für einen nachhaltigen Wer- + wir handeln fair um eine neue Beteiligungskultur bis hin zum Kampf tewandel ist, einerseits demokratische legitimierte + wir lernen am eigenen Schulungsweinberg gegen Gentechnik. -

WRRL Bewirtschaftungsplan 2021 Maßnahmenplanung Hydromorphologie
WRRL Bewirtschaftungsplan 2021 Maßnahmenplanung Hydromorphologie Teilbearbeitungsgebiet 12 (Bodenseegebiet westlich von Schussen) Vortrag IV Stand: April 2020 Defizitanalyse aus biologischen QK Indikationsschwerpunkte Makrophyten Belastung und Phytobenthos Makro- Phytoplankton Fische zoobenthos M D PoD M = Makrophyten D = Diatomeen PoD = Phytobenthos ohne Diatomeen Struktur / Degradation X X X Durchgängigkeit X Trophie X X X X Saprobie X Wasserhaushalt X X Versauerung X X Salinität / Versalzung X Folie 2 Maßnahmenplanung Hydromorphologie - Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 2020 Datenbasis: Landesweite Gewässerstrukturkartierung LAWA-Feinverfahren BW Quelle: Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg Folie 3 Maßnahmenplanung Hydromorphologie - Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 2020 Landesweite Gewässerstrukturkartierung Folie 4 Maßnahmenplanung Hydromorphologie - Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 2020 Hydromorphologische Maßnahmen • Erreichbarkeit der Lebensräume gewährleisten Herstellung der Durchgängigkeit Ausreichend Mindestwasser • Herstellen bzw. Wiederherstellen von Lebensräumen für Gewässerorganismen Verbesserung der Gewässerstruktur Ausreichend Mindestwasser Folie 5 Maßnahmenplanung Hydromorphologie - Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 2020 Wichtige Bewirtschaftungsfragen Herstellung der Durchgängigkeit (mit ausreichendem Mindestwasser) Problem: Altrechte neu: Fischschutz und Fischabstieg Revitalisierungen / Strukturelle Aufwertungen Problem: Flächenverfügbarkeit wichtig: Vorkaufsrecht