Oldenburger Jahrbuch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Ice Winter of 2010/11 on the German North and Baltic Sea Coasts and a Brief Description of the Ice Conditions in the Entire Baltic Sea Region
The ice winter of 2010/11 on the German North and Baltic Sea coasts and a brief description of the ice conditions in the entire Baltic Sea region Natalija Schmelzer Jürgen Holfort Ice Service, BSH Rostock Contents Page General 3 Weather conditions in the German coastal areas during the winter months 5 Ice conditions and navigation on the German North Sea coast 7 Ice conditions and navigation on the German Baltic Sea coast 10 Relation between the accumulated areal ice volume and the winter severity index 15 Ice conditions in the Kattegat, Skagerrak, and Danish waters of the western Baltic Sea 17 Ice conditions in the southern Baltic Sea 19 Ice conditions in the northern Baltic Sea region (north of 56°N) 20 Annex Figure A1. Daily ice occurrence on the North and Baltic Sea coasts in the ice winter of 2010/11 23 Table A1. Ice conditions on the German North Sea coast and in Kiel Canal in the winter of 2010/11 30 Table A2. Navigational conditions in the waters of the German North Sea coast and in Kiel Canal in the winter of 2010/11 32 Table A3. Ice conditions on the German Baltic Sea coast in the winter of 2010/11 34 Table A4. Navigational conditions in the waters of the German Baltic Sea coast in the winter of 2010/11 36 1 Figure 1. Distribution of accumulated areal ice volume on the German North Sea coast in the period from 1897 to 2011 and on the German Baltic Sea coast in the period from 1879 to 2011 2 General In terms of ice volume and duration of the ice cover in the German coastal waters, the winter of 2010/11 was a moderate ice season. -

Gemeinsame Zeitung „Gutetiden“ Der Ostfriesischen Insel Erschienen Ostfriesische Inseln Gmbh Goethestr
Auslagehinweis Gemeinsame Zeitung „gutetiden“ der Ostfriesischen Insel erschienen Ostfriesische Inseln GmbH Goethestr. 1 26757 Borkum T. 04922 933 120 M. 0151 649 299 53 Geschäftsführer: Göran Sell www.ostfriesische-inseln.de gutetiden Ausgabe 01 - Das Beste in der Nordsee. In unserer ersten Ausgabe von "gutetiden" erfahren Sie mehr zur Gründung der Ostfriesische Inseln GmbH, zum kostbaren Vermächtnis - dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, sehen die Inselwelt von oben und erfahren Spannendes über das Leben der Insulaner. gutetiden ist auf den Inseln in den Tourist Informationen erhältlich oder kann ganz bequem über diesen Link geblättert https://issuu.com/ostfriesische-inseln/docs/zeitung- ofi_ausgabe_01 werden. Viel Freude beim Lesen. www.ostfriesische-inseln.de Auf Wangerooge finden Interessierte die „gutetiden“ im ServiceCenter der Kurverwaltung sowie in der Tourist Information in der Zedeliusstraße und im Meerwasser-Erlebnisbad und Gesundheitszentrum Oase. Über die Ostfriesische Inseln GmbH: Die Ostfriesische Inseln GmbH wurde im Dezember 2017 als Dachorganisation gegründet. Ihr Anspruch ist es, die Stärken der Ostfriesischen Inseln nach außen zu tragen und sie als international führende Urlaubsregion zu etablieren. Schon jetzt gehören die Ostfriesischen Inseln zu den Top-Destinationen in Deutschland. Durch den Tourismus erwirtschaften sie einen Bruttoumsatz von rund 1 Milliarde Euro im Jahr. Gesellschafter der Ostfriesische Inseln GmbH sind die Tourismusorganisationen der Inseln Borkum, Juist, Norderney, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge – außerdem die Reedereien AG EMS, AG Norden- Frisia, Baltrum-Linie GmbH & Co. KG, Schiffahrt Langeoog, Schifffahrt Spiekeroog und in Kürze auch Schifffahrt Wangerooge. Der Geschäftsführer der Ostfriesische Inseln GmbH ist Göran Sell, der gleichzeitig auch Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH ist. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung hat Wilhelm Loth, Geschäftsführer der Staatsbad Norderney GmbH. -

Biodiversity and Ecosystem Processes in an Experimental Island System
Biodiversity and ecosystem processes in an experimental island system Dissertation to obtain the Dr. sc. agr. In the Ph. D. Program for Agricultural Sciences in Göttingen (PAG) At the Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August-University Göttingen, Germany Presented by Hagen Andert Born in Görlitz (Germany) Göttingen, September 2017 D 7 1. Referentin/Referent: Prof. Dr. Teja Tscharntke 2. Korreferentin/Korreferent: Prof. Dr. Christoph Scherber Tag der mündlichen Prüfung: 15. November 2017 2 To Darja, Arnt and Lea, and those, who always keep the bright lantern burning in dark nights. 3 Alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens endet nicht mit einem Schlusspunkt, sondern mit Fragezeichen. [All knowledge and all multiplication of our knowledge does not end with a final point, but with question marks.] Hermann Hesse (1877-1962) 4 Contents CHAPTER 1: .............................................................................................................................. 7 General Introduction .................................................................................................................. 7 GENERAL INTRODUCTION .......................................................................................... 8 STUDY REGION AND EXPERIMENTAL ISLAND SYSTEM ..................................... 9 The German barrier island Spiekeroog .................................................................................. 9 Experimental Islands – the BEFmate project ...................................................................... -

On the Beach Nature Explained
BOOK REVIEWS land disappeared under water, including viewing it as an indifferently designed work On the beach the legendary Rungholt, east of the of other purpose. The author's skills lie in present island of Pellworm. A second Donald J.P. Swift the collecting and ordering of information. Mandrdnke occurred on 11 October, Chapters that attempt to take an overview, 1694. But the main and partially enduring such as those on natural preconditions and The Morphodynamlcs of the Wadden land losses, resulting in the formation of barrier-island development, are not Sea. By Jurgen Ehlers. A.A. Balkema: Jade Bay, the Dollart and the Zuider Zee, altogether successful, although they are 1988. Pp.397. DM 185, £52. 75. did not occur as the result of single events, always interesting. On the other hand, the but gradually, through many smaller relentless procession of maps, aerial THE Wadden Sea is the intertidal zone of stages. These land losses were due to a photographs and, above all, photograph the German Bight of the North Sea. lack of technical infrastructure capable of after photograph at ground level, has a Varying in width from 10 to 50 km, it is an protecting the vast forelands from the hypnotic effect. Somewhere through the expanse of tidal channels, flats, inlets, destructive effects of later surges in later 393 figures, these vistas of misty dunes, flood and ebb deltas, barrier islands and decades. Land reclamation occurred, but beaches and marshes, and of tidal flats estuaries that extends from Den Helder only through projects that lasted for extending to the horizon, seep into the in the Netherlands to Blavandshuk in centuries. -

Omslag 2011-7.Indd 1 25/08/2011 12:05 Authors
Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a favourable conservation status Kees (C.J.) Camphuysen & Marije L. Siemensma NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research omslag 2011-7.indd 1 25/08/2011 12:05 Authors C.J. (Kees) Camphuysen Royal Netherlands Institute for Sea Research P.O. Box 59, 1790 AB Den Burg, Texel, NL Tel. + 31 222 369488, E-mail: [email protected] M.L. (Marije) Siemensma Marine Science & Communication Bosstraat 123, 3971 XC Driebergen-Rijssenburg, NL Tel. + 31 6 16830430 E-mail: [email protected] Commissioning This project was commissioned and nanced by the Dutch Ministry of Economics, Agriculture and Innovation Cover illustration Reproduced with permission from The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Jan van de Cappelle (1649) “Shipping in a Calm at Flushing with a States General Yacht Firing a Salute” Oil on oak panel, Unframed: 69.5 x 92.1 cm. The im- age shows numerous animals in the water that could be recognised as Harbour Porpoises, which were abundant at the time. Recommended citation Camphuysen C.J. & M.L. Siemensma (2011). Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a favourable conservation status. NIOZ Report 2011-07, Royal Netherlands Institute for Sea Re- search, Texel. © 2011 Royal Netherlands Institute for Sea Research omslag 2011-7.indd 4 25/08/2011 12:06 Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a favourable conservation status Kees (C.J.) Camphuysen & Marije L. Siemensma © 2011 Royal Netherlands Institute for Sea Research 1 Conservation plan Harbour Porpoise in The Netherlands – NIOZ Report 2011-07 Authors C.J. -

The Cultural Heritage of the Wadden Sea
The Cultural Heritage of the Wadden Sea 1. Overview Name: Wadden Sea Delimitation: Between the Zeegat van Texel (i.e. Marsdiep, 52° 59´N, 4° 44´E) in the west, and Blåvands Huk in the north-east. On its seaward side it is bordered by the West, East and North Frisian Islands, the Danish Islands of Fanø, Rømø and Mandø and the North Sea. Its landward border is formed by embankments along the Dutch provinces of North- Holland, Friesland and Groningen, the German state of Lower Saxony and southern Denmark and Schleswig-Holstein. Size: Approx. 12,500 square km. Location-map: Borders from west to east the southern mainland-shore of the North Sea in Western Europe. Origin of name: ‘Wad’, ‘watt’ or ‘vad’ meaning a ford or shallow place. This is presumably derives from the fact that it is possible to cross by foot large areas of this sea during the ebb-tides (comparable to Latin vadum, vado, a fordable sea or lake). Relationship/similarities with other cultural entities: Has a direct relationship with the Frisian Islands and the western Danish islands and the coast of the Netherlands, Lower Saxony, Schleswig-Holstein and south Denmark. Characteristic elements and ensembles: The Wadden Sea is a tidal-flat area and as such the largest of its kind in Europe. A tidal-flat area is a relatively wide area (for the most part separated from the open sea – North Sea ̶ by a chain of barrier- islands, the Frisian Islands) which is for the greater part covered by seawater at high tides but uncovered at low tides. -
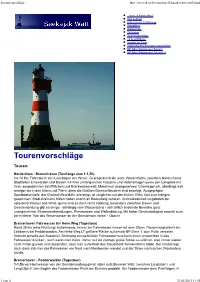
Der-Norden.De/Kajak/Watt/Watt5.Html
Tourenvorschläge http://www.kvu.der-norden.de/kajak/watt/watt5.html ...Kanu & Kajak Menü Titel & Autor Außenweser-Einführung Startplätze Stützpunkte Trittsteine Tourenvorschläge 12 Leuchttürme Trouble im Turm Änderung des Seekarten-Null (SKN) NP-Ndrs.Wattenmeer Zukunft NP-Ndrs.Wattenmeer Zukunft(2) Touren: Nordenham - Bremerhaven (Tourlänge max 1-1,5h) Ca 10 Km Fahrt durch den Lunebogen der Weser. Geprägt durch die weite Wasserfläche zwischen Nordenhams Stadtteilen Einswarden und Blexen mit ihrer umfangreichen Industrie und Hafenanlagen sowie der Luneplate mit ihren ausgedehnten Schilfflächen und Brackwasserwatt. Manchmal unangenehmer Chemiegeruch, allerdings weit weniger als in den 60ern und 70ern, denn die Größten Dreckschleudern sind beseitigt. Ausgeprägter Sportbootverkehr, der Großschiffsverkehr allerdings ist verglichen mit den frühen 70ern fast zum erliegen gekommen, Stadt-Bremens Häfen haben enorm an Bedeutung verloren. Aufmerksamkeit ist geboten bei ablaufend Wasser und Wind- gerne wird es dann recht kabbelig, besonders zwischen Blexen und Geestemündung gibt es einige - abhängig vom Wasserstand - sich örtlich ändernde Bereiche ganz unangenehmer Stromverschneidungen, Presswasser und Wellenbildung. Mit hoher Geschwindigkeit rauscht auch bei mittlerer Tide das Weserwasser an der Geestemole vorbei - Obacht. Bremerhaven Fahrwasser bis Hohe Weg (Tagestour) Rund 35 km (eine Richtung) Außenweser. Immer am Fahrwasser, immer mit dem Strom. Pausenmöglichkeit am Leitdamm bei Fedderwarden. Am Hohe Weg LT größere Fläche außerhalb NP-Zone 1, zum Füße vertreten. Vorsicht jenseits des Suezpriel, Strömung am westlichen Fahrwasserrand kann einen unvermittelt in das Fahrwasser drücken , auch wenn man meint, immer auf die nächste grüne Tonne zuzufahren, also immer wieder nach hinten gucken und überprüfen, dass man außerhalb des Steuerbord-Tonnenstrichs bleibt. Der Grund liegt darin dass sich hier das Fahrwasser von Nord nach Nordwesten wendet und der Strom nach außen (Nordosten) drückt. -

Status, Threats and Conservation of Birds in the German Wadden Sea
Status, threats and conservation of birds in the German Wadden Sea Technical Report Impressum – Legal notice © 2010, NABU-Bundesverband Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. www.NABU.de Charitéstraße 3 D-10117 Berlin Tel. +49 (0)30.28 49 84-0 Fax +49 (0)30.28 49 84-20 00 [email protected] Text: Hermann Hötker, Stefan Schrader, Phillip Schwemmer, Nadine Oberdiek, Jan Blew Language editing: Richard Evans, Solveigh Lass-Evans Edited by: Stefan Schrader, Melanie Ossenkop Design: Christine Kuchem (www.ck-grafik-design.de) Printed by: Druckhaus Berlin-Mitte, Berlin, Germany EMAS certified, printed on 100 % recycled paper, certified environmentally friendly under the German „Blue Angel“ scheme. First edition 03/2010 Available from: NABU Natur Shop, Am Eisenwerk 13, 30519 Hannover, Germany, Tel. +49 (0)5 11.2 15 71 11, Fax +49 (0)5 11.1 23 83 14, [email protected] or at www.NABU.de/Shop Cost: 2.50 Euro per copy plus postage and packing payable by invoice. Item number 5215 Picture credits: Cover picture: M. Stock; small pictures from left to right: F. Derer, S. Schrader, M. Schäf. Status, threats and conservation of birds in the German Wadden Sea 1 Introduction .................................................................................................................................. 4 Technical Report 2 The German Wadden Sea as habitat for birds .......................................................................... 5 2.1 General description of the German Wadden Sea area .....................................................................................5 -

Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980 – 2000
Numbers and Trends 1 Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980 – 2000 Overview of Numbers and Trends of Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980-2000 Recent Population Dynamics and Habitat Use of Barnacle Geese and Dark-Bellied Brent Geese in the Wadden Sea Curlews in the Wadden Sea - Effects of Shooting Protection in Denmark Shellfi sh-Eating Birds in the Wadden Sea - What can We Learn from Current Monitoring Programs? Wadden Sea Ecosystem No. 20 - 2005 2 Numbers and Trends Colophon Publisher Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven, Germany; Trilateral Monitoring and Assessment Group (TMAG); Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB). Editors Jan Blew, Theenrade 2, D - 24326 Dersau; Peter Südbeck, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Direktion Naturschutz, Göttingerstr. 76, D - 30453 Hannover Language Support Ivan Hill Cover photos Martin Stock, Lieuwe Dijksen Drawings Niels Knudsen Lay-out Common Wadden Sea Secreatariat Print Druckerei Plakativ, Kirchhatten, +49(0)4482-97440 Paper Cyclus – 100% Recycling Paper Number of copies 1800 Published 2005 ISSN 0946-896X This publication should be cited as: Blew, J. and Südbeck, P. (Eds.) 2005. Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980 – 2000. Wadden Sea Ecosystem No. 20. Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany. Wadden Sea Ecosystem No. 20 - 2005 Numbers and Trends 3 Editorial Foreword We are very pleased to present the results of The present report entails four contributions. the twenty-year period 1980 - 2000 of the Joint In the fi rst and main one, the JMMB gives an Monitoring on Migratory Birds in the Wadden Sea overview of numbers and trends 1980 - 2000 for (JMMB), which is carried out in the framework of all 34 species of the JMMB-program. -

Reassessment of Long-Period Constituents for Tidal Predictions Along the German North Sea Coast and Its Tidally Influenced River
https://doi.org/10.5194/os-2019-71 Preprint. Discussion started: 18 June 2019 c Author(s) 2019. CC BY 4.0 License. Reassessment of long-period constituents for tidal predictions along the German North Sea coast and its tidally influenced rivers Andreas Boesch1 and Sylvin Müller-Navarra1 1Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg, Germany Correspondence: Andreas Boesch ([email protected]) Abstract. The Harmonic Representation of Inequalities is a method for tidal analysis and prediction. With this technique, the deviations of heights and lunitidal intervals, especially of high and low waters, from their respective mean values are represented by superpositions of long-period tidal constituents. This study documents the preparation of a constituents list for the operational application of the Harmonic Representation of Inequalities. Frequency analyses of observed heights and 5 lunitidal intervals of high and low water from 111 tide gauges along the German North Sea coast and its tidally influenced rivers have been carried out using the generalized Lomb-Scargle periodogram. One comprehensive list of partial tides is realized by combining the separate frequency analyses and by applying subsequent improvements, e.g. through manual inspections of long-time data. The new set of 39 partial tides largely confirms the previously used set with 43 partial tides. Nine constituents are added and 13 partial tides, mostly in close neighbourhood of strong spectral components, are removed. The effect of these 10 changes has been studied by comparing predictions with observations from 98 tide gauges. Using the new set of constituents, the standard deviations of the residuals are reduced by 2.41% (times) and 2.30% (heights) for the year 2016. -

Ground Contact by the Oil Tanker KATJA in the River Jade on 14 August 2012
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation Federal Higher Authority subordinated to the Ministry of Transport and Digital Infrastructure Investigation Report 289/12 Serious Marine Casualty Ground contact by the oil tanker KATJA in the River Jade on 14 August 2012 18 November 2014 BundesstBel le fürSSeeuUnfalluntersuchung Ref.: 289/12 Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation The investigation was conducted in conformity with the Law to improve safety of shipping by investigating marine casualties and other incidents (Maritime Safety Investigation Law - SUG) of 16 June 2002, amended most recently by Article 1 of 22 November 2011, BGBl. (Federal Law Gazette) I p. 2279. According to said Law, the sole objective of this investigation is to prevent future accidents and malfunctions. This investigation does not serve to ascertain fault, liability or claims (Article 9(2) SUG). This report should not be used in court proceedings or proceedings of the Maritime Board. Reference is made to Article 34(4) SUG. The German text shall prevail in the interpretation of this investigation report. Issued by: Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung - BSU Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation Bernhard-Nocht-Str. 78 20359 Hamburg Germany Director: Volker Schellhammer Phone: +49 40 31908300 Fax: +49 40 31908340 [email protected] www.bsu-bund.de _____________________________________________________________________________________________________ Page 2 of 48 BundesstBel le fürSSeeuUnfalluntersuchung -

Analyse Und Bewertung Der Ergebnisse Langjähriger Müllerfassungsprojekte an Der Dt. Nordseeküste
72 Analyse und Bewertung der Ergebnisse langjähriger Müllerfassungsprojekte an der deutschen Nordseeküste Zusammengestellt von Eike Hartwig Unter dem Titel „Untersuchung der Ver- lum (Nord und Süd) im Sommerhalbjahr „Metall“ wurden Konserven- und Geträn- schmutzung der Spülsäume durch Schiffs- durch. Die Daten dieser Erfassungen bil- kedosen am häufigsten registriert gefolgt müll an der deutschen Nordseeküste“ liegt den die Basis der nachfolgenden Analyse. von der Kategorie „Spraydosen“. In der ein Bericht in englischer Sprache eines Auf den vier Strecken in Schleswig-Hol- Hauptkategorie „Glas und Porzellan“ über- vom Umweltbundesamt Berlin finanzier- stein (Sylt, Büsum, Amrum und Föhr) wogen Flaschen (45%) und Gläser (12%) ten F&E-Vorhaben vor (FLEET 2003), wel- wurde nur die Anzahl der Müllteile erfasst; sowie Glühbirnen und Neonröhren (10%). ches die Ergebnisse der Erfassung von auf den übrigen Strecken (Mellum-Nord, Die Hauptkategorie „Fischerei“ setzte sich gestrandetem Müll im Rahmen eines -Süd, Minsener Oog und Scharhörn) aus Netzen (43%) und Schiffstauen (43%) OSPAR-Projektes auf fünf Kontroll- sowohl Anzahl als auch Gewicht der Müll- zusammen. Ungefähr 46% der Holzteile strecken (Sylt, Scharhörn, Minsener Oog, teile. wurden als Bretter, Balken und Pfähle regi- Juist und Norderney) im Zeitraum April striert und weitere 35% als Bäume, Äste 2002 bis Juli 2003 und auf acht Kontroll- Plastik, Styropor und Schaumgummi und Faschinen. Regionale Unterschiede strecken (Sylt, Amrum, Föhr, Büsum, macht im letzten Jahrzehnt bis 2002 in der Zusammensetzung zwischen Nie- Scharhörn, Minsener Oog, Mellum-Nord 62,5% der Mengen des an der deutschen dersachsen und Schleswig-Holstein, die und -Süd) im Rahmen von vier langjähri- Nordseeküste gestrandeten Mülls aus. nicht auf die unterschiedlichen Erfas- gen Müllerfassungsprojekten an der deut- 19% der Müllteile gehörten der Hauptka- sungszeiträume zurückzuführen sind, schen Nordseeküste im Zeitraum von tegorie „Holz“ an, 6% der „Fischerei“, 5% wurden festgestellt.