Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (Mega)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Uebersicht .Lor in Den Jähren 1880, 1881 Und 1882 Nur «Tain Gebiete Der Englischen Philologie Erschienenen Bttcher Und Aufsätze
Uebersicht .lor in den jähren 1880, 1881 und 1882 nur «tain gebiete der englischen philologie erschienenen bttcher und aufsätze. Von Friedrich Lüns. I. Allgemeines. Sammelwerke* Bücherverzeichnisse. Gelehrtengesohiohte. Storni (Prof. Job an), Englische Philologie. Anleitung zum wissenschaft- lichen Studium der engl. spräche. Vom verf. ftir das deutsche publikum bearbeitet. I. Die lebende spräche. Gr. S (XVI, 40S ss.). Heübronn, Henninger; n. m. 9. S l. l Siehe Anglia IV, Anzeiger, 128—31 (Moritz Trautmann); Engl. Studien V, 250—59 (Thmn), 39*—408 (Ernst Regel), 459—60 (Thtim); Herrig's Archiv LXV, 2. 3 (D. Asher); G5tt. Gel. Anz. 44 (H. Sweet); Literaturblatt fiir germ, und nun. Phil. Ill, 200 (E. Sievers); American Journal of Phil. Vol. II, No. s, 4S4 ff. (Garnett); Zeitschr. f. d. österr. ttyumaaien W, 4 (Schipper); Rev. Crit. 4t (von C. J.). Seh mit z (Beruh.), Encyclopedic des philologischen Studiums der neueren Sprachen, hauptsächlich der französischen und englischen. 2. siippl., 2. aufl. Nebst einer abhandhing über begriff und umfang unseres faches. Gr. S (VIII, 124 ss.). Leipzig, C. A. Koch; n. in. 2,50. 81. 2 — Dasselbe. 3. suppl, 2. aufl. Nebst einer abhandlung über englische philologie insbesondere. Hrsg. von August Kessler. Gr. 8 (X, 138 ss.); n. m. 2,80. 3 Siehe Engl. Studien IV, 513 f. (E. Kölbing). Mahn (Prof. Dr. A.), Ucbcr das Studium der neueren Sprachen auf Hoch- schulen. Gr. s (S ss.). Berlin, Dümmler; baar n. m. 0,50. 80. 4 Asher (Dr. David), Ueber den Unterricht in den neueren Sprachen, spe- cieller der englischen, au unseren Universitäten und höheren Schulen. Anglia, VI. -

Band 1 Und Band 27 Der Werke Von Karl Marx Und Friedrich Engels Sowie Im Vorliegenden Ergänzungsband ( 2
Inhalt Vorwort ... IX Karl Marx (1842-1844) Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion. Von einem Rheinländer 3 Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. Von einem Rheinländer. Erster Artikel: Debatten über Preßfreiheit und Publikation der Landständischen Verhandlungen 28 Das philosophische Manifest der historischen Rechtsschule 78 Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung" 86 Der Kommunismus und die Augsburger „Allgemeine Zeitung" 105 Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. Von einem Rheinländer. Dritter Artikel: Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz 109 Der Ehescheidungsgesetzentwurf 148 Das Verbot der „Leipziger Allgemeinen Zeitung" 152 Das Verbot der „Leipziger Allgemeinen Zeitung" für den preußischen Staat 152 Die „Kölnische Zeitung" und das Verbot der „Leipziger Allgemeinen Zeitung" ... 154 Die gute und die schlechte Presse 155 Replik auf den Angriff eines „gemäßigten" Blattes 156 Replik auf die Denunziation eines „benachbarten" Blattes 159 Die Denunziation der „Kölnischen" und die Polemik der „Rhein- und Mosel- Zeitung" 162 Die „Rhein- und Mosel-Zeitung" 169 Rechtfertigung des f t-Korrespondenten von der Mosel 172 Erklärung 200 Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie 201 Kritik des Hegeischen Staatsrechts (§§ 261-313) 203 Briefe aus den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern" 337 Zur Judenfrage 347 Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einleitung 378 Kritische Randglossen zu dem Artikel „Der König von Preußen und die Sozialreform. Von einem Preußen" 392 Friedrich Engels (1839-1844) Briefe aus dem Wuppertal 413 Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen 433 Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen 446 Englische Ansicht über die innern Krisen 454 Die innern Krisen 456 Stellung der politischen Partei 461 Lage der arbeitenden Klasse in England 464 Die Korngesetze 466 Briefe aus London (I-IV) .468 Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent 480 Bewegungen auf dem Kontinent 497 Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie 499 Die Lage Englands. -

KARL MARX FREDERICK ENGELS Collected Vforks
KARL MARX FREDERICK ENGELS Collected Vforks \t)hrme45 Marx and Engels 1874-1879 V Contents Preface XVII KARL MARX AND FREDERICK ENGELS LETTERS January 1874-December 1879 1874 1. Marx to Ludwig Kugelmann. 19 January 3 2. Engels to Wilhelm Liebknecht. 27 January 4 3. Engels to Friedrich Adolph Sorge. 14 February 7 4. Engels to Wilhelm Bios. 21 February 8 5. Engels to Friedrich Adolph Sorge. 27 February 9 6. Marx to George Moore. 26 March 10 7. Marx to George Moore. 28 March 12 8. Marx to Jenny Marx. 19 April 13 9. Marx to Jenny Longuet. Between 20 and 24 April 15 10. Marx to Maurice Lachâtre. 12 May 16 11. Marx to Ludwig Kugelmann. 18 May 17 12. Engels to Gottfried Ermen. 1 June 19 13. Marx to Ludwig Kugelmann. 24 June 21 14. Marx to Engels. 15 July 21 15. Engels to Marx. 21 July 23 16. Marx to Maurice Lachâtre. 23 July 25 17. Engels to Jenny Longuet. 2 August 27 VI Contents 18. Marx to Engels. 4 August 27 19. Marx to Friedrich Adolph Sorge. 4 August 28 20. Marx to Ludwig Kugelmann. 4 August 31 21. Marx to Ludwig Kugelmann. 10 August 32 22. Engels to Marx. 12 August 32 23. Marx to Engels. 14 August 33 24. Marx to Jenny Longuet. 14 August 34 25. Marx to Engels. 1 September 37 26. Engels to Marx. 5 September 38 27. Engels to Friedrich Adolph Sorge. 12[-17] September 40 28. Marx to Engels. 18 September 45 29. Marx to Max Oppenheim. 20 September 47 30. -

Life and Letters of George Jacob Holyoake
THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES X^ecr /^/^ LIFE AND LETTERS OF GEORGE JACOB HOLYOAKE GEORGE JACOB HOLYOAKE. (1882.) LIFE AND LETTERS OF George Jacob Holyoake BY JOSEPH McCABE " AUTHOR OF "peter ABELARD," TALLEYRAND," ETC. VOL. II [issued for the rationalist press association, ltd. J London : WATTS & CO., 17, JOHNSON'S COURT, FLEET STREET, E.C. 1908 IDA CONTENTS CHAP. PAGE XVI. NEARING WESTMINSTER . I XVII. THE IDEALIST IN POLITICS 22 XVIII. FROM THE strangers' GALLERY 44 XIX. SOCIAL AND EDUCATIONAL WORK 69 XX. THE ORGANISATION OF CO-OPERATION 89 XXI. VISITS TO AMERICA .... 109 XXII. THE PRESENT DAY . 135 XXIII. CORRESPONDENCE WITH GLADSTONE AND CHAM- BERLAIN ..... 161 XXIV. AMONGST THE CO-OPERATORS ABROAD 184 XXV. EASTERN LODGE .... 206 XXVI. LABOUR CO-PARTNERSHIP . 229 XXVII. THE RATIONALIST PRESS ASSOCIATION 251 XXVIII. HOLVOAKE AS A WRITER . 271 XXIX. A CHEERFUL OCTOGENARIAN 287 XXX. THE MAN AND HIS WORK 313 BIBLIOGRAPHY ..... 329 INDEX ...... 345 879038 LIST OF ILLUSTRATIONS PHOTOGRAVURE PORTRAIT OF G. J. HOLYOAKE TAKEN IN 1862 {^Frontispiece). PORTRAIT OF MR. HOLYOAKE TAKEN IN 1 888. PORTRAIT OF MR. HOLYOAKE TAKEN IN 19OI. EASTERN LODGE, BRIGHTON (mR. HOLYOAKE'S RESIDENCE FROM 1886 TO 1906). THE MEMORIAL ON MR. HOLYOAKE'S GRAVE IN HIGHGATE CEMETERY. LIFE AND LETTERS OF GEORGE JACOB HOLYOAKE CHAPTER XVI NEARING WP:STMINSTER The first half of Holyoake's public life was, like the first half of the nation's life in the nineteenth century, neces- sarily tentative in many important respects. He was an articulate part of the new national spirit. His boyish eyes had opened upon a world that had not fully emerged from the chrysalis-stage of feudalism, but was stirred with the deep, vague instinct of advancing to a brighter and freer existence. -
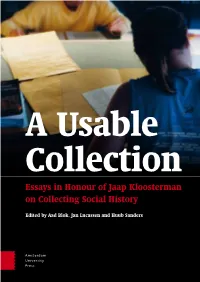
A Usable Collection
A Usable Established in 1935, the International Institute of Social History is one of the world's leading research institutes on social history, holding one of the richest collections in the field. These collections and archives contain evidence of a social and economic world that affected the life and happiness of millions of people. Including material from every continent from the French Revolution to the Chinese student revolt of 1989 and the new social and protest movements of the early 2000s, the IISH collection is intensively used by researchers from all over the world. In his long and singular career, former director Jaap Collection Kloosterman has been central to the development of the IISH into a world leader in researching and collecting social and labour history. The 35 essays brought together in this volume in honour of him, A Usable give a rare insight into the history of this unique institute and the development of its collections. The contributors also offer answers to the question what it takes to devote a lifetime to collecting social Collection history, and to make these collections available for research. The essays offer a unique and multifaceted Essays in Honour of Jaap Kloosterman view on the development of social history and collecting its sources on a global scale. on Collecting Social History Edited by Aad Blok, Jan Lucassen and Huub Sanders ISBN 978 90 8964 688 0 AUP.nl A Usable Collection A Usable Collection Essays in Honour of Jaap Kloosterman on Collecting Social History Edited by Aad Blok, Jan Lucassen and -

Vorwort 15 Editorische Hinweise Danksagung Trier 1814-1842
Vorwort 15 Editorische Hinweise 23 Danksagung 25 Trier 1814-1842 1 Jenny von Westphalen, Denkspruch für Betty Rosbach, 28. Februar 1828 27 2 Johann Abraham Küpper, Denkspruch für Jenny von Westphalen, 30. März 1828 27 3 Ludwig von Westphalen an Jenny von Westphalen, 12. Februar 1832 28 4 Ludwig von Westphalen, Aufstellung finanzieller Zuwendungen für Jenny von Westphalen, 8. November 1836 28 5 Karl Marx, Widmung für Jenny von Westphalen, Herbst 1836 30 6 Jenny von Westphalen an Karl Marx, nach dem 10. Mai 1838, Fragment 30 7 Jenny von Westphalen an Karl Marx, 24. Juni 1838, Fragment 31 8 Jenny von Westphalen an Caroline von Westphalen, 2. Juli 1838, Fragment 34 9 Caroline von Westphalen für Jenny von Westphalen, 25. Dezember 1838 36 10 Karl Marx, Widmung für Jenny von Westphalen, Januar/Februar 1839 36 11 Jenny von Westphalen an Karl Marx, zwischen 1839 und 1840, Fragment 37 12 Jenny von Westphalen an Karl Marx, um den 10. August 1841 40 13 Jenny von Westphalen an Karl Marx, 13. September 1841 43 Kreuznach 1843 14 Jenny von Westphalen an Karl Marx, Anfang März 1843 49 Paris 1843-1845 15 Jenny Marx an Emma Herwegh, Anfang 1844 53 16 Jenny Marx an Karl Marx, um den 21. Juni 1844 53 17 Jenny Marx an Karl Marx, zwischen dem 4. und 7. August 1844 57 http://d-nb.info/1036235300 18 Jenny Marx an Karl Marx, zwischen dem 11. und 18. August 1844 58 19 Heinrich Heine an Jenny Marx, 1. Januar 1845 62 20 Jenny Marx an Karl Marx, vor dem 1. -

Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (Mega)
KARL MARX FRIEDRICH ENGELS GESAMTAUSGABE (MEGA) DRITTE ABTEILUNG BRIEFWECHSEL BAND 7 Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands KARL MARX FRIEDRICH ENGELS BRIEFWECHSEL SEPTEMBER 1853 BIS MÄRZ 1856 TEXT DIETZ VERLAG BERLIN 1989 Redaktionskommission der Gesamtausgabe: Günter Heyden und Georgi Smirnow (Leiter), Erich Kundel und Alexander Malysch (Sekretäre), Georgi Bagaturija, Rolf Dlubek, Heinrich Gemkow, Lew Golman, Michail Mtschedlow, Richard Sperl Redaktionskommission der Dritten Abteilung: Wera Morosowa (Leiter), Galina Golowina, Martin Hundt, Alexander Malysch, Inna Ossobowa, Brigitte Rieck, Lew Tschurbanow Bearbeitung des Bandes: Walentina Morosowa, Jakow Rokitjanski, Alla Rybikowa und Natalja Wolkowa Redakteure: Maija Kotschetkowa und Wera Morosowa Gutachter: Brigitte Rieck Marx, Karl: Gesamtausgabe : (MEGA) / Karl Marx ; Friedrich Engels. Hrsg. vom Inst, für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee d. KPdSU u. vom Inst, für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee d. SED. - Berlin : Dietz Verl. [Sammlung]. Abt. 3, Briefwechsel Bd. 7. Briefwechsel September 1853 bis März 1856 Text. - 1989. - 50, 586 S. : 17 Abb. Apparat. - 1989. - S. 587-1249 : 21 Abb. III. Abt. ISBN 3-320-00100-0 Bd. III/7 ISBN 3-320-00108-6 Text und Apparat Mit 38 Abbildungen © Dietz Verlag Berlin 1989 Lizenznummer 1 • LSV 0046 Technische Redaktion: Heinz Ruschinski und Waltraud Schulze -

The Online Library of Liberty Classics in The
Humboldt, The Sphere and Duties of Government (1852) (1854 ed.) Page 1 of 92 THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY © 2004 Liberty Fund, Inc. CLASSICS IN THE HISTORY OF LIBERTY WILHELM VON HUMBOLDT, THE SPHERE AND DUTIES OF GOVERNMENT (THE LIMITS OF STATE ACTION) (1792) Updated: March 4, 2004 Return to the Introduction to Wilhelm von Humboldt and the detailed Table of Contents. EDITION USED The Sphere and Duties of Government. Translated from the German of Baron Wilhelm von Humboldt, by Joseph Coulthard, Jun. (London: John Chapman, 1854). TABLE OF CONTENTS l PREFACE. ¡ ENDNOTES l CHAPTER I. INTRODUCTION. ¡ ENDNOTES l CHAPTER II. OF THE INDIVIDUAL MAN, AND THE HIGHEST ENDS OF HIS EXISTENCE. ¡ ENDNOTES l CHAPTER III. ON THE SOLICITUDE OF THE STATE FOR THE POSITIVE WELFARE OF THE CITIZEN. ¡ ENDNOTES l CHAPTER IV. OF THE SOLICITUDE OF THE STATE FOR THE NEGATIVE WELFARE OF THE CITIZEN—FOR HIS SECURITY. ¡ ENDNOTES l CHAPTER V. ON THE SOLICITUDE OF THE STATE FOR SECURITY AGAINST FOREIGN ENEMIES. ¡ ENDNOTES l CHAPTER VI. ON THE SOLICITUDE OF THE STATE FOR THE MUTUAL SECURITY OF THE CITIZENS.—MEANS FOR ATTAINING THIS END.—INSTITUTIONS FOR REFORMING THE MIND AND CHARACTER OF THE CITIZEN.—NATIONAL EDUCATION. ¡ ENDNOTES l CHAPTER VII. RELIGION. ¡ ENDNOTES l CHAPTER VIII. AMELIORATION OF MORALS. ¡ ENDNOTES l CHAPTER IX. THE SOLICITUDE OF THE STATE FOR SECURITY MORE ACCURATELY AND POSITIVELY DEFINED.—FURTHER DEVELOPMENT OF THE IDEA OF SECURITY. l CHAPTER X. ON THE SOLICITUDE OF THE STATE FOR SECURITY WITH RESPECT TO ACTIONS WHICH DIRECTLY RELATE TO THE AGENT ONLY. (POLICE LAWS.) ¡ ENDNOTES l CHAPTER XI. -

Wilhelm Von Humboldt, the Sphere and Duties of Government (The Limits of State Action) (1854 Ed.) (1792)
Humboldt_0053 09/15/2005 09:26 AM THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY © Liberty Fund, Inc. 2005 http://oll.libertyfund.org/Home3/index.php WILHELM VON HUMBOLDT, THE SPHERE AND DUTIES OF GOVERNMENT (THE LIMITS OF STATE ACTION) (1854 ED.) (1792) URL of this E-Book: http://oll.libertyfund.org/EBooks/Humboldt_0053.pdf URL of original HTML file: http://oll.libertyfund.org/Home3/HTML.php?recordID=0053 ABOUT THE AUTHOR Described by Hayek as Germany’s greatest philsopher of freedom" Humboldt wrote a path-breaking defense of the minimal state which had a profound influence on John Stuart Mill. Humboldt later became Director of the Section for Public Worship and Education, in the Ministry of Interior. In this capacity, he directed the reorganization of the Prussian public education system, and, in particular, founded the University of Berlin. ABOUT THE BOOK A mid-19th century translation of this work. "The grand, leading principle, towards which every argument . unfolded in these pages directly converges, is the absolute and essential importance of human development in its richest diversity." This description by Wilhelm von Humboldt of his purpose in writing The Limits of State Action animates John Stuart Mill’s On Liberty and serves as its famous epigraph. Seldom has a book spoken so dramatically to another writer. Many commentators even believe that Humboldt’s discussion of issues of freedom and individual responsibility possesses greater clarity and directness than Mill’s. The Limits of State Action, by "Germany’s greatest philosopher of freedom," as F. A. Hayek called him, has an exuberance and attention to principle that make it a valuable introduction to classical liberal political thought. -

ELISÉE RECLUS, UNE CHRONOLOGIE FAMILIALE 1796-2014 Christophe Brun, Federico Ferretti
ELISÉE RECLUS, UNE CHRONOLOGIE FAMILIALE 1796-2014 Christophe Brun, Federico Ferretti To cite this version: Christophe Brun, Federico Ferretti. ELISÉE RECLUS, UNE CHRONOLOGIE FAMILIALE 1796- 2014 : Sa vie, ses voyages, ses écrits Ses ascendants, ses collatéraux, les descendants, leurs écrits Sa postérité. 2014, http://hal.archives-ouvertes.fr/. hal-01018828 HAL Id: hal-01018828 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01018828 Submitted on 5 Jul 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. ELISÉE RECLUS, UNE CHRONOLOGIE FAMILIALE Sa vie, ses voyages, ses écrits Ses ascendants, ses collatéraux, les descendants, leurs écrits Sa postérité 1796-2014 Christophe Brun avec l’aimable et précieuse participation de Federico Ferretti Hébergement : http://raforum.info/reclus/ Juin 2014 P a g e | 2 Carte postale éditée par la Veuve Henry Guillier à Libourne vers 19231. Onésime Reclus n’est pas né à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), mais à Baigts-Castétarbe près d’Orthez (Basses- Pyrénées). La rue Élisée Reclus est devenue la rue des Frères Reclus en 1936. Pierre tombale commémorative de l’inhumation d’Elie et Elisée Reclus au cimetière d’Ixelles (Bruxelles, Belgique), cliché pris en 2006 2. -

Bürgerliche Demokraten an Der Seite Von Marx Und Engels
---------------------~.~ kreis, obgleich jedem von uns klar ist, daß die weitere Arbeit an den Abteilungen I Heinrich Gemkow und besonders 111 der MEGA vertieftes biographisches Wissen erfordert. Es gibt dar über hinaus aber auch drängende aktuell-politische Aspekte. Wie nützlich kann uns verbreitertes und vertieftes Wissen um die praktische Bünd Bürgerliche Demokraten nispolitik von Marx und Engels in ihrem politischen und wissenschaftlichen Alltag an der Seite von Marx und Engels für die Lösung heute dringend anstehender Aufgaben einer umfassenden Bundes genossenschaft im Ringen um die vernünftige Lösung gegenwärtiger und künftiger Lebensfragen der Menschheit sein! Wie hilfreich ist es für uns Marxisten-Leninisten von heute, sich auch in diesem Bemühen noch stärker und konkreter in einer Tradi· tionslinie zu wissen, die die Schöpfer des Marxismus selbst begründet haben' Wie Als Karl Marx am 17. November 1860 das Vorwort zu seiner Streitschrift "Herr Vogt" unverzichtbar ist es, mit diesem Tatsachenmaterial gegen die Meute von Marx-En abschloß, beendete er es mit den Worten: "Schließlich spreche ich meinen herzli gels-Verfälschern zu Felde zu ziehen, die die Begründer des wissenschaftlichen So· chen Dank aus für die bereitwillige Hülfe, die mir bei Abfassung dieser Schrift nicht zialismus, insbesondere Marx, zu isolierten Einzelkämpfern, gefühlskalten Egozen· nur von alten Parteifreunden geworden, sondern von vielen mir früher fernstehen trikern oder bornierten Sektierern herabwürdigen wollen den und mir zum Theil jetzt noch persönlich unbekannten Mitgliedern der Emigration Selbstverständlich waren Bündnisbeziehungen '-- ob auf der Ebene von Personen oder von Organisationen - abhängig vom jeweiligen Kräfteverhältnis, von der kon in der Schweiz, Frankreich und England... 1 Zu der letztgenannten Gruppe gehörten u. -

Eduard Bernstein My Years of Exile
Eduard Bernstein My Years of Exile Reminiscences of a Socialist (1915/1921) 1 My Years of Exile Eduard Bernstein Halaman 2 Originally published in German in 1915. English translation published 1922. Translated by Bernard Miall. Transcribed by Ted Crawford. Marked up by Einde O’Callaghan for the Marxists’ Internet Archive . Author’s Preface I. Across the St. Gotthard in 1878 II. In and about Lugano thirty years ago III. A bitter winter in Lugano IV. In Zurich V. Life and work in Zurich VI. Secret congresses and banishment from Switzerland VII. Visits to, and exile in, London VIII. London peculiarities and English characteristics IX. Engels’ house and his “evenings” X. The socialist intellectuals in England XI. The life of the peoples and the proletarian socialist in England My Years of Exile Eduard Bernstein Halaman 3 Author’s Preface AT the request of the editor of the Weisse Blätter , René Schickele, I decided in the late autumn of 1915, to place on record a few reminiscences of my years of wandering and exile. These reminiscences made their first appearance in the above periodical, and now, with the kind permission of the editor, for which I take this opportunity of expressing my sincere thanks, I offer them in volume form to the reading public, with a few supplementary remarks and editorial revisions. My principal thought, in writing these chapters, as I remarked at the time of their first appearance, and repeat to-day, was to record my impressions of the peoples whose countries have given me a temporary refuge. At the same time I have also made passing allusion to the circumstances which caused me to make the acquaintance of these peoples and countries.