"Reichskristallnacht" in Schleswig-Holstein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

20 Dokumentar Stücke Zum Holocaust in Hamburg Von Michael Batz
„Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke zum Holocaust in „Hört damit auf!“ „Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke Hamburg Festsaal mit Blick auf Bahnhof, Wald und uns 20 Dokumentar stücke zum zum Holocaust in Hamburg Das Hamburger Polizei- Bataillon 101 in Polen 1942 – 1944 Betr.: Holocaust in Hamburg Ehem. jüd. Eigentum Die Versteigerungen beweglicher jüdischer von Michael Batz von Michael Batz Habe in Hamburg Pempe, Albine und das ewige Leben der Roma und Sinti Oratorium zum Holocaust am fahrenden Volk Spiegel- Herausgegeben grund und der Weg dorthin Zur Geschichte der Alsterdorfer Anstal- von der Hamburgischen ten 1933 – 1945 Hafenrundfahrt zur Erinnerung Der Hamburger Bürgerschaft Hafen 1933 – 1945 Morgen und Abend der Chinesen Das Schicksal der chinesischen Kolonie in Hamburg 1933 – 1944 Der Hannoversche Bahnhof Zur Geschichte des Hamburger Deportationsbahnhofes am Lohseplatz Hamburg Hongkew Die Emigration Hamburger Juden nach Shanghai Es sollte eigentlich ein Musik-Abend sein Die Kulturabende der jüdischen Hausgemeinschaft Bornstraße 16 Bitte nicht wecken Suizide Hamburger Juden am Vorabend der Deporta- tionen Nach Riga Deportation und Ermordung Hamburger Juden nach und in Lettland 39 Tage Curiohaus Der Prozess der britischen Militärregierung gegen die ehemalige Lagerleitung des KZ Neuengam- me 18. März bis 3. Mai 1946 im Curiohaus Hamburg Sonderbehand- lung nach Abschluss der Akte Die Unterdrückung sogenannter „Ost“- und „Fremdarbeiter“ durch die Hamburger Gestapo Plötzlicher Herztod durch Erschießen NS-Wehrmachtjustiz und Hinrichtungen -

Information Issued by The
Vol. XV No. 10 October, 1960 INFORMATION ISSUED BY THE. ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN t FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY ROAD (Comer Fairfax Road), Offict and Consulting Hours : LONDON, N.W.3 Monday to Thursday 10 a.m.—I p.m. 3—6 p.m. Talephona: MAIda Vala 9096'7 (General Officel Friday 10 a.m.—I p.m. MAIda Vale 4449 (Employment Agency and Social Services Dept.} 'Rudolf Hirschfeld (Monlevideo) a few others. Apart from them, a list of the creators of all these important German-Jewish organisations in Latin America would hardly con tain a name of repute outside the continent. It GERMAN JEWS IN SOUTH AMERICA it without any doubt a good sign that post-1933 German Jewry has been able to produce an entirely new generation of vigorous and success I he history of the German-Jewish organisations abroad '"—to assert this would be false—they ful leaders. =8ins in each locality the moment the first ten consider themselves as the sons of the nation In conclusion two further aspects have to be r^Ple from Germany disembark. In the few which has built up the State of Israel, with the mentioned : the relationship with the Jews around thp "if- ^^^^^ Jewish groups were living before consciousness that now at last they are legitimate us, and the future of the community of Jews from ne Hitler period the immigrants were helped by members of the national families of the land they Central Europe. Jewish life in South America ne earlier arrivals. But it is interesting that this inhabit at present. -

It-Tlettax-Il Leġiżlatura Pl 1947
IT-TLETTAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 1947 Dokument imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Numru 137 tal-4 ta’ Lulju 2018 mill-Ispeaker, l-Onor. Anġlu Farrugia. ___________________________ Raymond Scicluna Skrivan tal-Kamra 11th Parliamentary Intelligence Security Forum 2 July 2018 Berlin, Germany Hon Anglu Farrugia, Speaker Parliamentary Delegation Report to the House of Representatives. Date: 2nd July 2018 Venue: Berlin, Germany. Maltese delegation: Honourable Anglu Farrugia, President of the House of Representatives. Programme: At the invitation of the US Member of Congress, Robert Pittenger, Chairman of the Congressional Taskforce on Terrorism and Unconventional Warfare and Han. Johannes Salles M.P. from the Bundestag, the Speaker of the House of Representatives, Parliament of Malta, Honourable Anglu Farrugia, was invited to participate at the meeting of the 11'h Parliamentary Security-Intelligence Forum. Participation of Speaker Anglu Farrugia at the 2018 Parliamentary Intelligence Security Forum, co-hosted by Congressman Robert Pittenger and Honourable Member of the German Bundestag, Johannes Salles MP, held on the 2nd July 2018. The forum was opened by opening statement by Congressman Pittinger and Han. Stephan Mayer who is the Parliamentary State Secretary of the German Federal Ministry of the Interior followed by Han. Volkmar Klein. There were six panels which I attended them all. The first panel was about the FlU perspective with regards to terrorism financing and tax evasion. The panel was addressed among other keynote speakers Bruno Kahl, President of the Federal Intelligence Service and Andreas Frank who is advisor to the Council of Europe for Anti Money Laundering Directive. -
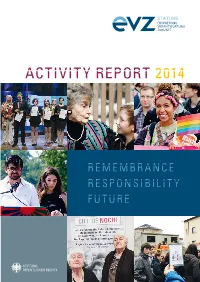
Activity Report 2014
ACTIVITY REPORT 2014 REMEMBRANCE RESPONSIBILITY FUTURE ACTIVITY REPORT 2014 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................. 6 GREETING ............................................................................................................................................................................................. 8 THE FOUNDATION EVZ .............................................................................................................................................................. 10 This report contains Fields of Activity ..................................................................................................................................................................................... 12 QR codes that can be What Was Funded .................................................................................................................................................................................. 14 scanned using a smartphone. These codes PHOTOGRAPHY COMPETITION ........................................................................................................................................... 16 are linked to additional information and/or films. FIELD OF ACTIVITY 1: THE CRITICAL EXAMINATION OF HISTORY ............................................................ 21 German Premiere for the Concert Drama Defiant Requiem in Berlin ........................................................... -

Using Diaries to Understand the Final Solution in Poland
Miranda Walston Witnessing Extermination: Using Diaries to Understand the Final Solution in Poland Honours Thesis By: Miranda Walston Supervisor: Dr. Lauren Rossi 1 Miranda Walston Introduction The Holocaust spanned multiple years and states, occurring in both German-occupied countries and those of their collaborators. But in no one state were the actions of the Holocaust felt more intensely than in Poland. It was in Poland that the Nazis constructed and ran their four death camps– Treblinka, Sobibor, Chelmno, and Belzec – and created combination camps that both concentrated people for labour, and exterminated them – Auschwitz and Majdanek.1 Chelmno was the first of the death camps, established in 1941, while Treblinka, Sobibor, and Belzec were created during Operation Reinhard in 1942.2 In Poland, the Nazis concentrated many of the Jews from countries they had conquered during the war. As the major killing centers of the “Final Solution” were located within Poland, when did people in Poland become aware of the level of death and destruction perpetrated by the Nazi regime? While scholars have attributed dates to the “Final Solution,” predominantly starting in 1942, when did the people of Poland notice the shift in the treatment of Jews from relocation towards physical elimination using gas chambers? Or did they remain unaware of such events? To answer these questions, I have researched the writings of various people who were in Poland at the time of the “Final Solution.” I am specifically addressing the information found in diaries and memoirs. Given language barriers, this thesis will focus only on diaries and memoirs that were written in English or later translated and published in English.3 This thesis addresses twenty diaries and memoirs from people who were living in Poland at the time of the “Final Solution.” Most of these diaries (fifteen of twenty) were written by members of the intelligentsia. -

Annual Report 2008 Genocide in Which Six Million European Jews Were Exter- Minated
We, women and men in public life, historians, intellectuals and people from all faiths, have come together to declare that the defence of values of justice and fraternity must overwhelm all obstacles to prevail over intolerance, racism and conflict. We say clearly that the Israelis and the Palestinians have a right to their own state, their own sovereignty and security and that any peace process with such aims must be supported. In the face of ignorance, prejudice and competing memories that we reject, we believe in the power of knowledge and the primacy of History. We there- fore affirm, beyond all political considerations, our deter- mination to defend historical truth, for no peace is built on lies.The Holocaust is a historical fact: the annual rePorT 2008 genocide in which six million European Jews were exter- minated. To deny this crime against humanity is not only an insult to the memory of the victims, but also an insult to the very idea of civilization. Hence, we believe that the teaching of this tragedy concerns all those who have at heart the will to prevent further genocides. The same requirement of truth calls on us to recall the actions of the Righteous in Europe and in the Arab and Muslim world. Together, we declare our common desire to promote a sincere dialogue, open and fraternal. It is in this spirit 10, avenue Percier that we have gathered around the Aladdin Project. We call 75008 Paris — France on all men and women of conscience around the Tel: +33 1 53 42 63 10 Fax: +33 1 53 42 63 11 world to work with us in this common endeavour www.fondationshoah.org of shared knowedge, mutual respect and peace. -

• Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin Detlef Schmiechen -Ackermann
Detlef Schmiechen-Ackermann Soziale Milieus, Politische Kultur und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland im regionalen Vergleich Gedenkstätte Deutscher Widerstand • Berlin Anpassung Verweigerung Widerstand Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Herausgegeben von • Peter Steinbach und Johannes Tuehel Detlef Schmiechen-Ackermann (Hrsg.) Anpassung Verweigerung Widerstand Soziale Milieus, Politische Kultur und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland im regionalen Vergleich Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Reihe A: Analysen und Darstellungen Herausgegeben von Peter Steinbach und Johannes Tuehel Band 3 Eine Buchhandelsausgabe dieses Werkes ist in der Edition Hentrich, Berlin, erschienen © 1997 Gedenkstätte Deutscher Widerstand Alle Rechte sind vorbehalten Jegliche Wiedergabe nur mit Genehmigung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Gestaltung Atelier Prof. Hans Peter Hoch, Baltmannsweiler Lithos Reprowerkstatt Rink, Berlin Druck Druckhaus Hentrich, Berlin Buchbinder Buchbinderei Heinz Stein, Berlin Printed in Germany 1. Auflage 1997 Inhaltsverzeichnis 8 Vorwort Peter Steinbach I. Einführende Beiträge 13 Detlef Schmiechen-Ackermann Soziale Milieus, Politische Kultur und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland 30 Gerhard Paul Zwischen Traditionsbildung und Wissenschaft. Tendenzen, Erträge und Desiderata der lokal- und regionalgeschichtlichen Widerstandsforschung 46 Franz Walter/Helge Matthiesen Milieus in der modernen deutschen Gesellschaftsgeschichte. Ergebnisse -

The Story of the Children of Bullenhuser Damm
The Children of Bullenhuser Damm association — The story 09.01.17, 1632 Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm e.V. / www.kinder-vom-bullenhuser-damm.de The story of the Children of Bullenhuser Damm In April 1945 the Allied armies have pressed far into National Socialist Germany. The outcome of the war has been decided long ago. But not until 8 May is a conditional surrender signed. Up to that point, those who are aware of the crimes they have perpetrated have been busily erasing as much evidence as possible. At this time, 20 Jewish children are living in Neuengamme Concentration Camp outside Hamburg. They are aged between five and 12 years. There are ten girls and ten boys, including two pairs of siblings. For months, the SS doctor Kurt Heißmeyer has been maltreating them as test objects for medical experiments: he has injected live tuberculosis bacilli under their skin and used probes to introduce them into the lungs. Then he has operatively removed their lymph glands. In an interrogation in 1964, Heißmeyer declared that for him “there is no diference in principal between Jews and laboratory animals”. © Silke Goes On 20 April 1945 the children, and four of the adult prisoners BACKGROUND who have been looking after them in the camp, are brought to International remembrance a large school building in Hamburg. It is almost midnight when The fate of the 20 children also preoccupies people in they arrive. The adults are the two French doctors, Gabriel other countries: Florence and René Quenouille, and the Dutchmen Dirk In 1996 a playground with a rose garden was laid out in Deutekom and Anton Hölzel. -

Holocaust Glossary
Holocaust Glossary A ● Allies: 26 nations led by Great Britain, the United States, and the Soviet Union that opposed Germany, Italy, and Japan (known as the Axis powers) in World War II. ● Antisemitism: Hostility toward or hatred of Jews as a religious or ethnic group, often accompanied by social, economic, or political discrimination. (USHMM) ● Appellplatz: German word for the roll call square where prisoners were forced to assemble. (USHMM) ● Arbeit Macht Frei: “Work makes you free” is emblazoned on the gates at Auschwitz and was intended to deceive prisoners about the camp’s function (Holocaust Museum Houston) ● Aryan: Term used in Nazi Germany to refer to non-Jewish and non-Gypsy Caucasians. Northern Europeans with especially “Nordic” features such as blonde hair and blue eyes were considered by so-called race scientists to be the most superior of Aryans, members of a “master race.” (USHMM) ● Auschwitz: The largest Nazi concentration camp/death camp complex, located 37 miles west of Krakow, Poland. The Auschwitz main camp (Auschwitz I) was established in 1940. In 1942, a killing center was established at Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II). In 1941, Auschwitz-Monowitz (Auschwitz III) was established as a forced-labor camp. More than 100 subcamps and labor detachments were administratively connected to Auschwitz III. (USHMM) Pictured right: Auschwitz I. B ● Babi Yar: A ravine near Kiev where almost 34,000 Jews were killed by German soldiers in two days in September 1941 (Holocaust Museum Houston) ● Barrack: The building in which camp prisoners lived. The material, size, and conditions of the structures varied from camp to camp. -

Wege Zum Weissbuch Wege Zum Weissbuch – Inhalt
WEGE ZUM WEISSBUCH WEGE ZUM WEISSBUCH – INHALT INHALT I. WEISSBUCH 2016 – EINE ZUSAMMENFASSUNG 5 II. IHR WEGWEISER DURCH DAS WEISSBUCH 15 III. DIE WEGE ZUM WEISSBUCH 19 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 30 IMPRESSUM 32 3 I. WEISSBUCH 2016 – EINE ZUSAMMENFASSUNG I. WEISSBUCH 2016 – EINE ZUSAMMENFASSUNG Teil I – Zur Sicherheitspolitik Das Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr ist das oberste sicherheitspolitische Grundlagendokument Deutschlands. Es nimmt eine auf Ebene der Bundesregierung beschlossene strategische Standort- und Kursbestimmung für die deut- sche Sicherheitspolitik vor. Damit ist es der wesentliche Leitfaden für die sicherheitspoli- tischen Entscheidungen und Handlungen unseres Landes. Das Weißbuch erscheint in einer Zeit, in der unterschiedlichste Herausforderungen in bislang nicht gekannter Gleichzeitigkeit und Dichte auf Deutschland einwirken. In die- sem tiefgreifend veränderten Sicherheitsumfeld ist die politische, wirtschaftliche und militärische Bedeutung Deutschlands weiter gestiegen. Aufgrund seines internationalen Gewichts verfügt Deutschland über gewachsene Handlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig steht unser Land in der Verantwortung, die globale Ordnung aktiv mitzugestalten. Unsere Verbündeten und Partner erwarten von Deutschland ein noch stärkeres Engagement in der internationalen Sicherheitspolitik. Deutschland ist sich dieser gewachsenen Verant- wortung für internationale Sicherheit und Stabilität bewusst und bereit, sich früh, ent- schieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte -

THE BULLENHUSER DAMM MEMORIAL a BRANCH of the NEUENGAMME CONCENTRATION CAMP MEMORIAL Opening Hours Contact Addresses
THE BULLENHUSER DAMM MEMORIAL A BRANCH OF THE NEUENGAMME CONCENTRATION CAMP MEMORIAL Opening hours Contact addresses THE BULLENHUSER DAMM MEMORIAL The Bullenhuser Damm Memorial is an important site of com- BULLENHUSER DAMM NEUENGAMME memoration and learning in Hamburg. It was established in MEMORIAL CONCENTRATION CAMP 1980 to commemorate the murders of 20 Jewish children and MEMORIAL 28 adults on 20 April 1945. Bullenhuser Damm 92 In November 1944, ten girls and ten boys aged between 5 20539 Hamburg Jean-Dolidier-Weg 75 and 12 were brought to the Neuengamme concentration camp Germany 21039 Hamburg from Auschwitz as subjects for medical experiments with (Rothenburgsort urban tuberculosis pathogens. In an attempt to erase the traces railway station) Phone: +49 40 428131-500 of their crimes, the SS took the children to the former school Fax: +49 40 428131-501 building on Bullenhuser Damm in the Hamburg borough of A Branch of the Neuengamme E-mail: info@kz-gedenkstaette- Rothenburgsort on 20 April 1945. Until a few days previously, Concentration Camp Memorial neuengamme.de the building had served as a satellite camp of the Neuengam- Website: www.kz-gedenkstaette- me concentration camp. On Bullenhuser Damm, the children OPENING HOURS neuengamme.de and four concentration camp prisoners who had looked after Sundays, 10 a.m. to 5 p.m. them were murdered by SS men. That same night, at least 24 and by prior arrangement. PUBLISHED BY Soviet prisoners whose identities have still not been estab- Admission is free. Neuengamme Concentration lished were hanged there as well. Camp Memorial, May 2013 After the war, this crime did not figure in the public con- GUIDED TOURS sciousness in Hamburg, even though former Neuengamme Please book guided tours and PHOTOGRAPHS BY prisoners did organise commemorative events for the murder- educational projects through Michael Kottmeier ed children. -

Treatment of Sick Prisoners Pen Drawing by Ragnar Sørensen, Date
Treatment of Sick Prisoners Pen drawing by Ragnar Sørensen, date unknown. Ragnar Sørensen, a former prisoner from Norway, was imprisoned in Neuengamme in March/April 1945. (MDF) Lab Records The sick-bay’s lab records are among the few original documents from Neuengamme concentration camp that remain today. They contain around 17,900 entries dated between May 1941 and May 1944. Examinations of urine and sputum as well as blood sedimentation tests were already routine procedures at the time, whereas blood group tests and examinations of faeces were more demanding, both for the lab’s equipment and the lab staff. A striking feature of these records are the many cases of active tuberculosis. Replica. (ANg) X-Ray Photograph of a TBC Experiment In 1944/45, SS physician Dr. Kurt Heißmeyer carried out experiments with tubercle bacilli at Neuengamme concentration camp, at first on up to 100 men and later on 20 Jewish children between the ages of five and twelve. For most of Heißmeyer’s subjects, these experiments resulted in severe permanent damage to their health, and for many of them they proved fatal. On 11 October 1944, Heißmeyer used a probe to inject tubercle bacilli into the lungs of 21- year-old Soviet prisoner Ivan Churkin (see photograph). On 9 November 1944, he had Churkin hanged so he could dissect his body and analyse the results. (ANg) Collage Made up of Five Photographs Photographs of five of the 20 Jewish children who were brought to Neuengamme from Auschwitz concentration camp in November 1944 to be used as subjects for Heißmeyer’s medical experiments.