It's Funny, Cause It's True
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
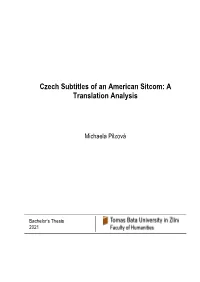
Czech Subtitles of an American Sitcom: a Translation Analysis
Czech Subtitles of an American Sitcom: A Translation Analysis Michaela Pilzová Bachelor’s Thesis 2021 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá překladem titulků audiovizuálních programů, konkrétně sitcomu Taková moderní rodinka. Práce se zaměřuje na tři aspekty, které můžou být problematické kvůli své kulturní specifičnosti, a těmi jsou idiomy, slovní hříčky a kulturní reference. Všechny z nich mohou být matoucí a nepochopené. Cílem této práce je popsat tyto kulturně specifické jevy a definovat metody jejich překladu, aby se shodovaly s tím, co je cílové kultuře známé. Teoretická část této práce popisuje překlad, jeho jednotlivé typy a metody pro vyřešení neekvivalentnosti. Práce také rozebírá titulky, jejich úskalí a požadavky na ně. Analytická část se skládá z popisu analyzovaného sitcomu a komentovaných příkladů slovních hříček, idiomů, kulturních referencí a slangových výrazů. Klíčová slova: audiovizuální překlad, titulky, sitcom, idiomy, slovní hříčky, kulturní reference, humor ABSTRACT This Bachelor Thesis deals with translating subtitles of audiovisual programmes, specifically the sitcom Modern Family. It focuses on three aspects that tend to cause problems in translation due to their cultural specificity, and those are idioms, puns and cultural references. All of them can be confusing and might not be understood. The aim of this thesis is to describe those culturally specific areas and define the methods for their translation to fit the knowledge of the target audience. The theoretical part of this paper describes translation, its different types and methods to deal with non-equivalence. It also discusses subtitling and its challenges and requirements. The analytical part consists of a description of the sitcom and commented examples to puns, idioms, cultural references and slang expressions. -

Modern Family Season 1X01 Page.1 - You Saw That, Right? Everybody Fawning Over Lily, and Then You - His Name Is Dylan
Modern family - We're very different. Jay's from the city. He has a big business. I come from a small village, very poor but very, very beautiful. It's the 1X01 Pilot number-one village in all Colombia for all the... What's the word? - Murders. - Kids! Breakfast! Kids? Phil, would you get them? - Yes, the murders. - Yeah. Just a sec. - Manny, stop him! You can do it! - Kids! - Damn it, Manny! - That is so... - Come on, coach! You got to take that kid out! - Okay. - You want to take him out? How about I take you out? - Kids?! Get down here! - Honey, honey. - Why are you guys yelling at us when we're way upstairs? Just text - Why don't you worry about your son? He spend the first half with me. his hand in his pants! - That's not gonna happen. And you're not wearing that outfit. - I've wanted to tell her off for the last six weeks. I'm Josh. Ryan's dad. - What's wrong with it? - Hi. I'm Gloria Pritchett, Manny's mother. - Honey, do you have anything to say to your daughter about her - And this must be your dad. skirt? - Her dad? That's funny. Actually, no, I'm her husband. Don't be - Sorry. That looks really cute, sweetheart. fooled by the... Give me a second here. - It's way too short. People know you're a girl. You don't need to - Who's a good girl? Who's that? Who's that? prove it. - She's adorable! Hi, precious. -

Modern Family
Reference Data: Forster, D. (2013). Authentic English through Modern Family. In N. Sonda & A. Krause (Eds.), JALT2012 Authentic Conference Proceedings. Tokyo: JALT. The benefits of using television shows and films in the EFL classroom have been thoroughly researched English and documented, and they have proven to be an effective learning tool. Particularly in the Japanese EFL context, using a situation comedy motivates students because they enjoy seeing, hearing, and using the language they learn. This paper shows how the popular American sitcom Modern Family can enhance EFL instruction through its up-to-date cultural themes and stereotypes and through its lively use of lan- Through guage, especially slang and idiomatic expressions. The course summary, syllabus, lessons, and testing and evaluation information are provided. Modern 教室外での英語接触量が限られる日本人EFL学習者に、いかに「自然な会話」を教えるかは難しい問題である。そこで、授業 に自然な会話を取り入れる容易な方法として、テレビ番組の活用が挙げられる。テレビ番組の会話は、多くのEFL教科書にある ような「作られた」会話よりも優れた教材と言える。従来の研究においても、EFL授業におけるビデオ使用の効果が調査され、 その有効性が実証されてきた。特に、日本のEFL環境においては、見る、聞く、さらに学んだ表現を使うといった楽しみが得ら Family れるシチュエーション・コメディの活用は、学習者の意欲を高めることにつながる。本研究では、アメリカの人気シチュエーショ ン・コメディであるModern Familyを取り上げ、最新の文化的題材や語彙を扱いながら、いかにしてより良いEFL教育が行える かを論じる。コースの概要、シラバス、授業内容、試験、評価方法を提示する。 Douglas E. Forster Japan Women’s University OR THE past 5 years, I have been teaching a North American Studies seminar class at Japan Women’s University in Tokyo. The goal of the course is to increase students’ F knowledge and awareness of American culture and increase their vocabulary, particu- larly slang and idiomatic expressions. In the past, I have chosen Hollywood movies due to their popular appeal and their ability to reflect American culture and modern spoken English. Two years ago, I decided to use American situation comedies, such as Seinfeld, because they of- fer an interesting, and funny, array of characters, social situations, and slang and idioms. -

An Analysis of Puns Translated for the Polish Voiced-Over Version of the American TV Series Modern Family
University of Amsterdam Graduate School of Humanities MA program in Linguistic: Translation An analysis of puns translated for the Polish voiced-over version of the American TV series Modern Family. Aleksandra Slawuta Student number: 11107448 Supervisor: dhr. dr. Eric Metz Amsterdam 2017 1 Abstract This paper covers the subject of translatability of humor in audiovisual translation. Humor is always difficult to translate not only because of the possible cultural differences between the speakers of a source and target languages but also because everyone has different taste and is laughing at different jokes. This corpus-based thesis is analyzing the specific kind of jokes: puns. They are very language-specific, therefore difficult to translate. Nonetheless, there are certain strategies used to convey the humorous effect to other language. In this paper I am analyzing 80 puns found in the first and second season of the American TV series Modern Family and their Polish equivalents from the voiced-over translation. Basing on the theories coined by Hausmann, Delabastita, Newmark and Nash I am aiming to determine whether translation strategies used to translate puns manage to deliver funny rendering in the target language (Polish). Moreover, I am investing the possible reasons why, in many cases, the translation did not deliver a funny rendering. 2 Table of contents List of figures ................................................................................................................................ 5 1. Introduction ............................................................................................................................ -

1 Guide to the Sydney Corpus of Television Dialogue (Sydtv) 1
Guide to the Sydney Corpus of Television Dialogue (SydTV) Please cite as: Bednarek, M. 2018 [last updated April 2019]. Guide to the Sydney Corpus of Television Dialogue (SydTV). Available at www.syd-tv.com, ACCESS DATE. 1. Preface The Sydney Corpus of Television Dialogue (SydTV) is a new, carefully designed dataset of TV dialogue. SydTV is a small, specialised corpus (~275,000 words), representative of the language variety of contemporary US TV dialogue. TV dialogue is here defined as the dialogue uttered by actors on screen as they are performing characters in fictional TV series, and does not include screen directions, etc. This manual reports on the construction of the corpus. SydTV could not have been built without School and Faculty funding provided by the University of Sydney. I want to thank the research assistants who helped with building the corpus over several years: Cassandra Liardét (née Fawcett), David Lesslie, Samuel Luke, Ganna Veselovska, and Charlie Revett. For help with making the corpus available to others through the CQPweb user interface, I am very grateful to Chao Sun, Andrew Hardie, and Andressa Rodrigues Gomide. For information on the CQPweb version, see section 5 below. Information on access to the corpus is provided at the companion website www.syd-tv.com, which also lists the publications that have drawn on the corpus. Frequency and keyness lists are also available for download on this website. Use of SydTV by other researchers is subject to the following conditions: 1. Access is only granted for the purposes of research or scholarship; 2. The corpus cannot be distributed to others; 3. -

An Analysis of Femininity : How Popular Female Characters in the Media
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2013 An analysis of femininity : how popular female characters in the media portray contemporary womanhood Stephanie Ortego Roussell Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the Mass Communication Commons Recommended Citation Roussell, Stephanie Ortego, "An analysis of femininity : how popular female characters in the media portray contemporary womanhood" (2013). LSU Master's Theses. 3089. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/3089 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. AN ANALYSIS OF FEMININITY: HOW POPULAR FEMALE CHARACTERS IN THE MEDIA PORTRAY CONTEMPORARY WOMANHOOD A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Mass Communication in The Manship School of Mass Communication by Stephanie Ortego Roussell B.S., Louisiana State University, May 2007 May 2013 ACKNOWLEDGEMENTS I would first like to thank Dr. Lisa Lundy, my committee chair, mentor and friend throughout my time here at LSU. Her guidance and support is invaluable and appreciated beyond measure. I would also like to thank Dr. Felicia Song and Dr. Jinx Broussard for their guidance and mentorship not only during this process, but also in the classroom. -

The Popular Culture Studies Journal
THE POPULAR CULTURE STUDIES JOURNAL VOLUME 3 NUMBERS 1 & 2 2015 Editor BOB BATCHELOR Miami University Associate Editors KATHLEEN TURNER NORMA JONES Aurora University Kent State University Reviews Editor JENNIFER C. DUNN Dominican University Assistant Reviews Editor SAMANTHA LATHAM Independent Scholar Please visit the PCSJ at: http://mpcaaca.org/the-popular-culture-studies-journal/ The Popular Culture Studies Journal is the official journal of the Midwest Popular and American Culture Association. Copyright © 2015 Midwest Popular and American Culture Association. All rights reserved. Cover photo credits Cover Artwork: "I Selfie, Therefore I Am" by Brent Jones © 2015 The Thinker, Main: Public Domain "The Thinker, Auguste Rodin" by Karora The Thinker Phone: Creative Commons "Wikimania15 Dschwen (77)" by Daniel Schwen under CC BY 3.0 Selfie Stick: "Casual man using a selfie stick shot in studio" by Wavebreakmedia licensed by PhotoDune EDITORIAL ADVISORY BOARD ANTHONY ADAH JUSTIN GARCIA Minnesota State University, Moorhead Millersville University AARON BARLOW ART HERBIG New York City College of Technology (CUNY) Indiana University - Faculty Editor, Academe, the magazine of the AAUP Purdue University, Fort Wayne JOSEF BENSON ANDREW F. HERRMANN University of Wisconsin Parkside East Tennessee State University PAUL BOOTH JARED JOHNSON DePaul University Thiel College GARY BURNS JESSE KAVADLO Northern Illinois University Maryville University of St. Louis KELLI S. BURNS KATHLEEN A. KENNEDY University of South Florida Missouri State University ANNE M. CANAVAN WILLIAM KIST Emporia State University Kent State University ERIN MAE CLARK LARRY Z. LESLIE Saint Mary’s University of Minnesota University of South Florida BRIAN COGAN MATTHEW MIHALKA Molloy College University of Arkansas - Fayetteville ASHLEY M. -

Professor : Robert Bianchi Time : Wednesday 13:30-15:00 Topic
◯ Professor : Robert Bianchi ◯ Time : Wednesday 13:30-15:00 ◯ Topic : Modern Family and American T.V Shows 1 week "Pilot" & "The Bicycle Thief" September 17-21 2 week "Come Fly with Me" & "The Incident" September 24-28 3 week "Coal Digger" & "Run for Your Wife" October 1-5 4 week "En Garde" & "Great Expectations" October 8-12 5 week "Fizbo" & "Undeck the Halls” October 15-19 6 week "Up All Night" & "Not in My House" October 22-26 7 week October 29 "Fifteen Percent" & "Moon Landing" -November 2 8 week "My Funky Valentine" & "Fears" November 5-9 9 week "Truth Be Told" & "Starry Night" November 12-16 10 week "Game Changer" & "Benched" November 19-23 11 week "Travels with Scout" & "Hawaii" November 26-30 ◯ Professor : Robert Bianchi ◯ Time : Thursday 13:30-15:00 ◯ Topic : News, Media and Current events (BBC) 1 week Most famous news and media groups September 17-21 2 week Current events in England September 24-28 3 week Positive news stories from around the world October 1-5 4 week News and Technology/Business October 8-12 5 week Current Events in Korea October 15-19 6 week News and sports October 22-26 7 week Current Events in the U.S October 29 -November 2 8 week News and charity November 5-9 9 week News from around the world November 12-16 10 week News and the Environment November 19-23 11 week Media and Movies November 26-30 ◯ Professor : Heath Chambless ◯ Time : Monday 15:00-16:30 ◯ Topic : TOEIC SPEAKING LOWER INTERMEDIATE Talk about outline/structure of speaking test. -

Sitcom, Crisis Y Sociedad Norteamericana: Análisis De La Ficción Televisiva Estadounidense Desde Los Años 80 Hasta La Actualidad
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació Programa de Doctorado en Comunicación Sitcom, crisis y sociedad norteamericana: análisis de la ficción televisiva estadounidense desde los años 80 hasta la actualidad TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR: Paloma Corpas Culebras DIRIGIDA POR: Dr. Manuel de la Fuente Soler VALENCIA, ENERO 2017 ÍNDICE 0. Agradecimientos…………………………………………………………………...….7 1. Introducción…………………………………………………………………………...9 1.1. Hipótesis………………………………………………………………………....………..10 1.2. Objetivos………………………………………………………………………………….12 1.3. Justificación………………………………………………………………………….........13 2. Metodología…………………………………………………………………..……...15 3. La sitcom clásica y contemporánea: definiciones y características…………………...17 3.1. Profundizando en la sitcom: comparativa y problematización de su significado…….….....25 3.2. Naturaleza y funciones del humor en la comedia de situación……………………….........43 3.2.1. Teorías clásicas del humor: teoría de la superioridad, teoría del alivio y teoría de la incongruencia………………………………………………………………........……………46 3.2.2. Tipos de humor: clasificación, significados y funciones……………………………..........…47 4. Origen de las sitcoms……………………..………………………………...………...49 4.1. Aparición de las primeras sitcoms……………………………………………………....…50 4.2. McCarthy y el comunismo: el uso de Hollywood como advertencia anticomunista…..…..52 4.3. La comercialización de la televisión y sus funciones respecto a la sociedad de masas.........58 4.3.1. La televisión como herramienta política y la fiebre del American dream: venta de un espejismo……………………………………………………………………………………...59 4.3.2. La televisión como principal causante de las necesidades de consumo……………………….72 4.3.3. La televisión como medio de control ideológico sobre las mayorías silenciosas…………......77 5. Prosperidad y decadencia de la sitcom: la técnica de la hibridación como muerte y resurrección del formato……………………………………………………………..81 3 6. -

Literacy and Identity in Popular and Participatory Culture
University of Louisville ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository Electronic Theses and Dissertations 5-2013 Literacy and identity in popular and participatory culture. Laura A. Detmering University of Louisville Follow this and additional works at: https://ir.library.louisville.edu/etd Recommended Citation Detmering, Laura A., "Literacy and identity in popular and participatory culture." (2013). Electronic Theses and Dissertations. Paper 340. https://doi.org/10.18297/etd/340 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. This title appears here courtesy of the author, who has retained all other copyrights. For more information, please contact [email protected]. LITERACY AND IDENTITY IN POPULAR AND PARTICIPATORY CULTURE By Laura A. Detmering B.A., Northern Kentucky University M.A., Ohio University A bissertation Submitted to the Faculty of the College of Arts and Sciences of the University of Louisville in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of English University of Louisville Louisville, Kentucky May 2013 LITERACY AND IDENTITY IN POPULAR AND PARTICIPATORY CULTURE By Laura A. Detmering B.A., Northern Kentucky University, 2003 M.A., Ohio University, 2006 A Dissertation Approved on December 3, 2012 by the following Dissertation Committee Bronwyn T. Williams, Dissertation Director Karen Kopelson Debra Journet John Alberti Dennis Hall ii for Matt the greatest Phil Dunphy fan I ever knew III ACKNOWLEDGEMENTS First, I would like to thank my director Dr. -
“This Is Exactly Why We Sweep Things Under the Rug:” a Polite Approach to ABC's Modern Family Presented to the Faculty
“This is exactly why we sweep things under the rug:” A Polite approach to ABC’s Modern Family Presented to the Faculty Liberty University School of Communication Studies In Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Arts Communication Studies By Andrea D. Fasciano December 2013 Fasciano 2 Thesis Committee _________________________________________________________________________ Faith E. Mullen, Ph.D., Chair Date _________________________________________________________________________ Lynnda S. Beavers, Ph.D. Date _________________________________________________________________________ William L. Mullen, Ph.D. Date Fasciano 3 Copyright © 2013 Andrea Fasciano All Rights Reserved Fasciano 4 This is dedicated to: Janette, who always believed Wavi, who offered to collect my tears when I doubted Adrian and Owen, who hold my heart Nancy, what’s wrong? Fasciano 5 Acknowledgements This thesis would not have been written without the guidance and support of my committee. Dr. Faith Mullen taught me the love of communication theory, Dr. Lynnda Beavers taught me to see it everywhere, and Dr. Bill Mullen taught me its scholarly pursuit. The Lacy family provided me with a roof over my head and so very much more. I wish to thank Timothy and Stephanie for stretching me and putting up with a very preoccupied babysitter. I promise to pay better attention to you now that this is complete. My dear friends, Janette and Wavi listened patiently while I laid out countless “worst case scenario” plans, and always knew they would never be implemented. I found so many friends in the desks around me. Their support and criticism throughout my program has made me a better scholar and person. I will always look fondly on our time learning together. -

'Send in the (Gay) Clowns': Will & Grace and Modern Family As
Jacques Rothmann ‘Send in the (gay) clowns’: Will & Grace and Modern Family as ‘sensibly queer’1 First submission: 29 November 2012 Acceptance: 20 August 2013 Initial representation of sexual minorities reified gay lifestyle as synonymous with deviancy (Seidman 1996: 6), courtesy of news programmes or documentaries. Several depictions, whether comical or dramatic, led to an outcry from conservative and gay groups alike, protesting the stereotypical depiction of gay men as “a joke” (Burgess 2011: 178), a theme which would continue until the present day. This article provides a queer theoretical critique of two situation comedies, Will & Grace (Kohan & Mutchnick 1998) and Modern Family (Levitan & Lloyd 2009a), and their representation of gay men. Primary emphasis is placed on the dualistic use of comedic satire to either reinforce heteronormativity or exemplify the permeable nature of the supposed rigidity of the heterosexual/homosexual binary logic (Fuss 1991; Namaste 1996). Mr Jacques Rothmann, Edu-HRight Research Unit, Sociology, Faculty of Arts, North- West University Potchefstroom campus. E-mail address: [email protected] 1 ‘Send in the clowns’ is the title to one of the songs from Broadway lyricist Stephen Sondheim’s A little night music. Acta Academica 2013 45(4): 40-83 ISSN 0587-2405 © UV/UFS <http://www.ufs.ac.za/ActaAcademica> Rothmann/’Send in the (gay) clowns’ llen DeGeneres paved the way for representation of sexual minorities on television, in general, and in the US, in particular, Ewhen she became the first lesbian character on prime-time television to “come out” in the series Ellen (1994-1998) (Moore 2008: 19). Originally depicted as uninterested in dating of any kind, a producer of the show recommended that she should get a puppy, and as result the ‘coming out’ episode was titled ‘The puppy episode’ (Meem et al.