Download Des Heftes Als
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Variational Text Linguistics: Revisiting Register in English
Christoph Schubert and Christina Sanchez-Stockhammer (Eds.) Variational Text Linguistics Topics in English Linguistics Editors Elizabeth Closs Traugott Bernd Kortmann Volume 90 Variational Text Linguistics Revisiting Register in English Edited by Christoph Schubert Christina Sanchez-Stockhammer ISBN 978-3-11-044310-3 e-ISBN (PDF) 978-3-11-044355-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-043533-7 ISSN 1434-3452 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Brian Stablyk/Photographer’s Choice RF/Getty Images Typesetting: fidus Publikations-Service GmbH, Nördlingen Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Acknowledgements The foundations for this edited collection of articles were laid at the interna- tional conference Register revisited: New perspectives on functional text variety in English, which took place at the University of Vechta, Germany, from June 27 to 29, 2013. The aim of the present volume is to conserve the research papers and many inspiring discussions which were stimulated then and to make them available to a larger audience. It was only possible to achieve this aim thanks to the help of many people joining us in the effort. First and foremost, we would like to thank all contributors for their continued cooperation in this project. -

Mitgliedschaft Des Landkreises Cloppenburg in Gesellschaften, Körperschaften, Verbänden Und Vereinen
Kreisrecht Mitgliedschaft des Landkreises Cloppenburg in Gesellschaften, Körperschaften, Verbänden und Vereinen Lfd. Nr. Bezeichnung Amt 1 Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Nieder- 50 sachsen und Bremen (AGJÄ) 2 Arbeitsgemeinschaft Peripherer Regionen Deutschlands WI (APER) 3 Bezirksverband Oldenburg 10 4 Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen WI (BAG-LEADER) 5 Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 10 (vhw) 6 Caritas Verein Altenoythe 50 7 c-Port Hafenbesitz GmbH 20 8 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 50 9 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 51 (DIJuF) 10 Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik 10 11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 70 Abfall e.V. (DWA) 12 Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 20 13 Energienetzwerk Nordwest (ENNW) 40 14 Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V. 20 15 FHWT Vechta-Diepholz-Oldenburg, Private Fachhochschule WI für Wirtschaft und Technik 16 Förder- und Freundeskreis psychisch Kranker im Landkreis 53 Cloppenburg e.V. 17 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) 10 18 Gemeinsame Einrichtung gemäß § 44 b SGB II (Jobcenter) 50 19 Gemeinschaft DAS OLDENBURGER LAND WI 19 Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus 20 Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH (GEA) 20 Großleitstelle Oldenburger Land 32 21 Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. 67 22 GVV Kommunalversicherung VVaG 10 23 Heimatbund für das Oldenburger Münsterland e.V. 40 24 Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V. 40 25 Interessengemeinschaft „Deutsche Fehnroute e.V.“ WI 26 Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) 10 27 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage- 10 ment (KGSt) 28 Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. 10 (KAV) 29 Kommunaler Schadenausgleich Hannover (KSA) 20 30 Kreisbildungswerk Cloppenburg – Volkshochschule für den 40 Landkreis Cloppenburg e.V. -

Pastports, Vol. 3, No. 8 (August 2010). News and Tips from the Special Collections Department, St. Louis County Library
NEWS AND TIPS FROM THE ST. LOUIS COUNTY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT VOL. 3, No. 8—AUGUST 2010 PastPorts is a monthly publication of the Special Collections Department FOR THE RECORDS located on Tier 5 at the St. Louis County Library Ortssippenbücher and other locale–specific Headquarters, 1640 S. Lindbergh in St. Louis sources are rich in genealogical data County, across the street Numerous rich sources for German genealogy are published in German-speaking from Plaza Frontenac. countries. Chief among them are Ortssippenbücher (OSBs), also known as Ortsfamilienbücher, Familienbücher, Dorfsippenbücher and Sippenbücher. CONTACT US Literally translated, these terms mean “local clan books” (Sippe means “clan”) or To subscribe, unsubscribe, “family books.” OSBs are the published results of indexing and abstracting change email addresses, projects usually done by genealogical and historical societies. make a comment or ask An OSB focuses on a local village or grouping of villages within an ecclesiastical a question, contact the parish or administrative district. Genealogical information is abstracted from local Department as follows: church and civil records and commonly presented as one might find on a family group sheet. Compilers usually assign a unique numerical code to each individual BY MAIL for cross–referencing purposes (OSBs for neighboring communities can also reference each other). Genealogical information usually follows a standard format 1640 S. Lindbergh Blvd. using common symbols and abbreviations, making it possible to decipher entries St. Louis, MO 63131 without an extensive knowledge of German. A list of symbols and abbreviations used in OSBs and other German genealogical sources is on page 10. BY PHONE 314–994–3300, ext. -
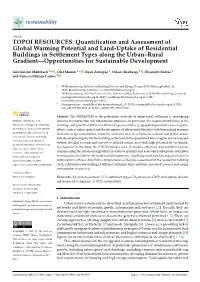
Quantification and Assessment of Global Warming Potential
sustainability Article TOPOI RESOURCES: Quantification and Assessment of Global Warming Potential and Land-Uptake of Residential Buildings in Settlement Types along the Urban–Rural Gradient—Opportunities for Sustainable Development Ann-Kristin Mühlbach 1,* , Olaf Mumm 2,* , Ryan Zeringue 2, Oskars Redbergs 2 , Elisabeth Endres 1 and Vanessa Miriam Carlow 2 1 TU Braunschweig, Institute for Building Services and Energy Design (IGS), Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunschweig, Germany; [email protected] 2 TU Braunschweig, Institute for Sustainable Urbanism (ISU), Pockelsstr. 3, 38106 Braunschweig, Germany; [email protected] (R.Z.); [email protected] (O.R.); [email protected] (V.M.C.) * Correspondence: [email protected] (A.-K.M.); [email protected] (O.M.); Tel.: +49-531-391-3524 (A.-K.M.); +49-531-391-3537 (O.M.) Abstract: The METAPOLIS as the polycentric network of urban–rural settlement is undergoing Citation: Mühlbach, A.-K.; constant transformation and urbanization processes. In particular, the associated imbalance of the Mumm, O.; Zeringue, R.; Redbergs, shrinkage and growth of different settlement types in relative geographical proximity causes negative O.; Endres, E.; Carlow, V.M. TOPOI effects, such as urban sprawl and the divergence of urban–rural lifestyles with their related resource, RESOURCES: Quantification and land and energy consumption. Implicitly related to these developments, national and global sustain- Assessment of Global Warming able development goals for the building sector lead to the question of how a region can be assessed Potential and Land-Uptake of without detailed research and surveys to identify critical areas with high potential for sustainable Residential Buildings in Settlement development. -

The Spatial and Temporal Diffusion of Agricultural Land Prices
The Spatial and Temporal Diffusion of Agricultural Land Prices M. Ritter; X. Yang; M. Odening Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Agricultural Economics, Germany Corresponding author email: [email protected] Abstract: In the last decade, many parts of the world experienced severe increases in agricultural land prices. This price surge, however, did not take place evenly in space and time. To better understand the spatial and temporal behavior of land prices, we employ a price diffusion model that combines features of market integration models and spatial econometric models. An application of this model to farmland prices in Germany shows that prices on a county-level are cointegrated. Apart from convergence towards a long- run equilibrium, we find that price transmission also proceeds through short-term adjustments caused by neighboring regions. Acknowledegment: Financial support from the China Scholarship Council (CSC NO.201406990006) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) through Research Unit 2569 “Agricultural Land Markets – Efficiency and Regulation” is gratefully acknowledged. The authors also thank Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Niedersachsen (P. Ache) for providing the data used in the analysis. JEL Codes: Q11, C23 #117 The Spatial and Temporal Diffusion of Agricultural Land Prices Abstract In the last decade, many parts of the world experienced severe increases in agricultural land prices. This price surge, however, did not take place evenly in space and time. To better understand the spatial and temporal behavior of land prices, we employ a price diffusion model that combines features of market integration models and spatial econometric models. An application of this model to farmland prices in Germany shows that prices on a county-level are cointegrated. -

Grundwasserschutzberatung in Der Zielkulisse Der EG-Wasserrahmenrichtlinie Für Die Beratungsgebiete Mittlere Ems/Vechte Und
Gewässerschutzberatung im Beratungsgebiet Hunte, März 2020 Kurzinformation der WRRL-Gewässerschutzberatung Gewässerschutzberatung in der WRRL-Zielkulisse Im letzten Jahr erfolgte die Neuausschreibung der Bera- tungsleistungen in den WRRL-Zielkulissen. Die bestehen- den Zielkulissen/ Beratungsgebiete wurden z.T. erweitert o- der neu zugeschnitten/ benannt. Darüber hinaus sind neue Gebiete dazugekommen (siehe www.lwk-niedersach- sen.de, webcode: 01021537). Die LWK Niedersachsen berät in den Zielkulissen Hunte, Leda-Jümme, Ems/ Hase und Hase. Die letzten drei ge- nannten Kulissen umfassen Teile der ehemals durch die LWK beratenen Gebiete Mittlere Ems Süd und Mittlere Ems Nord. Das Beratungsgebiet Hunte (siehe Karte) erstreckt sich im Wesentlichen über Teile der Landkreise Oldenburg, Diepholz, Vechta und Wesermarsch. Agrarumweltmaßnahmen 2020 In 2020 werden ausschließlich die nachfolgend aufgeführten Agrarumweltmaßnahmen ange- boten. Der Antrag auf entsprechende Förderung ist mit dem Sammelantrag (ANDI) bis spä- testens zum 15.05.2020 einzureichen. BV 1: Ökologischer Landbau (Grundförderung) BS 1: einjährige Blühstreifen BS 2: mehrjährige Blühstreifen BS 7: Erosions- / Gewässerschutzstreifen BS 8/ 9: Erosionsschutz-/ Vogelschutzhecke GL 1 bis GL 5: Grünlandmaßnahmen (Ausnahme GL 4, diese gilt nur für Bremer Antragsteller) Der Abschluss weiterer Agrarumweltmaßnahmen, z.B. AL 2 (Zwischenfruchtanbau), BV 2 (emissionsarme Gülleausbringung), ist in 2020 nicht möglich. Nährstoffsituation im Gebiet Hunte Anfang März 2020 wurde der Nährstoffbericht für Niedersachsen 2018/ 2019 veröffentlicht. Der Betrachtungsraum umfasst den Meldezeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019. Die Stickstoffaufbringung aus organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln pro Hektar liegt gemäß Nährstoffbericht in den im Gebiet Hunte befindlichen Landkreisen (LK, im Wesentlichen Oldenburg, Diepholz, Vechta und Wesermarsch) im Bereich zwischen 144 kg N/ha (LK DH) und 180 kg N/ha (LK VEC). -

Courses in English
English Course Offer for International Students Overview 04 Why Vechta 05 Why University of Vechta 06 English courses - Summer Term 2019 English Studies Educational Sciences Gerontology Cultural Studies Management of Social Services Electives Social Work Social Sciences Business Ethics/ Social Business 10 Social Work and Gerontology 12 Teacher Education Programme 14 Certificate of International Management and Practical Ethics (CIME) 18 Services 19 Notes & Ideas 20 Contact Why Vechta Vechta is rural but central. Close to Bremen, Oldenburg and Osnabrück, nature and city live can be enjoyed. The district is one of the economically strongest in northwestern Germany. As a rural area with several world market leaders in agriculture and as a centre of European plastics technology, it is very active on the international market. Vechta is perfect for cycling because of its flat landscape and short distances. Vechta is versatile from beautiful nature parks and horse auctions to a lively pub scene and cultural programmes. Vechta is famous for its fifth season. The Stoppelmarkt Fair is one of the largest folk festivals in northern Germany. It is celebrated for six days. Experience Vechta! 04 Why University of Vechta Cosmopolitan, personal, familial- the University of Vechta is a youthful, modern campus university with excellent conditions for studying. While studying at the University of Vechta, it is easy to get in contact and exchange with the professors and other students. For the 5000 students and 400-odd staff, the campus offers a familial atmosphere conveniently coupled with the infrastructure of a modern university. Attractive, forward-looking courses, personal support and global exchange programs are the features of Vechta’s high quality degree programme. -

Livestock Farming at the Expense of Water Resources? the Water–Energy–Food Nexus in Regions with Intensive Livestock Farming
water Article Livestock Farming at the Expense of Water Resources? The Water–Energy–Food Nexus in Regions with Intensive Livestock Farming Colette S. Vogeler 1,* , Malte Möck 1 , Nils C. Bandelow 1 and Boris Schröder 2,3 1 Comparative Politics and Public Policy, TU Braunschweig, 38106 Braunschweig, Germany; [email protected] (M.M.); [email protected] (N.C.B.) 2 Landscape Ecology and Environmental Systems Analysis, Institute of Geoecology, Technische Universität Braunschweig, 38106 Braunschweig, Germany; [email protected] 3 Berlin-Brandenburg Institute of Advanced Biodiversity Research (BBIB), 14195 Berlin, Germany * Correspondence: [email protected] Received: 9 September 2019; Accepted: 3 November 2019; Published: 7 November 2019 Abstract: Policymaking in the water–energy–food nexus is characterized by complex ecological, social, and economic interdependencies. Nexus research assumes these interactions to be overseen in the respective resource governance resulting in sectoral perspectives contributing to unsustainable outcomes. In Germany, the political priority given to the formation of an internationally competitive livestock sector by means of intensification, specialization and regional concentration has exerted sustained pressure on water and soil resources. The expansion of bioenergy plants promoted by the renewable energy act has exacerbated the situation. Despite the persistency of the ecological challenges, German policymakers only reacted when the European Commission referred Germany to the European Court of Justice. Current policy efforts to tackle the ecological problems are now provoking disruptions in the agrarian sector in regions with high nitrate concentrations in water resources. By combining the social-ecological systems framework with hypotheses derived from nexus research, we explore the interactions between food, water and energy systems and aim at understanding the unsustainable outcomes. -

Tätigkeitsbericht 2010
Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten Universität Vechta Mitteilungen - Heft 75 Tätigkeitsbericht 2010 Vechta, Februar 2010 ISPA 2 Tätigkeitsbericht 2010 Herausgeberin Prof. Dr. Martina Flath Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (ISPA) | Universität Vechta Driverstraße 22 | Postfach 1553 | D-49377 Vechta Internet: http://www.ispa.uni-vechta.de/ Redaktion Maria Wegehöft Telefon: 04441-15332 Telefax: 04441-15445 E-Mail: mwegehö[email protected] ISSN: 0938-8567 Alle Rechte vorbehalten Nachdruck nur mit Genehmigung der Herausgeberin Vechta, Februar 2010 1. Auflage Tätigkeitsbericht 2010 3 Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten Tätigkeitsbericht 2010 4 Tätigkeitsbericht 2010 Vorwort Das Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (ISPA) legt hiermit seinen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 vor. Personalia: Die Personalstruktur hat sich im Berichtszeitraum folgender Maßen verändert: Frau Prof. Dr. Gabriele Broll ist zum 01.04.2010 an die Universität Osnabrück versetzt worden. http.//www.geographie.uni-osnabrueck.de/index.php Frau Sylvia Warnecke, die auch weiterhin im FAEN-Teilprojekt 6 arbeitet, ist ebenfalls seit dem 01.04.2010 an der Universität Osnabrück tätig. Im SS 2010 wurde die Professur Physische Geographie/Agrarökologie von Herrn Prof. Dr. Bodo Damm vertreten. Bis zum 30.04.2010 war Frau Dr. Barbara Grabkowsky am ISPA tätig und hat zum 01.05.2010 eine Stelle in der Wirtschaft angenommen. Ihre Projektstelle wurde zum 01.09.2010 mit Frau Dipl.-Umweltwiss. Anna Wilke wieder besetzt. Herrn Dipl.-Geogr. Max Gerling hat zum 30.6.2010 das Institut verlassen. Seine Stelle wurde zum 15.08.2010 mit Herrn Dipl.-Geogr. -

Support for Refugee Integration in West and East Germany Results from Two Lost Letter Studies
Original Article Support for Refugee Integration in West and East Germany Results From Two Lost Letter Studies Jens H. Hellmann1 , Boris Forthmann1, Judith Knausenberger1, Deborah F. Hellmann2, Jonas H. Rees3, Eva Gansel1, Mitja D. Back1, and Gerald Echterhoff1 1Department of Psychology, University of Münster, Germany 2University of Applied Administrative Sciences NRW, Duisburg, Germany 3Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence & Department of Social Psychology, Bielefeld University, Germany Abstract: Prior research has reported less favorable attitudes toward and more violent crimes against ethnic out-group members in East (vs. West) Germany. We conducted two pre-registered lost letter studies in West versus East German cities (Study 1, N = 400) and in West versus East German rural areas (Study 2, N = 400). To investigate supportive behavior regarding refugee integration, we manipulated the addressee (refugee-integration vs. immigration-stop projects). Contrary to predictions, letter return rates did not differ between West and East Germany. Across western and eastern German regions, return rates were higher for the refugee-integration project in urban areas while no differences emerged in rural areas. A pooled analysis found greater support for the refugee-integration (vs. immigration-stop) project. Keywords: refugee integration, immigration, lost letters, prosocial behavior, Germany Since 2015, wars and other conflicts have forced more than Attitudes Toward Migrants in East and 68 million individuals globally to flee their places of West Germany residence, leading to what has been coined the greatest so-called “refugee crisis” since World War II (Bansak, The vast majority of previous studies has revealed higher Hainmueller, & Hangartner, 2016; Esses, Hamilton, & levels of prejudice against members of ethnic out-groups Gaucher, 2017). -

Wilhelmina Bernardina Brüning
Wilhelmina Bernardina Brüning Wilhelmina Bernardina Brüning married Johan Bernard Schulte in Iowa in 1878. They moved to St. Leo, Kansas around 1911. Wilhelmina came from Steinfeld in Oldenburg. Her husband Johan came from Tinnen in Niedersachsen (Lower Saxony), about fifty miles away. I doubt that Wilhelmina and Johan knew each other in Germany. Their homes were in two different sovereign states, and fifty miles would have been a difficult and unusual trek, by foot or by wagon. Wilhelmina’s parents were Johan Tobias Henrich Brüning and Maria Elisabeth (“Lizzie”) Schlärmann, who came from the town of Steinfeld in Oldenburg. Johan Tobias Brüning had been living in the separate parish of St. Gertrud in Lohne, some 5 miles to the north. To secure permission for the marriage, he had to have his baptism in that parish verified, and the couple had to apply for permission to live as Heuerleute in Steinfeld. Lizzie was eight months pregnant with Wilhelmina’s brother Henrich Anton at the marriage, hardly an unusual happening. (Illegitimate births were not countenanced at all, but as long as the parents got married, even after the fact, the birth became “legitimate.”) Johan died early. His brother emigrated to Iowa, however, as did Lizzie and her brother Karl Josef. I assembled the history of the Schlärmann branch about ten years ago, with assistance from distant cousins that was beyond kind. Because the St. Johannes Baptist Church records are still extant, that history is reliable and extended. More recently, I have reviewed LDS microfilms records of the Brüning branch from St. Gertrud. -

Spatial Structure of the Food Industry in Germany Gouzhary, Izhar1, Margarian, Anne2
Spatial Structure of the Food Industry in Germany Gouzhary, Izhar1, Margarian, Anne2 1,2 Johann Heinrich von Thünen Institut, Department of Rural Studies, Braunschweig, Germany PAPER PREPARED FOR THE 116TH EAAE SEMINAR "Spatial Dynamics in Agri-food Systems: Implications for Sustainability and Consumer Welfare". Parma (Italy) October 27th -30th, 2010 Copyright 2010 Gouzhary, Izhar, Margarian, Anne. All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this document for non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies. 2 Spatial Structure of the Food Industry in Germany Gouzhary, Izhar1, Margarian, Anne2 1,2 Johann Heinrich von Thünen Institut, Department of Rural Studies, Braunschweig, Germany Abstract— Food production and food processing, food industry in Germany with respect to its spatial nowadays, are economic activities in which local and structure on regional level. The spatial analysis global strategies are interconnected. Moreover the provides the tools and methods to represent and importance of the food industry in total manufacturing analyze these important activities and the competitive is growing; local production systems are competing on dynamic of the food industry within Germany’s the global market by producing specific quality goods or products. Many local regions have attempted to improve regions. The overall objective of this study is their economic situation by encouraging the growth of identifying and explaining the growth pattern of food manufacturing activities. The basic objective of this industry for regional/counties level. study to determine and analyze the patterns of food manufacturing and the spatial changes between 2007 This paper has four key questions to investigate: and 2001 in the 439 regions in Germany.