Texten Über Die Siemens AG
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Werner Von Siemens
106 siemens_ai © pjd 07.01 exc. Georg 1735-1805 Werner von Siemens 1 15 Kinder 15 www.joachim-dietze.de teilweise aktualisiert April 2012 Deutscher Erfinder und Unternehmer 152 Ferdinand 1787-1840 166 ausgewählte Vor- und Nachfahren Georg 1764-1827 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 243 245 246 247 248 249 250 251 253 Ludwig Werner Hans Ferdinand Sophie Sir William Friedrich Carl Franz Sophie 351 227 1805-1879 Georg 1812-1871 1815-1815 1818-1867 1820-1893 1821-1821 1821-1883 1826-1904 1829-1906 1831-1840 1834-1922 241 Mathilde 244 252 254 1814-1878 Werner von Siemens Walter Otto 242 13.12.1816 Lehnte bei Hannover 1833-1868 1836-1871 6.12.1892 Berlin 364 365 erblich geadelt 1888 369 ∞ (1) 1.10.1832 ∞ (2) 13.7.1869 Georg 351 Mathilde Drumann Antonie Siemens 21.10.1839-23.10.1901 8.7.1824-1.7.1865 16.9.1840-22.12.1900 1. Direktor d. Deutschen Bank 244 Elise Görz 1 2 3 4 5 6 11.9.1850-29.12.1938 364 365 366 368 Arnold Wilhelm (Willy) Anna Hertha Carl Friedrich 369 Aufsichtsratsvor- 13.11.1853 - 29.4.1918 30.7.1856 - 14.10.1919 19.12.1858-27.7.1939 30.7.1870-5.1.1939 5.9.1872 - 9.7.1941 sitzende Ellen v. Helmholtz Elly Siemens Richard Zanders Carl Dietrich Harries Tutty Bötzow 1897 Carl 250 24.4.1884 - 27.11.1941 2.3.1860 - 26.7.1919 25.8.1860-28.3.1904 5.8.1866-3.11.1925 2.2.1878 - 22.3.1935 1905 Arnold 364 Margarete Heck 367 1918 Wilhelm 365 Käthe 11.12.1890 - 17.11.1977 520 Werner Ferdinand 525 526 25.9.1841-16.6.1949 1919 Carl Friedrich 369 Hermann 4 Mathilde 1941 Hermann 520 9.8.1885-13.10.1986 7.2.1885 - 27.7.1937 31.7.1888-9.10.1945 Karl Pietschker (1) Katrin Heck 25.6.1889-24.8.1919 527 (1946-48 Carl 382 ) Charlotte v. -

1968 Werner Von Siemens
Global network of innovation The Company 2005 Siemens is committed to both continuity and change The Company 2005 Management continuity is a key factor in our success Werner von Siemens 1847 ± 1890 Wilhelm von Siemens, 1890 ± 1919 Carl von Siemens Carl Friedrich von Siemens 1919 ± 1941 Hermann von Siemens 5 ± 1956 Ernst von Siemens 1956 ± 1968 1968 ± 1971 Gerd Tacke 1971 ± 1981 Bernhard Plettner 1981 ± 1992 Karlheinz Kaske 1992 ± 2005 Heinrich v. Pierer since 2005 Klaus Kleinfeld The Company 2005 Siemens is one of the world©s most successful companies in electrical engineering and electronics The Company 2005 We are one of the largest companies in our field 119.0 in bns. of € Total sales in bns. of € Sales in electrical engineering and electronics 77.8 75.2 67.4 73.9 65.6 67.7 61.6 63.7 55.9 58.5 54.5 49.2 49.0 43.4 43.6 38.8 39.1 38.8 30.9 GE IBM Siemens Hitachi Hewlett- Matsu- Sony Samsung Toshiba Dell Packard shita Electronics The Company 2005 Our key figures reflect an outstanding performance Change 1) 1) in billions of euros 2004 2003 in % New orders 80.830 75.056 + 92) Sales 75.167 74.233 + 32) Net income 3.405 2.445 + 39 Net income provided by operating activities 5.080 5.712 ± 11 Net cash used in investing activities (1.818) (3.939) Research and development expenses 5.063 5.067 Shareholders© equity (September 30) 26.855 23.715 €1.10 Dividend €1.25 430 417 Employees (September 30, in thousands) 891 891 Number of shares (in millions) 1) Fiscal year: October 1 to September 30 The Company 2) Adjusted for currency effects and portfolio activities 2005 With production facilities all around the world, we are a true global player 96 72 61 44 14 4 North Germany Europe Asia- South Middle East, America (excl. -

Der Bedeutungszuwachs Betrieblicher Humaner Und Sozialer Ressourcen Im Lichte Der Krisensituation Der 1970Er Und 1980Er Jahre
Faktor Mensch Der Bedeutungszuwachs betrieblicher humaner und sozialer Ressourcen im Lichte der Krisensituation der 1970er und 1980er Jahre Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam vorgelegt von: Diplom-Kaufmann, Diplom-Volkswirt Kim-Holger Opel Potsdam 2016 Erstgutachter: Prof. Dr. André Steiner, Universität Potsdam Zweitgutachter: Prof. em. Dr. Toni Pierenkemper, Universität zu Köln Datum der mündlichen Prüfung: 7. Juni 2017 Online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam: URN urn:nbn:de:kobv:517-opus4-404767 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-404767 Für Jannis und Niklas Vorwort An dieser Stelle möchte ich meinen besonderen persönlichen Dank nachstehenden Per- sonen entgegenbringen, ohne deren Mithilfe die Anfertigung dieser Promotionsschrift niemals zustande gekommen wäre: Mein Dank gilt zunächst Herrn Prof. Dr. André Steiner, meinem Doktorvater, und Herrn Prof. Dr. Toni Pierenkemper, meinem Zweitgutachter, für die hilfsbereite und wissen- schaftliche Betreuung dieser Arbeit. Die Gespräche waren immer ein bereichernder und konstruktiver Austausch, den ich als Ermutigung und Motivation empfunden habe. Des Weiteren möchte ich Herrn Alexander Huseby vom Centrum för Näringslivshistoria in Stockholm für seine ausgezeichnete Hilfe danken. Er gab mir nicht nur Zugang zu un- entbehrlichen Informationen und historischen Dokumenten schwedischer Unterneh- men, sondern war jederzeit Ansprechpartner für meine zahlreichen und unermüdli- chen fachlichen Fragen. Auch die vielen „nicht-wissenschaftlichen“ motivierenden Ge- spräche haben meine Arbeit sehr unterstützt. Mein weiterer Dank gilt den Mitarbeite- rinnen und Mitarbeitern der Universität Oxford und der Bodleian Library (insbesondere Herrn Michael Hughes) sowie des Siemens-Unternehmensarchivs in München in ihrer steht hilfsbereiten Unterstützung meiner Arbeit. Dankbar bin ich außerdem Herrn Prof. -

2 FG9A Nationale Patente Brevets Nationaux Brevetti Nazionali
31.1.2002 CH PMMBI/FBDM/FBDM 2 2 FG9A K Pinzetta di precisione con terminali N Hisashi Koike rimovibili. 3-5, Owa 3-chome Nationale Patente O Ideal-Tek S.A. Suwa-shi, Nagano (JP) via S. Gottardo 99a Hitoshi Igarashi Brevets nationaux 6830 Chiasso (CH) 3-5, Owa 3-chome N Franco Grisoni Suwa-shi, Nagano (JP) Brevetti nazionali via Franscini 6A Kobayashi, Takao 6933 Vacallo (CH) c/o Seiko Epson Corporation, 3-5 P Fiammenghi-Fiammenghi Owa 3-chome Via San Gottardo 15 Suwa-shi, Nagano (JP) 2.3 FG3A 6900 Lugano (CH) Miyazawa, Hisashi c/o Seiko Epson Corporation, 3-5 I B 25 D 017/08, B 25 F 001/02, Owa 3-chome Ohne Vorprüfung erteilte B 08 B 007/02 Suwa-shi, Nagano (JP) Patente A 692 080 Yoshida, Masanori B 02994/96 c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Brevets délivrés sans C 06.12.1996 examen préalable F Owa 3-chome 06.02.1996 DE 196 04 171.6 Suwa-shi, Nagano-ken (JP) K Meisselhammer zum Abtragen von P Bovard AG Patentanwälte Brevetti rilasciati senza Oberflächen. Optingenstrasse 16 esame preventivo O Robert Bosch GmbH 3000 Bern 25 (CH) Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart (DE) I B 41 J 002/175 I A 01 G 009/02 Z A 01 G 013/10 N HAERLE, Vinzenz A 692 083 A 692 077 Achalmstrasse 5/1 B 01269/01 72654 Neckartenzlingen (DE) C I 07.07.1997 A 01 G 013/10, A 01 G 009/02 Manfred Buck F A 05.07.1996 JP 8-195626 692 077 Erlenweg 4 14.08.1996 JP 8-233588 B 00982/97 72622 Nuertingen (DE) 30.05.1997 JP 9-158009 C 28.04.1997 Hölzel, Martin K Cartouche d’encre pour imprimante K Vorrichtung zum Schutz von Feigenweg 6B à jet d’encre Einzelpflanzen vor Schneckenfrass. -

Ernst Von Siemens Lif El in Es Ernst
Ernst Siemens von S E LIFelINES IN el Ernst LIF von Siemens Ernst von Siemens was a major figure in the history of the electrical engineering company, setting its strategic course in the decades of rebuilding following World War II. It was under his leadership that today’s Siemens AG was organized. The grandson of company founder Werner von Siemens, he was also a man of wide- ranging interests and, in addition to his entrepreneurial activities, an important patron of the arts. Ernst von Siemens is remembered above all for the cultural foundations that he established. The brochure is the fourth volume in the LIFE- LINES series, which is dedicated to introducing the men and women who have done the most to shape the history and development of Siemens. This group includes businessmen who led the company, members of the Manag- ing Board, engineers, inventors and creative thinkers. A conscious effort has been made to include the lives and contributions of those individuals who are not always counted among the company’s most prominent figures. Ernst von Siemens Ernst von Siemens . – . LIFELINES 2 Introduction Profi ling Ernst von Siemens to commemorate the twenty-fi fth an- niversary of his death on December 31, 2015, is a rewarding task. The youngest grandson of company founder Werner von Siemens – born April 9, 1903 – did, after all, play a critical role in charting the strategic course of the engineering giant as it rebuilt itself in the decades following World War II. This artistic and cultured family scion also achieved great things as a patron of the arts. -

150 Jahre Geschäe Des Siemens-Konzerns
d chmid, Ernt toni 150 Jahre Geschäe des Siemens-Konzerns Geschte in finsteren Zeiten + Siemens-Welt heute 1. Ds Gespenst des Hauses Siemens - Geschäfte in finsteren Zeiten 11. Siemens-Welt heute - Vom Hoflieferanten zum Global Player • W __- 3 sozial-ökologische Witschatsforschung München e. V. Schzgebühr 6,- DM Inhalt I. Das Gespenst des Hauses Siemens Geschäfte in finsteren Zeiten ................................................................................... 1 Der Krieg, der Vater aller Dinge .................................................................................. 2 Siemens sozial: Der Geist der "Volksgemeinschaft" ................................................... 3 Ein Volk, ein Reich, ein Siemens ... ........................................................................... 5 "Der Weg zum Krematorium führte am Siemenslager vorbei" ................................... 8 Zu neuen Ufern - und der Geiz des Hauses Siemens ................................................ 11 II. Siemens-Welt heute Vom Hoflieferanten zum Global Player .............................................................. 13 Vom Monopol zum Multi .......................................................................................... 13 Kerntechnologien, Kernkompetenzen - Kerngeschäfte ............................................. 19 Der Risiko-Konzern ................................................................................................... 29 Siemens und der Staat: Neue Beziehung ... „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

Unternehmen Als Triebkräfte Von Migration: Grenzüberschreitende Personalmobilität Von Siemens Nach Japan Kristina Jäger
Unternehmen als Triebkräfte von Migration: Grenzüberschreitende Personalmobilität von Siemens nach Japan Dissertation zur Erlangung des Grades Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) am Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück vorgelegt am 19.02.2019 von Kristina Jäger Erstgutachter: Apl. Prof. Dr. Jochen Oltmer, Universität Osnabrück Zweitgutachter: Prof. Dr. Christoph Rass, Universität Osnabrück Drittgutachterin: Prof. Kyoko Shinozaki, Ph.D, Universität Salzburg Anmerkung zu schriftsprachlichen Darstellungsweisen der vorliegenden Arbeit Die in der vorliegenden Dissertation verwendeten japanischsprachigen Begriffe werden in Lateinum- schrift mit Längenzeichen (^) über langen Vokalen und kursiv dargestellt. Auf Schriftzeichen wird gänzlich verzichtet. Die auch in der deutschen Sprache geläufigen japanischen Begriffe wie auch Städ- tenamen werden ohne Längenzeichen dargestellt (also Tokyo anstelle von Tôkyô). Um den Text gendergerecht darzustellen und schriftsprachliche Diskriminierung zu vermeiden, verwendet die vorliegende Arbeit in unregelmäßiger Folge die weibliche und männliche Form. Unter der jeweils weiblichen oder männlichen Form subsumieren sich beide Geschlechter. 2 DANKSAGUNG Die vorliegende Arbeit entstand mit Unterstützung und Begleitung vieler Personen, denen ich an die- ser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Zu aller erst bedanke ich mich bei meinem Doktorvater Apl. Prof. Jochen Oltmer, der mir im Entstehungsprozess und in allen Phasen meiner Arbeit einerseits die nötige Freiheit gelassen hat, -

Ernst Von Siemens L Eb E Ensw G E Ernst
Ernst Siemens von E G LEBENSWEGE E NSW E B E Ernst L von Siemens Ernst von Siemens war aufgrund seiner strate- gischen Weichenstellungen von großer Bedeu- tung für den Elektrokonzern in den Jahrzehnten des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter seiner Ägide erfolgte 1966 die Gründung der heutigen Siemens AG. Über seine unter- nehmerische Tätigkeit hinaus hat der vielseitig interessierte Enkel des Firmengründers Werner von Siemens als Mäzen Großartiges geleistet. Heute ist sein Name vor allem durch die von ihm gegründeten Stiftungen präsent. Die Broschüre ist der vierte Band der Schriften- reihe LEBENSWEGE, in der Persönlichkeiten porträtiert werden, die die Geschichte und Entwicklung von Siemens auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Das Spektrum des Per- sonenkreises reicht von den Unternehmern an der Spitze des Hauses über einzelne Vorstands- mitglieder, Techniker und Erfinder bis hin zu Kreativen. Bewusst sollen das Leben und die Leistungen auch von den Menschen vorgestellt werden, die im Unternehmen nicht in vorderster Reihe standen. Ernst von Siemens Ernst von Siemens . – . LEBENSWEGE 2 Einleitung Ernst von Siemens anlässlich seines 25. Todestags – dem 31. De- zember 2015 – zu porträtieren, ist eine lohnende Aufgabe. Schließ- lich war der am 9. April 1903 geborene jüngste Enkel des Firmen- gründers Werner von Siemens aufgrund seiner strategischen Weichenstellungen von großer Bedeutung für den Elektrokonzern in den Jahrzehnten des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Welt- krieg. Darüber hinaus hat dieser musische und kunstsinnig- sensible Spross der Familie auch als Mäzen Großartiges geleistet. Sein Name lebt durch zwei erstrangige Stiftungen fort, die bei der Förderung der Musik und der Künste starke Akzente setzen. Ent- sprechend groß ist die Bandbreite der mit Ernst von Siemens ver- bundenen Themen. -
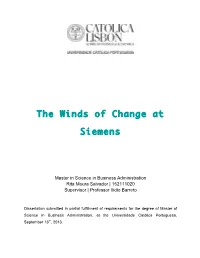
The Winds of Change at Siemens
The Winds of Change at Siemens Master in Science in Business Administration Rita Moura Salvador | 152111020 Supervisor | Professor Ilídio Barreto Dissertation submitted in partial fulfillment of requirements for the degree of Master of Science in Business Administration, at the Universidade Católica Portuguesa, September 16th, 2013. Acknowledgements First, I would like to thank my dissertation supervisor, Professor Ilídio Barreto, for his support and availability to share his knowledge and to help me write this dissertation, especially given the restrictions I had. Second, I would also like to express my gratitude to all my colleagues at Siemens which, not only answered my incessant questions, but also allowed me to tell the beautiful story of this great company. I would specially like to thank my team for the opportunity, the time, the constant motivation and for listening to me. Also, I would like to thank my professors, teaching assistants and academic staff at Católica-Lisbon School of Business and Economics for helping me to grow academically, professionally and personally. Moreover, I would like to thank my family, especially my parents, brother and grandparents for the concern and the motivation given throughout these months. Also, I would like to thank to my colleagues that attended the seminar alongside me, particularly to Samir, who always had the right words for me. Last but not the least, I would like to thank to Diogo for listening, reading, correcting, advising, giving me motivation…thank you very much. II Abstract Strategic change is a topic of great importance given the turbulence of the markets in which firms operate. -

Hoofblad IE 23 Juni 2021
Nummer 25/21 23 juni 2021 Nummer 25/21 2 23 juni 2021 Inleiding Introduction Hoofdblad Patent Bulletin Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt The Patent Bulletin appears on the 3rd working op de derde werkdag van een week. Indien day of each week. If the Netherlands Patent Office Octrooicentrum Nederland op deze dag is is closed to the public on the above mentioned gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad day, the date of issue of the Bulletin is the first verschoven naar de eerstvolgende werkdag, working day thereafter, on which the Office is waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het open. Each issue of the Bulletin consists of 14 blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk headings. nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Official Journal Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, Appears four times a year (January, April, July, oktober) in elektronische vorm via www.rvo.nl/ October) in electronic form on the www.rvo.nl/ octrooien. Het Bijblad bevat officiële mededelingen octrooien. The Official Journal contains en andere wetenswaardigheden waarmee announcements and other things worth knowing Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te for the benefit of the Netherlands Patent Office and maken hebben. its customers. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Subscription rates per calendar year: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis Patent Bulletin and Official Journal: free of in elektronische vorm op de website van charge in electronic form on the website of the Octrooicentrum Nederland.