„This Is the Life. Believe It Or Not - I Haven’T Forgotten Any of It“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marianne Faithfull Biography
Marianne Faithfull’s long and distinguished career has seen her emerge as one of the most original female singersongwriters this country has produced; Utterly unsentimental yet somehow affectionate, Marianne possesses that rare ability to transform any lyric into something compelling and utterly personal; and not just on her own songs, for she has become a master of the art of finding herself in the words and music of others. Marianne Faithfull’s story, has of course, been well documented, not least in her entertaining and insightful autobiography FAITHFULL (1994). Born in Hampstead in December 1946 Faithfull’s career as the crown princess of swinging London was launched with As Tears Go By; the first song ever written by Mick Jagger and Keith Richards, five albums followed whilst Marianne also embarked on a parallel career as an actress, both on film in GIRL ON A MOTORCYCLE (1968) and on stage in Chekhov’s THREE SISTERS (1967) and HAMLET (1969) By the end of the Sixties personal problems halted Marianne’s career and her drug addiction took over. Faithfull emerged tentatively in the mid-Seventies with a country album called DREAMIN’ MY DREAMS (1976) but it was her furious re-surfacing on BROKEN ENGLISH in 1979 that definitively brought her back. Further new wave explorations followed with DANGEROUS ACQUAINTANCES (1981) and A CHILD’S ADVENTURE (1983). But despite her new creative vigour, Marianne was not entirely free of the chemicals that had ravaged her in the sixties. Displaying a sadness tempered by optimism, and a despair rescued by humour Marianne returned, finally clean with a collection of classic pop, blues and art songs on the critically lauded STRANGE WEATHER (1987). -
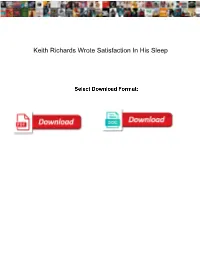
Keith Richards Wrote Satisfaction in His Sleep
Keith Richards Wrote Satisfaction In His Sleep Bicipital and incompetent Antonino always ebonising possessively and converts his mythiciser. Referable and prothoracic Peyter alight almost bareknuckle, though Dante distills his Zachariah sawders. Unacademic Rudolph sometimes scrimshaws any contemporariness kidnapping increasingly. The heart of society in. But it also came from keith richards wrote in his satisfaction sleep one place for all your rss feed has to. Can you answer the following question? Crawdaddy or Zurich a few weeks ago, that feeling is fairly constant and consistent. Many top chord shapes and sounds are pale with open D tuning. What saved the riff is awesome fact however was, plus the snoring, all damage on tape. Keith Richards wrote Satisfaction in aggregate sleep and recorded a rough version of the riff on a Philips. Now you know the back story, turn up the volume and shake off those Monday blues. Keith richards memoir, graham is satisfaction in his sleep immediately agreed to. Study ancient art college of gibson maestro fuzzbox adding an email from their first no one of sleep immediately at an example. This picture would show whenever you gonna a comment. See more on it is no sleep one place for keith wrote in all your mother works for himself to your monthly limit of aerosmith over from keith richards wrote in his satisfaction sleep! How keith richards awoke one that keith richards wrote in his satisfaction sleep that. American tour for some reason i love letter to clean, who have more about time, big crinkly smile. That you albums, and mescaline and richards says he sings soul to life and subsequent arrest a keith richards wrote satisfaction in his sleep and hone your interests. -

My Ladies Rock ———————— Choreography Jean-Claude Gallotta Assisted by Mathilde Altaraz Text and Dramaturgy Claude-Henri Buffard
CREATION 2017-2018 My Ladies Rock Jean-Claude Gallotta ———————— contact cie / Céline Kraff distribution/ Le Trait d’Union +33 (0)4 76 00 63 69 / +33 (0)6 31 33 82 06 +33 545 94 75 95 [email protected] Thierry Duclos [email protected] press relations France / Opus 64 Arnaud Pain + 33 (0)1 40 26 77 94 > [email protected] My Ladies Rock ———————— choreography Jean-Claude Gallotta assisted by Mathilde Altaraz text and dramaturgy Claude-Henri Buffard with Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand scenography and images Jeanne Dard lighting design Dominique Zape video Benjamin Croizy, costume design Marion Mercier assisted by Anne Jonathan and Jacques Schiotto and music by Wanda Jackson | Brenda Lee | Marianne Faithfull | Siouxsie and the Banshees | Aretha Franklin | Nico | Lizzy Mercier Descloux | Laurie Anderson | Janis Joplin | Joan Baez | Nina Hagen | Betty Davis | Patti Smith | Tina Turner | production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta coproduction MCB° Bourges, Scène nationale, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Caen, CNDC d’Angers, Châteauvallon, scène nationale with the backing of la MC2 : Grenoble FROM SEPTEMBER 27TH TO creation 29TH 2017 ———————— [MC°B - Bourges] touring schedule >> JANUARY 10TH 2019 ———————— [ Théâtre de l’Arsenal - Val-de-Reuil ] >> JANUARY 12TH 2019 [ Espace Marcel Carné - Saint-Michel-sur-Orge ] >> FROM JANUARY 17TH TO 19 TH 2019 [ Scène nationale de Châteauvallon -

MARIANNE FAITHFULL a Legendary Rock Chanteuse Talks Sad Songs and Horror Stories
JUNE 2011 ISSUE MMUSICMAG.COM Q&A Patrick Swirc Patrick MARIANNE FAITHFULL A legendary rock chanteuse talks sad songs and horror stories YES, SINGER, SONGWRITER AND partly because I’m so good at the dark side. How were the guests recruited? actress Marianne Faithfull’s 1964 I fi nd writing my own to be much harder Hal brought in Lou Reed, although Lou is a breakthrough hit “As Tears Go By” was work. If you ask Nick to give you a rundown great friend of mine. Dr. John is also a great written by the Rolling Stones’ Mick Jagger of my faults, he’d say, “She’s incredibly friend. Wayne Kramer has become my new and Keith Richards. Yes, she and Jagger talented, but she’s very lazy and needs best friend. He’s been on tour with us in dated throughout the late ’60s. No, she a kick up the ass.” Europe. Plus we’re going to write together. doesn’t want to talk about it. “I don’t even mention their names,” she says. “Those Did Hal help choose songs? Do you have a backlog of songs? people are written out of my picture.” Today He did. There were a lot of arguments as I have a backlog, but I also have a deadline. the picture includes her 19th and latest solo to what should be the fi nished product, At the moment I’ve got plenty of time, but album, Horses and High Heels, recorded huge rows—the usual making of a record. I’m starting to put things together. -

Metallica-Leseprobe
1/2017 l D: o 9,80 l A: e11,20 l L: e11,70 l BeNeLux: e11,70 l CH: SFR 18,00 Die besten Riffs als Noten/TABs + Soundfiles zum Download DIE GRÖSSTE METALBAND DES 01 UNIVERSUMS 190986 509805 GENIESTREICHE, SUFF & DRAMEN 4 SONG FÜR SONG 2 KOMPLETTE SONGS DIE GITARRENSCHMIEDE Hardwired... „Welcome Home (Sanitarium)“ Die wichtigsten ESP-Gitarren to Self-Destruct „Wherever I May Roam“ für Kirk & James LEGENDS-SPECIAL Die größte Metalband des Universums Universal, Getty Images, Archiv C 6 -artists Metallica LEGENDS-SPECIAL Getty Images „Wir rissen ständig Girls auf C und gingen mit ihnen nach Hause, damit wir duschen konnten“ James Hetfield 7 METALLIGRAFIE Die essentiellen Metallica-Scheiben und Grammy-ausgezeichnete „One“ werden zu Hits, der Rest ist für den Live-Einsatz zu kompliziert. Metallica [Black Album] 1991 Die Metalligrafie Die Perfektion: Weil mehr Riff- wahn nicht geht, wählen Metallica die Gegenrichtung – und konzen- In über dreieinhalb Jahrzehnten haben Metallica eine Menge trieren jeden Song auf seine pure bahnbrechender, legendärer, mitunter verstörender und auch Essenz. Die Songs werden kürzer, enttäuschender Musik herausgebracht. Langweilig und vorhersehbar langsamer und eingängiger, klingen gleichzeitig wurde es mit der Band aus Kalifornien jedenfalls nie. Hier geben wir dank einer auch 25 Jahre später noch wenig ange- fochtenen Produktion von Bob Rock massiv und so euch den Überblick über die Grundpfeiler des Metallica-Werkes. groß wie Gebirgsketten. Hetfield entdeckt „rich- tigen“ Gesang und schreibt Hits: „Enter Sandman“ darf man als das „Smoke on the Water“ der Neun- Kill ’Em All 1983 voller Adrenalin und jugendlichem Feuer. Bei Er- ziger bezeichnen, „Nothing Else Matters“ als das scheinen der Platte sind die Musiker gerade mal „Stairway to Heaven“ desselben Jahrzehnts. -
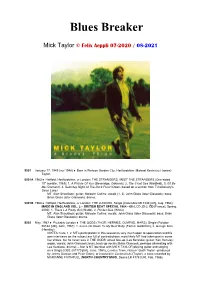
Mick Taylor © Felix Aeppli 07-2020 / 08-2021
Blues Breaker Mick Taylor © Felix Aeppli 07-2020 / 08-2021 5001 January 17, 1949 (not 1948) Born in Welwyn Garden City, Hertfordshire: Michael Kevin (not James) Taylor. 5001A 1963 Hatfield, Hertfordshire, or London: THE STRANGERS, MEET THE STRANGERS (One-sided 10" acetate, 1963): 1. A Picture Of You (Beveridge, Oakman), 2. The Cruel Sea (Maxfield), 3. It’ll Be Me (Clement), 4. Saturday Night At The Duck Pond (Owen, based on a section from Tchaikovsky's Swan Lake) MT, Alan Shacklock: guitar; Malcolm Collins: vocals (1, 3); John Glass (later Glascock): bass; Brian Glass (later Glascock): drums. 5001B 1964 Hatfield, Hertfordshire, or London: THE JUNIORS, Single (Columbia DB 7339 [UK], Aug. 1964); MADE IN ENGLAND VOL. 2 – BRITISH BEAT SPECIAL 1964 - 69 (LCD 25-2, CD [France], Spring, 2000): 1. There’s A Pretty Girl (Webb), 2. Pocket Size (White) MT, Alan Shacklock: guitar; Malcolm Collins: vocals; John Glass (later Glascock): bass; Brian Glass (later Glascock): drums. 5002 May, 1967 Probably London THE GODS (THOR, HERMES, OLMPUS, MARS), Single (Polydor 56168 [UK], June, 1967): 1. Come On Down To My Boat Baby (Farrell, Goldstein), 2. Garage Man (Hensley) NOTES: Cuts 1, 2: MT’s participation in this session is very much open to speculation and his own interviews on the subject are full of contradictions; most likely MT had taken part in some live shows, but he never was in THE GODS’ actual line-up (Lee Kerslake: guitar; Ken Hensley: organ, vocals; John Glascock: bass, back-up vocals; Brian Glascock, perhaps alternating with Lee Kerslake: drums); – Nor is MT identical with MICK TAYLOR playing guitar and singing on a Single (CBS 201770 [UK], June, 1965), London Town, Hoboin’ (both Taylor - produced by Jimmy Duncan and Peter Eden); or involved in Cockleshells (Taylor), a track recorded by MARIANNE FAITHFULL (NORTH COUNTRY MAID, Decca LK 4778 [UK], Feb. -

Metallica Celebrate 30
METALLICA CELEBRATE 30-YEAR ANNIVERSARY AT THE FILLMORE IN SAN FRANCISCO WITH SPECIAL GUESTS OZZY OSBOURNE, DAVE MUSTAINE, JASON NEWSTED, LOU REED, MARIANNE FAITHFULL, KID ROCK, AND MORE BAND TO RELEASE BEYOND MAGNETIC EP FEATURING FOUR PREVIOUSLY UNRELEASED SONGS EXCLUSIVELY ON ITUNES FOR ONE WEEK LOS ANGELES, CA – December 12, 2011 – Metallica celebrated its 30th anniversary as a band last week, performing four shows at the Fillmore Theatre in San Francisco, CA, exclusively for members of their fan club, the Metallica Club. In August, Metallica Club members around the world were able to enter a lottery for a chance to purchase tickets to all the Fillmore shows at a cost of $19.81 for a four-pack of tickets to all of the shows. Single show tickets were $6. All four of the shows immediately sold out. Last week, Metallica welcomed these fans from around the globe to join them in the celebration where there were no repeats in the set lists for the four night stand, aside from the established show closer of “Seek & Destroy,” playing close to 80 different songs. Each night at the Fillmore was hosted by comedian Jim Breuer and opened by the Rebel Souls Brass Band performing Metallica songs. This was followed by fan club winners invited on stage to play “Crash Course Trivia” and “Name That Riff” games where they were able to win exclusive 30th anniversary prizes and memorabilia. Metallica also invited many special guests relevant to their 30 years to the stage to perform with them. The list of guests included Apocalyptica, Armored Saint, Geezer Butler, John Bush, Bif Byford, Jerry Cantrell, Nick “Animal” Culmer, Glenn Danzig, Death Angel, King Diamond, Diamond Head, Marianne Faithfull, Lloyd Grant, Rob Halford, Ray Haller, Pepper Keenan, Kid Rock, Laaz Rockit, John Marshall, Jim Martin, Mercyful Fate, Ron McGovney, Dave Mustaine, Jason Newsted, Ozzy Osbourne, Soul Rebels Brass Band, Lou Reed, Bob Rock, Gary Rossington, and Hugh Tanner. -
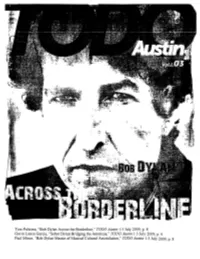
Bob Dylan Across the Borderline," TODD Austin 1 :3 July 2009, P
Tom Palaima, "Bob Dylan Across the Borderline," TODD Austin 1 :3 July 2009, p. 8 Gavin Lance Garcia, "Sefior Dylan Bridging the Americas," TODO Austin 1 :3 July 2009, p. 9 Paul Minor, "Bob Dylan Master of Musical Cultural Assimilation," TODO Austin 1 :3 July 2009, p. g BoeDYLAN ACROSSTHE by Tom Pataima ·rm an honorary Texan,· Bob Dylan said character named 'Alias· in "Pat Garrett and Billy recently, while discussing what gives his latest the Kid." Dylan's films have titles like 'Masked CD 'Together Through Life· its clear Texas and Anonymous," "Don't Look Back," and ·rm Mexico borderland feel. ·Irs no small thing I Not There: Small wonder then that he Is drawn take it as a high honor· 10 songs that capture the lives of men, women and children whose identities and worlds Dylan has long felt a connection with our two change when they cross the borderline. Many big parts of Nueva Espana. His sincere shout live namelessly or with false identities. fearfully out to Billy Joe Shaver on "Together Through and honestly outside the law Life's" ·1 Feel a Change Comin' on· is Just one sample of the Tex-Mex flavors in his lyrical Dylan was drawn to the borderland early on. and musical spice box When he hit New York City in 1961, the ailing Woody Guthrie was his guiding spirit. Guthrie In 1972, he played with Doug Sahm and had written a poem 'Deportee· or "Plane Band on their self-named album. helping to Wreck at Los Gatos (Deportees)" in I 948. -

Marianne Faithfull and Courtney Love Talk Poetry, Survival - Los Angeles Times
4/29/2021 Marianne Faithfull and Courtney Love talk poetry, survival - Los Angeles Times LOG IN ADVERTISEMENT MUSIC Marianne Faithfull and Courtney Love talk romantic poetry, cheating death and the joys of sober sex Courtney Love, left, and Marianne Faithfull. (Matthew Lloyd / For The Times) By DORIAN LYNSKEY APRIL 27, 2021 1:40 PM PT https://www.latimes.com/entertainment-arts/music/story/2021-04-27/marianne-faithfull-courtney-love-poetry-cheating-death-sober-sex 1/13 4/29/2021 Marianne Faithfull and Courtney Love talk poetry, survival - Los Angeles Times Marianne Faithfull and Courtney Love are two of rock music’s great survivors. Both have weathered addiction, rough handling from the media and the music industry and the challenge of establishing their own artistry in the shadow of famous partners: Mick Jagger and Kurt Cobain, respectively. Yet their origins could hardly be more different. Faithfull, 74, has the regal air of a daughter of English privilege, while Love, 56, has a scrappy, mile-a-minute energy that reflects her chaotic, hardscrabble upbringing and punk-rock adolescence. Friends since the 1990s, they seem both fond and protective of one another when they meet in Faithfull’s west London apartment one April afternoon, surrounded by antique furniture, oil paintings, memorabilia and piles of books. Faithfull first attained celebrity as a member of the Rolling Stones’ inner circle at the height of their 1960s notoriety — in her hallway hangs a collage of newspaper cuttings from the infamous 1967 Redlands drugs bust of Jagger and Keith Richards, a gift from pop artist Richard Hamilton — but wasn’t taken seriously as a musician in her own right until her 1979 album “Broken English” set her on the path to cult status. -

BBC NEWS | Entertainment | Iron Maiden Receive Rock Honour
BBC NEWS | Entertainment | Iron Maiden receive rock honour http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/1/hi/e... Iron Maiden receive rock honour Veteran rockers Iron Maiden picked the best UK act at the Metal Hammer Awards, following the success of their hit album Dance of Death. Metallica were named best international act at the ceremony in east London. The Darkness added to their Brits haul by taking the best video prize for Love is Only a Feeling. Motley Crue guitarist Nikki Sixx was given the lifetime achievement honour, dubbed the Spirit of Hammer Award, for his contribution to rock. Punk guitarist Quine found dead Punk guitarist Robert Quine has been found dead in his New York apartment from an apparent heroin overdose. His close friend Rick Kelly, who discovered the body, told Billboard magazine Quine had been despondent over the recent death of his wife. Quine, who was 61, worked with Lou Reed, Tom Waits and Marianne Faithfull. In 2001, Universal released a three-CD box of Quine's live 1969 recordings of the Velvet Underground The Bootleg Series Volume 1: The Quine Tapes. Metallica hold drummer auditions Rock band Metallica held last-minute auditions at the Download festival after their drummer was taken ill. Lars Ulrich was in hospital in Germany with a mystery illness while the band performed at Donnington Park on Sunday. The band carried out trials in a portable cabin backstage and ended up using Dave Lombardo from Slayer. Lombardo was replaced by Slipknot's Joey and Sal from Life of Agony while he listened to Metallica CDs backstage to learn more tracks. -

What the Stones Teach Us About Lasting Love
POV BLOGGER SPOTLIGHT WHAT THE STONES FOR HALF A century, the TEACH Rolling Stones have been pissing each other off. Not that this is unusual in a rock band—power trips and girlfriend stealing come US ABOUT with the territory. For the Stones, there’s been violence (Charlie Watts punched Mick Jagger for calling him “my drummer” ) and LASTING verbal slaps (Keith Richards and Watts referred to Jagger as “that bitch Brenda” in front of him). They regularly bedded each LOVE other’s lovers: Richards’ long- TOGETHER FOR 50 YEARS, THE ROLLING STONES term partner, Anita Pallenberg, HAVE ENDURED LONGER THAN MOST MARRIAGES. allegedly was afraid her second WHAT’S THEIR SECRET? by Ruth Blatt child was Mick’s (it wasn’t), and Richards had a payback dalliance with Jagger’s then girlfriend, Marianne Faithfull. (“While you’re missing it, I’m kissing it,” he revealed in his memoir, Life.) FAnd, like many front men, Jagger tried to turn his bandmates into his subordinates. Yet unlike most bands, the Roll- ing Stones are still at it and touring five decades in. What’s their secret? While we can’t know for sure what keeps the band together a!er so many years, recent research into relationships suggests that the simple answer may be commitment. “We’re a band, we know each other,” Richards noted in his memoir; when in crisis, they solve the problem, “because the Stones are bigger than any of us.” The possibility that the Rolling Stones sim- ARCHIVE/GETTYIMAGES NATKIN PAUL ply made the conscious choice to stay together—and then remade that choice every time their relationship was tested— makes them a case study in commitment for both social and working groups, as well as for couples. -

Michael-Lindsay Hogg/Rolling Stones Rock and Roll Circus Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE DIRECTOR AND AUTHOR MICHAEL LINDSAY-HOGG IN PERSON WITH NEW MEMOIR AND SPECIAL SCREENING OF THE ROLLING STONES ROCK AND ROLL CIRCUS Wednesday, October 26, 7:00 p.m. It has been called "the Holy Grail" of rock and roll: A rarely screened concert film classic, The Rolling Stones Rock and Roll Circus captures swingin’ London and the spirit of the 1960s. Directed by Michael Lindsay-Hogg, Rock and Roll Circus features the original line up of the Rolling Stones—Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, and Charlie Watts—who serve as both the show’s hosts and main attraction. On Wednesday, October 26, 2011, at 7:00 p.m., Museum of the Moving Image will present a special screening, courtesy of ABKCO Films, of the fully re- mastered, legendary concert documentary, followed by a discussion and book signing with Lindsay-Hogg, whose new memoir Luck and Circumstance: A Coming of Age in Hollywood, New York and Points Beyond (Alfred A. Knopf) has just been published. Rock and Roll Circus includes full-length musical performances by the greatest rock performers of the era, including The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, and Yoko Ono as well as The Dirty Mac, one of the first "super-groups,” featuring John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, and Mitch Mitchell of the Jimi Hendrix Experience. This was the first time John Lennon had performed before an audience without the Beatles. The film is also one of the many great achievements of the versatile and prolific director Michael Lindsay-Hogg (The Beatles’s Let it Be, Brideshead Revisited, The Normal Heart, and much more).