Download Als PDF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

47 New and Very Rare for the Lithuanian Fauna
47 NAUJOS IR RETOS LIETUVOS VABZDŽI Ų R ŪŠYS. 16 tomas NEW AND VERY RARE FOR THE LITHUANIAN FAUNA LEPIDOPTERA SPECIES COLLECTED IN 1978–2004 RI ČARDAS KAZLAUSKAS Department of Zoology, Vilnius University, M.K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius. E- mail: [email protected] Material and Methods The material was collected in different administrative districts of Lithuania. Butterflies were collected with a standard entomological net. Moths were attracted using 160–400 W mixed light lamp bulbs. The identification of Lepidoptera species was checked with conformable guides (Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993; Nowacki, 1998; Elsner et al ., 1999; Razowski, 2001; Ivinskis, Augustauskas, 2004). Some species listed bellow were mentioned as new to Lithuania (Kazlauskas, 2003) but exact finding data are presented in this report. New species are marked with an asterisk (*). The nomenclature follows O. Karlsholt & J. Razowski (1996). The material is deposited in the Zoological Museum of Vilnius University. List of species ERIOCRANIIDAE Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839) Trak, Stirniai, 21 04 1996, 2 ♂ (R.K). TINEIDAE Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846) Šven, Klo čiūnai, 21 06 2000, 1 ♂ (R.K.). YPONOMEUTIDAE Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796) Jurb, Seredžius, 08 07 2002, 1 ♂ (R.K.). DEPRESSARIIDAE Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877) Viln, Daub ėnai, 10 05 2002, 1 spec.; Trak, Parais čiai, 07 05 1989, 1 spec. (R.K.). Agonopterix selini (Heinemann, 1870) Birž, Birž ų Giria f., 01 09 1998, 1 spec. (R.K.). SCYTHRIDIDAE Scythris sinensis (Felder et Regenhofer, 1875) Šal č, Senieji Maceliai, 02 06 1996, 1 spec. (R.K.). 48 NEW AND RARE FOR LITHUANIA INSECT SPECIES. -

Contribution to the Knowledge of the Fauna of Bombyces, Sphinges And
driemaandelijks tijdschrift van de VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE Afgiftekantoor 2170 Merksem 1 ISSN 0771-5277 Periode: oktober – november – december 2002 Erkenningsnr. P209674 Redactie: Dr. J–P. Borie (Compiègne, France), Dr. L. De Bruyn (Antwerpen), T. C. Garrevoet (Antwerpen), B. Goater (Chandlers Ford, England), Dr. K. Maes (Gent), Dr. K. Martens (Brussel), H. van Oorschot (Amsterdam), D. van der Poorten (Antwerpen), W. O. De Prins (Antwerpen). Redactie-adres: W. O. De Prins, Nieuwe Donk 50, B-2100 Antwerpen (Belgium). e-mail: [email protected]. Jaargang 30, nummer 4 1 december 2002 Contribution to the knowledge of the fauna of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the Southern Ural Mountains, with description of a new Dichagyris (Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) Kari Nupponen & Michael Fibiger [In co-operation with Vladimir Olschwang, Timo Nupponen, Jari Junnilainen, Matti Ahola and Jari- Pekka Kaitila] Abstract. The list, comprising 624 species in the families Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae and Arctiidae from the Southern Ural Mountains is presented. The material was collected during 1996–2001 in 10 different expeditions. Dichagyris lux Fibiger & K. Nupponen sp. n. is described. 17 species are reported for the first time from Europe: Clostera albosigma (Fitch, 1855), Xylomoia retinax Mikkola, 1998, Ecbolemia misella (Püngeler, 1907), Pseudohadena stenoptera Boursin, 1970, Hadula nupponenorum Hacker & Fibiger, 2002, Saragossa uralica Hacker & Fibiger, 2002, Conisania arida (Lederer, 1855), Polia malchani (Draudt, 1934), Polia vespertilio (Draudt, 1934), Polia altaica (Lederer, 1853), Mythimna opaca (Staudinger, 1899), Chersotis stridula (Hampson, 1903), Xestia wockei (Möschler, 1862), Euxoa dsheiron Brandt, 1938, Agrotis murinoides Poole, 1989, Agrotis sp. -
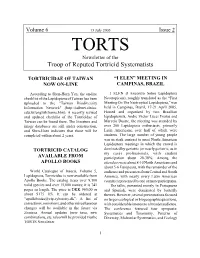
TORTS Newsletter of the Troop of Reputed Tortricid Systematists
Volume 6 13 July 2005 Issue 2 TORTS Newsletter of the Troop of Reputed Tortricid Systematists TORTRICIDAE OF TAIWAN “I ELEN” MEETING IN NOW ON-LINE CAMPINAS, BRAZIL According to Shen-Horn Yen, the on-line I ELEN (I Encontro Sobre Lepidoptera checklist of the Lepidoptera of Taiwan has been Neotropicais), roughly translated as the “First uploaded to the "Taiwan Biodiversity Meeting On The Neotropical Lepidoptera,” was Information Network" (http://taibnet.sinica. held in Campinas, Brazil, 17-21 April 2005. edu.tw/english/home.htm). A recently revised Hosted and organized by two Brazilian and updated checklist of the Tortricidae of lepidopterists, Andre Victor Lucci Freitas and Taiwan can be found there. The literature and Marcelo Duarte, the meeting was attended by image databases are still under construction, over 200 Lepidoptera enthusiasts, primarily and Shen-Horn indicates that those will be Latin Americans, over half of which were completed within about 2 years. students. The large number of young people _____________________________________ was in stark contrast to most North American Lepidoptera meetings in which the crowd is TORTRICID CATALOG dominated by geriatric (or nearly geriatric, as in my case) professionals, with student AVAILABLE FROM participation about 20-30%. Among the APOLLO BOOKS attendees were about 8-10 North Americans and about 5-6 Europeans, with the remainder of the World Catalogue of Insects, Volume 5, audience and presenters from Central and South Lepidoptera, Tortricidae is now available from America, with nearly every Latin American Apollo Books. The catalog treats over 9,100 country represented by one or more participants. valid species and over 15,000 names; it is 741 The talks, presented mostly in Portuguese pages in length. -

Diversity of the Moth Fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a Wetland Forest: a Case Study from Motovun Forest, Istria, Croatia
PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61 VOL. 117, No 3, 399–414, 2015 CODEN PDBIAD DOI: 10.18054/pb.2015.117.3.2945 ISSN 0031-5362 original research article Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia Abstract TONI KOREN1 KAJA VUKOTIĆ2 Background and Purpose: The Motovun forest located in the Mirna MITJA ČRNE3 river valley, central Istria, Croatia is one of the last lowland floodplain 1 Croatian Herpetological Society – Hyla, forests remaining in the Mediterranean area. Lipovac I. n. 7, 10000 Zagreb Materials and Methods: Between 2011 and 2014 lepidopterological 2 Biodiva – Conservation Biologist Society, research was carried out on 14 sampling sites in the area of Motovun forest. Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia The moth fauna was surveyed using standard light traps tents. 3 Biodiva – Conservation Biologist Society, Results and Conclusions: Altogether 403 moth species were recorded Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia in the area, of which 65 can be considered at least partially hygrophilous. These results list the Motovun forest as one of the best surveyed regions in Correspondence: Toni Koren Croatia in respect of the moth fauna. The current study is the first of its kind [email protected] for the area and an important contribution to the knowledge of moth fauna of the Istria region, and also for Croatia in general. Key words: floodplain forest, wetland moth species INTRODUCTION uring the past 150 years, over 300 papers concerning the moths Dand butterflies of Croatia have been published (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). -

その他の昆虫類 Other Miscellaneous Insects 高橋和弘 1) Kazuhiro Takahashi
丹沢大山総合調査学術報告書 丹沢大山動植物目録 (2007) その他の昆虫類 Other Miscellaneous Insects 高橋和弘 1) Kazuhiro Takahashi 要 約 今回の目録に示した各目ごとの種数は, 次のとおりである. カマアシムシ目 10 種 ナナフシ目 5 種 ヘビトンボ目 3 種 トビムシ目 19 種 ハサミムシ目 5 種 ラクダムシ目 2 種 イシノミ目 1 種 カマキリ目 3 種 アミメカゲロウ目 55 種 カゲロウ目 61 種 ゴキブリ目 4 種 シリアゲムシ目 13 種 トンボ目 62 種 シロアリ目 1 種 チョウ目 (ガ類) 1756 種 カワゲラ目 52 種 チャタテムシ目 11 種 トビケラ目 110 種 ガロアムシ目 1 種 カメムシ目 (異翅亜目除く) 501 種 バッタ目 113 種 アザミウマ目 19 種 凡 例 清川村丹沢山 (Imadate & Nakamura, 1989) . 1. 本報では、 カゲロウ目を石綿進一、 カワゲラ目を石塚 新、 トビ ミヤマカマアシムシ Yamatentomon fujisanum Imadate ケラ目を野崎隆夫が執筆し、 他の丹沢大山総合調査報告書生 清川村丹沢堂平 (Imadate, 1994) . 物目録の昆虫部門の中で諸般の事情により執筆者がいない分類 群について,既存の文献から,データを引用し、著者がまとめた。 文 献 特に重点的に参照した文献は 『神奈川県昆虫誌』(神奈川昆虫 Imadate, G., 1974. Protura Fauna Japonica. 351pp., Keigaku Publ. 談話会編 , 2004)※である. Co., Tokyo. ※神奈川昆虫談話会編 , 2004. 神奈川県昆虫誌 . 1438pp. 神 Imadate, G., 1993. Contribution towards a revision of the Proturan 奈川昆虫談話会 , 小田原 . Fauna of Japan (VIII) Further collecting records from northern 2. 各分類群の記述は, 各目ごとに分け, 引用文献もその目に関 and eastern Japan. Bulletin of the Department of General するものは, その末尾に示した. Education Tokyo Medical and Dental University, (23): 31-65. 2. 地名については, 原則として引用した文献に記されている地名 Imadate, G., 1994. Contribution towards a revision of the Proturan とした. しがって, 同一地点の地名であっても文献によっては異 Fauna of Japan (IX) Collecting data of acerentomid and なった表現となっている場合があるので, 注意していただきたい. sinentomid species in the Japanese Islands. Bulletin of the Department of General Education Tokyo Medical and Dental カマアシムシ目 Protura University, (24): 45-70. カマアシムシ科 Eosentomidae Imadate, G. & O. Nakamura, 1989. Contribution towards a revision アサヒカマアシムシ Eosentomon asahi Imadate of the Proturan Fauna of Japan (IV) New collecting records 山 北 町 高 松 山 (Imadate, 1974) ; 清 川 村 宮 ヶ 瀬 (Imadate, from the eastern part of Honshu. -

Lepidoptera: Macroheterocera) Fauna of the Aggtelek National Park
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Debrecen Electronic Archive LONG-TERM LIGHT TRAP STUDY ON THE MACRO-MOTH FAUNA OF THE AGGTELEK NP SZABÓ, S., ÁRNYAS, E., TÓTHMÉRÉSZ, B. & VARGA, Z. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (3), pp. 00–00, 2007 LONG-TERM LIGHT TRAP STUDY ON THE MACRO-MOTH (LEPIDOPTERA: MACROHETEROCERA) FAUNA OF THE AGGTELEK NATIONAL PARK S. SZABÓ1, E. ÁRNYAS1, B. TÓTHMÉRÉSZ2 and Z. VARGA1 1Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, University of Debrecen H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary; E-mail: [email protected] 2Department of Ecology, University of Debrecen, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary E-mail: [email protected] We analyzed the night-active Macrolepidoptera fauna in the Aggtelek karst region (near the village Jósvafő) by Jermy-type light-trap in 1990, 1993 and during 1999–2004. In each year the trap operated from 5 March until 5 November. During the eight years altogether 127 929 specimens were collected belonging to 594 species, which is about 60% of the Hungarian fauna. 216 species occurred in each year. Noctuidae and Geometridae were most rich in spe- cies and most abundant. Arctiidae, Lasiocampidae, Notodontidae and Sphingidae were also represented in a considerable proportion. The analysis of the flight activity curves shows two summer peaks and also a smaller spring and an autumn peak. The faunal type composition of the species and their abundance, respectively, was the following: Transpalearctic (48.15%, 55.68%), Boreo Continental (18.86, 8.16%), South Continental (2.02%, 0.67%), West Palae- arctic (28.96%, 35.14%), Xeromontane (1.01%, 0.05%) and Extrapalaearctic (1.01%, 0.31%). -

Arvernsis 85-86
ISSN 1955-0804 Bulletin de l’Association entomologique d’Auvergne N° 85- 86 1e semestre 2019 arvernsis Bulletin de l’Association entomologique d’Auvergne (A.E.A) ISSN 1955-0804 (imprimé) ISSN_2678-3037 (en ligne) Siège social : 57, rue de Gergovie 63170 Aubière Cotisation 2018 : 20 € donnant droit à la revue. Président : François Fournier, 25, rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand Secrétaire : Philippe Bachelard, Le Monteillet 63210 Olby Trésorier : Bruno Serrurier, l’Hermitage, La Colombière 19110 Bort-les–Orgues. Réunions mensuelles le dernier vendredi du mois de 18 heures à 20 heures au siège de la Société d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny 57, rue Gergovie, Aubière. arvernsis 2019, N° 85-86 Observations d’insectes sur la neige dans les Monts Dore (Puy-de-Dôme) en février-mars 2019. par François FOURNIER 25 rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand [email protected] Résumé. – L’auteur relate l’observation d’insectes trouvés sur la neige en hiver 2019. Mots-clés. – Insecta, monts Dore, Puy-de-Dôme,neige. Keywords. – Insecta, monts Dore, Puy-de-Dôme,Snow. Introduction Les mois de février et mars 2019 ont été l‘objet de quelques jours par- ticulièrement bien ensoleillés. Mon intérêt pour les promenades en ski m’ont permis d’observer quelques insectes sur la neige à des dates où peu d’en- tomologistes prospectent. Ma compétence étant limitée aux lépidoptères les déterminations ont été confiées à mes amis entomologistes compétents en la matière et je les en remercie. Mes données seront intégrées à la base INPN. PLECOPTERA Taeniopterygidae Taeniopteryx schoenemundi Mertens, 1923 Commune de Chambon-sur-Lac vers le col de la croix Saint-Robert 1350 m 25/02/2019. -
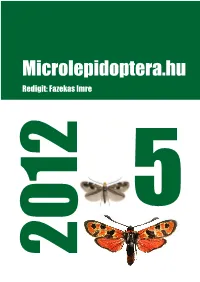
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Entomologiske Meddelelser
Entomologiske Meddelelser BIND 60 KØBENHAVN 1992 Indhold - Contents Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen: Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes .................... 117 Buhl, 0., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera) Records of Microlepidoptera from Denmark in 1990 . ............................ Buh!, 0., P. Falck, B.Jørgensen, O. Karshol t & K. Larsen: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera) Records oj Microlepidopterafrom Denmark in 1991 .............................. 101 Fibiger, M.: Diarsia rubi (Vieweg, 1790) og D.florida (Schmidt, 1859), to selvstændige arter (Lepidoptera, N octuidae) Diarsia rubi (Vieweg, 1790) and D. florida (Schmidt, 1859), two dislinet species . 61 Godske, L.: Aphids in nests of Lasiusflavus F. in Denmark. II. Population dynamics (Aphidoidea, Anoeciidae & Pemphigidae; Hymenoptera, Formicidac) . 21 Gønget, H.: Om spidsmussnudebillerne Apion (Catapion) seniculus Kirby og A. (C.) meieri Desbrochers des Loges i Danmark (Coleoptera, Apionidae) On Apion (Catapion) seniculus Kirby and A. (C.) meieri Desbrochers des Loges in Denmark . 111 Hansen, M.: Vandkæren n Berosus spinosusa - to arter i Danmark (Coleoptera, H ydrophilidae) The water scavenger beetle » Berosus spinosus« two species in Denmark . 65 Hansen, M., S. Kristensen, V. Mahler &J. Pedersen: 11. tillæg til "fortegnelse over Danmarks biller« (Coleoptera) 11th supplement to the list of Danish Coleoptera . 69 Heda!, S. & S. C. Schmidt: Om forekomsten af porcelænsmøllet Acentria ephemerella (Den. & Schiff.) i nogle danske fjorde (Lepidoptera, Pyralidae) On the occurrence of Acentria ephemerella (Den. & Schiff) in same Danishjjords . 17 Jensen, A., V. Mahler & M. Hansen: To nye danske biller i en brændt mose i Sønder jylland (Coleoptera, Staphylinidae & Cryptophagidae) Two new Danish beetles in a burntfen in Southjutland.. -

Insecta Norvegiae Can Be Considered As a Supplement to Fauna Norvegica Ser
ISSN 0800-1790 INSECTA No. NORVEGIAE 5 Atlas of the Lepidoptera ~- - of Norway. ~. "._-"~~~'- Part 1. --..-..--. Gelechioidea: Oecophoridae, Agonoxenidae, Batrachedridae, Momphidae, Cosmopterigidae, Scythridae, Blastobasidae. by Lelf Aarvik, Svein Svendsen, Yngvar Berg, Kai Berggren & Lars Ove Hansen Norsk Entomologisk Forening 1994 nsecta Norvegiae Editors: Trond Andersen and Uta Greve Zoological Museum, University of Bergen, Museplass 3, N-S007 Bergen Insecta Norvegiae can be considered as a supplement to Fauna norvegica Ser. B., and appears irregularly. The journal pUblishes information relevant to Norwegian entomology and emphasizes papers which are mainly faunistical or zoogeographical in scope or content, including catalogues, distribution maps, checklists and larger faunal lists. Biographies, bibliographies etc. will also be considered. Submissions must not have been previously pUblished or copyrighted and must not be published sUbsequently except in abstract form or by written consent of the editors. Authors are requested to contact the editors prior to submission. The Norwegian Entomological Society promotes the study of the Norwegian Insect fauna and forms a link between interested persons. Questions about membership should be directed to the Norwegian Entomological SOCiety, P.O. Box 376, N-1371 Asker, Norway. Membership fee NOK. 130.- should be paid to the Treasurer of NEF: Preben Ottesen. Gustav Vigelands vei 32, 0274 Oslo. Insecta Norveglae is distributed by the Norwegian Entomological Society. Other series Issued by the Society: - Fauna norvegica Ser. B - Insekt-Nytt - Norske Insekttabeller Layout & pasteup: Trond Andersen & Lars Ove Hansen Front page: Agonopterlx broennoeensis (Strand, 1920) Nini Aarvik del. Printed in 500 copies. A. Sand trykken, 2050 Jesshelm Atlas of the Lepidoptera of Norway. Part 1. -

Data to the Knowledge of the Macrolepidoptera Fauna of the Sălaj-Region, Transylvania, Romania (Arthropoda: Insecta)
Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii Vol. 26 supplement 1, 2016, pp.59- 74 © 2016 Vasile Goldis University Press (www.studiauniversitatis.ro) DATA TO THE KNOWLEDGE OF THE MACROLEPIDOPTERA FAUNA OF THE SĂLAJ-REGION, TRANSYLVANIA, ROMANIA (ARTHROPODA: INSECTA) Zsolt BÁLINT*, Gergely KATONA, László RONKAY Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum ABSTRACT. We provide 984 data of 88 collecting events originating from the Sălaj-region of western Transylvania, Romania. These have been assembled in the period between 22. April, 2014 and 10. September, 2015. Geographical, spatial and temporal records to the knowledge of 98 butterflies (Papilionoidea) and 225 moths (Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Noctuoidea and Sphingoidea) are given representing the families (species numbers in brackets) Hesperiidae (8), Lycaenidae (28), Nymphalidae (28), Papilionidae (3), Pieridae (13) Riodinidae (1), Satyridae (17) (Papilionoidea); Arctiidae (11), Ctenuchidae (1), Lymantriidae (1), Noctuidae (119), Nolidae (2), Notodontidae (6) Thyatiridae (4), (Noctuoidea); Drepanidae (3) (Drepanoidea); Geometridae (73) (Geometroidea); Lasiocampidae (2), Saturniidae (1) (Bombycoidea); Sphingidae (2) (Sphingoidea). According to the most recent catalogue of the Romanian Lepidoptera fauna 31 species proved to be new for the region Sălaj. The following 43 species have faunistical interest, therefore they are briefly annotated: Agrochola humilis, Agrochola laevis, Aplocera efformata, Aporophila lutulenta, Atethmia centrago, Bryoleuca -

Haarstrangwurzeleule (Gortyna Borelii)
HESSEN-FORST Artensteckbrief Haarstrangwurzeleule (Gortyna borelii) Stand: 2005 weitere Informationen erhalten Sie bei: Hessen-Forst FENA Naturschutz Europastraße 10 - 12 35394 Gießen Tel.: 0641 / 4991-264 E-Mail: [email protected] Artensteckbrief Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii Pierret 1837 FFH-Richtlinie Anhänge II und IV Foto: M. Ernst, Darmstadt Bearbeitung: Dr. Mathias Ernst Regierungspräsidium Darmstadt Wilhelminenstraße 1 – 3 64278 Darmstadt 3 1. Allgemeines Im Zuge der Beitrittsverhandlungen zur EU- Osterweiterung wurden von den Beitrittsländern zahlreiche Arten und Lebensraumtypen zur Novellierung der Anhänge der FFH-Richtlinie vorgeschlagen. Die Entscheidung über die Neuaufnahme von Arten und Lebensraumtypen wurde von Seiten der bestehenden Mitgliedsstaaten davon abhängig gemacht, dass aus den Neuvorschlägen keine zusätzlichen Verpflichtungen in Form weiterer Nachmeldung von Gebieten entstehen. Daher wurden zum größten Teil nur Arten und Lebensraumtypen genannt, die ausschließlich in den neuen EU-Staaten vorkommen. In wenigen Fällen sind aber auch Arten und Lebensraumtypen betroffen, die in der gesamten Europäischen Union verbreitet sind (BALZER et al. 2004). Zu den 167 Arten, die neu in den Anhang II der FFH-Richtlinie aufgenommen wurden, kommen 20 Arten auch in Deutschland vor. Unter diesen Arten befindet sich die Haarstrangwurzeleule (Gortyna borelii lunata Pierret 1837 = Hydraecia leucographa Bkh). Die typische Form der Haarstrangwurzeleule ( Gortyna borelii Pierret 1837) fliegt nach FORSTER & WOHLFAHRT (1980) in Westeuropa. Sie wurde von LeCerf 1926 für das Pariser Becken beschrieben, und lebt dort an Peucedanum gallicum. Die in Mitteleuropa lebenden Populationen wurden als Gortyna borelii ssp. lunata Freyer 1838 benannt. EBERT (1998) bezeichnet die Unterteilung der Art in Subspezies als wenig überzeugend, weil allein die Größe der Falter als Unterscheidungsmerkmal nicht ausreichend erscheint.