Lili Marleen“ Ist Noch Heute Ein Mysterium
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
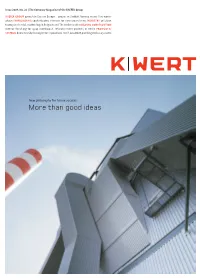
More Than Good Ideas KAEFER 2004
Issue 2004, No. 22 | The Company Magazine of the KAEFER Group KAEFER GROUP growth in Eastern Europe – project in Snøhvit Norway enters first winter phase SHIPBUILDING sophisticated interiors for river cruise liners INDUSTRY cellulose factory in Stendal, scaffolding in Belgium and The Netherlands BUILDING CONSTRUCTION interior finishing for quay storehouse, refurbishment projects in Berlin PRODUCTS/ SYSTEMS bemo Brandschutzsysteme repositions itself, LOLAMAT paneling for luxury suites New philosophy for future success: More than good ideas KAEFER 2004 May 2004 IMM in Garmisch-Partenkirchen DEC ’03 JAN ’04 FEB ’04 MAR ’04 APR ’04 MAY ’04 Spring 2004 Storehouse XI in Bremen, a large refurbishment project with interior finishing Spring 2004 large project at Total refinery in Leuna March 2004 start-up of largest contract in KAEFER’s history, the Snøhvit LNG plant in Norway December 2003 KAEFER acts as general ontractor for shipowners May 2004 and shipyards; complete KAEFER Schiffbau GmbH interior design for ships is founded in Bremen July 2004 Jörn M. Fetköter named new managing September 2004 director for domestic operations Soccer Cup in Bremen KAEFER-GRUPPE/KAEFER GROUP JUN ’04 JUL ’04 AUG ’04 SEP ’04 OCT ’04 NOV ’04 November 2004 Summer 2004 October 2004 tunnel robot tackles extensive interior finishing work at renovation projects, two projects in 2004 BAU/CONSTRUCTION Bad Sauerbrunn health resort in Austria Open House, Parc du Bois in Potsdam October 2004 cellulose factory in Stendal ready for operation June 2004 December 2004 new Internet -

War: How Britain, Germany and the USA Used Jazz As Propaganda in World War II
Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Studdert, Will (2014) Music Goes to War: How Britain, Germany and the USA used Jazz as Propaganda in World War II. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent. DOI Link to record in KAR http://kar.kent.ac.uk/44008/ Document Version Publisher pdf Copyright & reuse Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder. Versions of research The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version. Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the published version of record. Enquiries For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact: [email protected] If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html Music Goes to War How Britain, Germany and the USA used Jazz as Propaganda in World War II Will Studdert Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in History University of Kent 2014 Word count (including footnotes): 96,707 255 pages Abstract The thesis will demonstrate that the various uses of jazz music as propaganda in World War II were determined by an evolving relationship between Axis and Allied policies and projects. -

Persecution, Collaboration, Resistance
Münsteraner Schriften zur zeitgenössischen Musik 5 Ina Rupprecht (ed.) Persecution, Collaboration, Resistance Music in the ›Reichskommissariat Norwegen‹ (1940–45) Münsteraner Schrift en zur zeitgenössischen Musik Edited by Michael Custodis Volume 5 Ina Rupprecht (ed.) Persecution, Collaboration, Resistance Music in the ‘Reichskommissariat Norwegen’ (1940–45) Waxmann 2020 Münster x New York The publication was supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft , the Grieg Research Centre and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster as well as the Open Access Publication Fund of the University of Münster. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek Th e Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografi e; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de Münsteraner Schrift en zur zeitgenössischen Musik, Volume 5 Print-ISBN 978-3-8309-4130-9 E-Book-ISBN 978-3-8309-9130-4 DOI: https://doi.org/10.31244/9783830991304 CC BY-NC-SA 4.0 Waxmann Verlag GmbH, 2020 Steinfurter Straße 555, 48159 Münster www.waxmann.com [email protected] Cover design: Pleßmann Design, Ascheberg Cover pictures: © Hjemmefrontarkivet, HA HHI DK DECA_0001_44, saddle of sources regarding the Norwegian resistance; Riksarkivet, Oslo, RA/RAFA-3309/U 39A/ 4/4-7, img 197, Atlantic Presse- bilderdienst 12. February 1942: Th e newly appointed Norwegian NS prime minister Vidkun Quisling (on the right) and Reichskomissar Josef Terboven (on the left ) walking along the front of an honorary -

The Rita Williams Popular Song Collection a Handlist
The Rita Williams Popular Song Collection A Handlist A wide-ranging collection of c. 4000 individual popular songs, dating from the 1920s to the 1970s and including songs from films and musicals. Originally the personal collection of the singer Rita Williams, with later additions, it includes songs in various European languages and some in Afrikaans. Rita Williams sang with the Billy Cotton Club, among other groups, and made numerous recordings in the 1940s and 1950s. The songs are arranged alphabetically by title. The Rita Williams Popular Song Collection is a closed access collection. Please ask at the enquiry desk if you would like to use it. Please note that all items are reference only and in most cases it is necessary to obtain permission from the relevant copyright holder before they can be photocopied. Box Title Artist/ Singer/ Popularized by... Lyricist Composer/ Artist Language Publisher Date No. of copies Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Dans met my Various Afrikaans Carstens- De Waal 1954-57 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Careless Love Hart Van Steen Afrikaans Dee Jay 1963 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Ruiter In Die Nag Anton De Waal Afrikaans Impala 1963 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Van Geluk Tot Verdriet Gideon Alberts/ Anton De Waal Afrikaans Impala 1970 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Wye, Wye Vlaktes Martin Vorster/ Anton De Waal Afrikaans Impala 1970 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs My Skemer Rapsodie Duffy -

Programm 2019
Das Festival Pop-Kultur Berlin ‚International Music‘ im Livekonzert Seite 3 2019 August Programm Denkfabrik 2 Editorial Inhalt Liebe Hörerinnen 2 Editorial und Hörer, 3 Aktuell Ein Statement für Vielfalt Recherchieren, Zuhören, Schreiben und Senden – im Live vom Festival Pop-Kultur Berlin Radio, auf unseren Webseiten und allen digitalen Wegen – 4 Musik das sind unsere Aufgaben, und die machen wir leiden- Lieblingsstücke. Zum 200. Deutschlandradio/ Bettina Fürst-Fastré © schaftlich gern für Sie. Wir nehmen Geschichten ernst, Geburtstag von Clara Schumann wir stellen uns Ihrem Echo und suchen den Dialog mit Menschen, die uns kri- Hanno Busch Trio tisch gegenüberstehen. 6 Programmverbreitung Etliche unserer Journalistinnen und Journalisten aber sind dauernd kon- Wie die Deutschlandradio- frontiert mit Anwürfen, Beschuldigungen und Attacken widerlichster Art. Programme zu Ihnen kommen Heute sind es nicht mehr die anonymen Briefeschreiber, sondern Vielschreiber, 7 Deutschlandfunk Nova die mal anonym, häufig aber auch mit vollem Namen ihren Hass und ihre Men- Die Sendung ‚Grünstreifen‘ schenverachtung über soziale Netzwerke verbreiten. Für die Betroffenen, für bei Deutschlandfunk Nova unsere Social Media Teams und den Hörerservice ist das oft sehr belastend. 8 Literatur Deshalb wehren wir uns, wenn strafrechtliche Grenzen überschritten sind, mit Lyriksommer Strafanzeigen. Das Netz ist ein Netz der Möglichkeiten, aber kein rechtsfreier Tage der Deutschsprachigen Literatur (TDDL) in Klagenfurt Raum. Und wir lassen uns nicht alles gefallen. Damit kein Missverständnis entsteht: Es geht mir nicht um scharfe Kritik, 10 Spezial einen wütenden Anruf, einen bösen Brief. Wir halten vieles aus. Meinungsfrei- Abstimmung Denkfabrik-Thema 2020 Buchempfehlungen in der heit ist für uns ein hohes Gut, und nicht in jeder Auseinandersetzung trifft man Dlf Audiothek immer den richtigen Ton. -

Machen Sie Mit Beim Partyspaß Aus Japan! TIPPS Für Sänger/Innen Und Publikum
Würden Sie gern mal wieder singen, trauen sich aber nicht? Sie haben Angst, Ihre Stimme klingt etwas dünn und sie treffen vielleicht nicht immer ganz genau den Ton? Die DISCO 84 bietet ihnen heute die Chance in die Rolle von Frank Sinatra, Whitney Houston, den Backstreet Boys oder Marianne Rosenberg zu schlüpfen und der Star des KARAOKE-Abends zu werden. Karaoke kommt aus dem Japanischen und heißt übersetzt „leeres Orchester“. Der Karaokestar singt auf der Bühne zum Playback des Titels. Er wird von einem Monitor unterstützt, der den Text wiedergibt und im entscheidenden Moment die Textfarbe synchron zur Musik wechselt und so die fehlende Textsicherheit gibt. Beispiel: The Beatles – Yellow Submarine Machen Sie mit beim Partyspaß aus Japan! TIPPS für Sänger/Innen und Publikum Nicht singen zu können ist noch lange kein Grund nicht zu singen. Wer sprechen kann, der kann auch singen Wer sagt, "ich kann nicht singen" lügt. Es liegt nicht an der fehlenden Stimme, sondern am fehlenden Mut. Singen ist einfach. Es wird nur etwas verkompliziert durch das Publikum, die Soundanlage, die Bühne, die Lichter... Es ist nicht schlimm, Fehler beim Singen zu machen ... solange du sie als Teil deiner Show integrierst. Die meisten Fehler beim Auftritt werden kaum wahrgenommen, Der einzige, der sie bemerkt, ist meistens nur der Sänger selbst. Singen bedeutet nicht Kommunikation zwischen Mund und Ohr, sondern zwischen Herz und Herz. Es ist nicht die Qualität der Stimme, die einen Auftritt erfolgreich macht, sondern der Ausdruck. Man muss nicht unbedingt den höchsten Ton des Songs erreichen, nur die Herzen der Zuschauer Jeder Sänger sollte Applaus bekommen, wenn er super war, aber auch wenn er so schlecht war, dass ihr froh seid dass es vorbei ist. -

German Films Quarterly 2 · 2004
German Films Quarterly 2 · 2004 AT CANNES In Competition DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI by Hans Weingartner FULFILLING EXPECTATIONS Interview with new FFA CEO Peter Dinges GERMAN FILM AWARD … and the nominees are … SPECIAL REPORT 50 Years Export-Union of German Cinema German Films and IN THE OFFICIAL PROGRAM OF THE In Competition In Competition (shorts) In Competition Out of Competition Die Fetten Der Tropical Salvador Jahre sind Schwimmer Malady Allende vorbei The Swimmer by Apichatpong by Patricio Guzman by Klaus Huettmann Weerasethakul The Edukators German co-producer: by Hans Weingartner Producer: German co-producer: CV Films/Berlin B & T Film/Berlin Thoke + Moebius Film/Berlin German producer: World Sales: y3/Berlin Celluloid Dreams/Paris World Sales: Celluloid Dreams/Paris Credits not contractual Co-Productions Cannes Film Festival Un Certain Regard Un Certain Regard Un Certain Regard Directors’ Fortnight Marseille Hotel Whisky Charlotte by Angela Schanelec by Jessica Hausner by Juan Pablo Rebella by Ulrike von Ribbeck & Pablo Stoll Producer: German co-producer: Producer: Schramm Film/Berlin Essential Film/Berlin German co-producer: Deutsche Film- & Fernseh- World Sales: Pandora Film/Cologne akademie (dffb)/Berlin The Coproduction Office/Paris World Sales: Bavaria Film International/ Geiselgasteig german films quarterly 2/2004 6 focus on 50 YEARS EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 22 interview with Peter Dinges FULFILLING EXPECTATIONS directors’ portraits 24 THE VISIONARY A portrait of Achim von Borries 25 RISKING GREAT EMOTIONS A portrait of Vanessa Jopp 28 producers’ portrait FILMMAKING SHOULD BE FUN A portrait of Avista Film 30 actor’s portrait BORN TO ACT A portrait of Moritz Bleibtreu 32 news in production 38 BERGKRISTALL ROCK CRYSTAL Joseph Vilsmaier 38 DAS BLUT DER TEMPLER THE BLOOD OF THE TEMPLARS Florian Baxmeyer 39 BRUDERMORD FRATRICIDE Yilmaz Arslan 40 DIE DALTONS VS. -

Schlager:Layout 1 26.06.2008 15:26 Uhr Seite 1
Schlager:Layout 1 26.06.2008 15:26 Uhr Seite 1 InhaltInhalt 1 Ein Stern, der deinen Namen trägt DJ Ötzi und Nik P. 2 Ich glaube an Gott Florian Silbereisen 3 Ich bin ich (Wir sind wir) Rosenstolz 4 Das Spiel Annett Louisan 5 Viva Colonia De Höhner 6 Du hast mich tausendmal belogen Andrea Berg 7 Guildo hat euch lieb Guildo Horn 8 Abenteuerland Pur 9 Verlieben, verloren, vergessen, verzeihn Wolfgang Petry 10 Verdammt, ich lieb dich Matthias Reim 11 Ohne dich Münchener Freiheit 12 Patrona Bavariae Original Naabtal Duo 13 Faust auf Faust Klaus Lage 14 An der Nordseeküste Klaus und Klaus 15 Dein ist mein ganzes Herz Heinz Rudolf Kunze 16 Für alle Wind 17 Männer Herbert Grönemeyer 18 Sonderzug nach Pankow Udo Lindenberg 19 Ein bißchen Frieden Nicole 20 99 Luftballons Nena Schlager:Layout 1 26.06.2008 15:26 Uhr Seite 2 21 Und ganz doll mich (Ich mag) Rolf Zuckowski 22 Dich zu lieben Roland Kaiser 23 Moskau Dschinghis Khan 24 Das Lied der Schlümpfe Vader Abraham und die Schlümpfe 25 Über sieben Brücken musst du gehn Karat 26 Ti amo Howard Carpendale 27 Die kleine Kneipe Peter Alexander 28 Und es war Sommer Peter Maffay 29 Er gehört zu mir Marianne Rosenberg 30 Über den Wolken Reinhard Mey 31 Theo, wir fahr’n nach Lodz Vicky Leandros 32 Tränen lügen nicht Michael Holm 33 Griechischer Wein Udo Jürgens 34 Du hast den Farbfilm vergessen Nina Hagen 35 Der Junge mit der Mundharmonika Bernd Clüver 36 Einm Festival der Liebe Jürgen Marcus 37 Fiesta Mexicana Rex Gildo 38 Am Tag, als Conny Kramer starb Juliane Werding 39 Blau blüht der Enzian Heino 40 Ein -

ESC-Gewinnerin 2018 Fotograf: Daniel Kaminsky Druck Und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen
Jahrbuch Sexualitäten 2019 Herausgegeben im Auftrag der Initiative Queer Nations von Janin Afken, Jan Feddersen, Benno Gammerl, Rainer Nicolaysen und Benedikt Wolf Sonderdruck Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2019 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Aldus Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf Umschlagfoto: Netta Barzilai, ESC-Gewinnerin 2018 Fotograf: Daniel Kaminsky Druck und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen ISBN 978-3-8353-3525-7 ISSN 2509-2871 Queeres Weltkulturerbe Wie der Eurovision Song Contest ein schwules Ereignis globalen Profils wurde* Jan Feddersen »Nur die Liebe lässt uns leben« – oder: ein Disclaimer1 Autobiografisch gefärbt ist dieser Text über die Präsenz, ja, Dominanz schwuler Männer beim Eurovision Song Contest (ESC) – nicht auf der Bühne, aber hinter den Kulissen, bei Journalisten und Fans – notwendi- gerweise. Dies muss hier auch so sein, denn die Entwicklung des ESC vom televisionär in der Bundesrepublik eher unbeachteten Millionenereignis zum Highlight des TV-Jahreskalenders auch in Deutschland der für diese Show verantwortlichen ARD ist von mir als Journalist beobachtet – und faktisch mit befördert worden. Insofern entspricht dieser Aufsatz nicht gewöhnlichen Ansprüchen, die an einen in einer wissenschaftlichen Zeit- schrift veröffentlichten Text zu stellen sind: der des Überblicks und der Analyse, also der Sortierung des Diskurses zu einem Sachverhalt, der, beim ESC, vornehmlich ums Singen und Performen, ums Angucken und Bewerten geht, um Europa und Nationalitäten und dergleichen, nicht je- doch um im engeren Sinne Sexuelles. Erstmals habe ich 1989 einen Text über den ESC veröffentlichen können,2 eine Rezension des Grand Prix Eurovision de la Chanson, der ein * Eine frühe Queer Lecture zum Thema fand am 21. -

Portland • Oregon
AMICAMICAA 20032003 PORPORTLTLANDAND •• OREGOOREGONN The AMICA BULLETIN AUTOMATIC MUSICAL INSTRUMENT COLLECTORS’ ASSOCIATION JANUARY/FEBRUARY 2003 VOLUME 40, NUMBER 1 THE AMICA BULLETIN AUTOMATIC MUSICAL INSTRUMENT COLLECTORS' ASSOCIATION Published by the Automatic Musical Instrument Collectors’ Association, a non-profit, tax exempt group devoted to the restoration, distribution and enjoyment of musical instruments using perforated paper music rolls and perforated music books. AMICA was founded in San Francisco, California in 1963. ROBIN PRATT, PUBLISHER, 630 EAST MONROE ST., SANDUSKY, OH 44870-3708 -- Phone 419-626-1903, e-mail: [email protected] Visit the AMICA Web page at: http://www.amica.org Associate Editor: Mr. Larry Givens VOLUME 40, Number 1 January / February 2003 AMICA BULLETIN Display and Classified Ads FEATURES Articles for Publication Letters to the Publisher A Grand Event — 10 Chapter News AMICA - Italy— 11 Upcoming Publication DEADLINES Pseudonym’s — 12 The ads and articles must be received Oliver Denton — 13 by the Publisher on the 1st of the Odd number months: Coenraad V. Bos — 14 January July March September Chickering Pianoforte Manufactory — 22 May November Carry On — 30 Bulletins will be mailed on the 1st week of the even months. Letter from Mrs. Bartier — 31 Robin Pratt, Publisher Convention — 33 630 East Monroe Street Sandusky, Ohio 44870-3708 Phone: 419-626-1903 e-mail: [email protected] DEPARTMENTS AMICA International — 2 MEMBERSHIP SERVICES President’s Message — 3 New Memberships . $42.00 From the Publisher’s Desk — 3 Renewals . $42.00 Calendar of Events — 4 Additional $5.00 due if renewed past the Jan. 31 deadline Letters —5 Address changes and corrections Tech Tips —32 Directory information updates Chapter News — 38 Additional copies of Classified Ads — 50 Member Directory . -

Zeitgeschichte Im Spiegel Eines Liedes
435 ' C t WILHELM SCHEPPING Aachen/Neimö ,E F ZEITGESCHICHTE IM SPIEGEL EINES LIEDES . Der Fall LLU McutEeen - Versuch einer Sumiierung - E i: I;t Vorbemerkungen Auf der Arbeitstagung 1978 der bis zum Jahre 1982 von ERNST KLUSEN geleiteten :" DGV-Kommission für Lied-, Tanz- und Musikforschung in Bremen wies Verfasser zum ersten Mal auf die Bedeutung des Liedes LLU Moutteen für die Liedforschung hin (Schepping 1979, 75 ff.) und belegte an diesem Paradigma den eminenten Einfluß, den die elektronischen Medien auf die Liedrezeption und die Sing- aktivität haben können. Zugleich war dieses Lied - u.a. auch aufgrund eines aktuellen Vorfalls in Jugoslawien (Verhaftung, Ausweisung und Geldbuße für 9 österreichische Campingurlauber, weil siediesesals nazUtUeh verurteilte Lied im Sommer 1978 in Jugoslawien zusammen mit kanadischen Urlaubern in einem GartencafC auf der Insel Korcula gesungen hatten) - Exempel für die außergewöhnliche Bedeutung, die ein Lied im Leben und auf das Leben be- stimmter Menschen und Zeiten gewinnen kann. Ein Jahr später nahm Verfasser dieses Thema erneut auf (Schepping, ad margi- nein 1979), um anhand einiger Belege der Wirkungsgeschichte dieses Liedes LAU Mamteui im Kriegs- und Nachkriegseuropa die Notwendigkeit einer Um- orientierung der Liedforschung von der Liedmonographie älteren Typs zu einer neuen Art der Liedbiogmphie darzulegen. Die Liedbiographie wurde dabei ver- standen als Aufzeichnung des LiedEebem, d.h. der Wechselbeziehungen eines konkreten Liedes zu bestimten Menschen und zur Zeitgeschichte. Bei dieser Gelegenheit wurde auch auf die Notwendigkeit der ständigen Fowüeheibung solcher Liedbiographien hingewiesen, die daraus resultiert, daß die Lied- existenz, das Liedleben ja ggf. unbegrenzt fortdauern kann, sich also ständig neue 1iedbiographische Daten und Fakten ergeben können, deren Ermittlung aber oftmals - wie auch hier Z.T. -

Deutsches Musicalarchiv: Sammlung Klaus Baberg, SMA 0002 Stand: 19.09.2017
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Zentrum für Populäre Kultur und Musik Titelblat Deutsches Musicalarchiv: Sammlung Klaus Baberg, SMA 0002 Stand: 19.09.2017 Deutsches Musicalarchiv: Sammlung Klaus Baberg SMA 0002 Umfang: 5 kleine, 7 große Archivboxen; eine Archivbox in Übergröße; ca. 15 Regalmeter mit Programmheften, Leitz-Ordnern und Einzelmappen; ca. 8 Regalmeter mit Tonträgern. Inhalt: Material zu Musicalaufführungen, v. a. deutschsprachige, der 1970er- bis 2010er Jahre: gut 1000 Programmhefte, Werbeflyer und Presseberichte, 1117 Plakate, rund 200 Fachbücher, Musik- und Filmaufnahmen (362 CDs, 13 DVDs, 26 + 89 Tonkasseten, 32 Videokasseten, 409 Langspielplaten, 23 Singles), Texthefte, Fotos, PR-Material, einzelne Fachzeitschriften. Herkunft: Klaus Baberg hate seine ersten Berührungen mit dem Musical durch die Opereten- und Musical- Fernsehfilme in den 1960er Jahren. Seit 1979 sammelte er intensiv Programmhefte und Programme von Musicals. Verschiedene Exponate aus seiner Sammlung waren auf Ausstellungen zu sehen. Klaus Baberg ist Vorstandsmitglied im 2011 gegründeten Förderverein des Deutschen Musicalarchivs „Freunde und Förderer des Deutschen Musicalarchivs e.V.“ Baberg ist seit 1980 bei der Sparkasse Iserlohn beschäftigt. Hinweis: Der größte Teil der Bestände ist in diesem Dokument erschlossen. Die Bücher und das Notenmaterial der Sammlung sind im Bibliothekskatalog des ZPKM nachgewiesen (Recherche: Eingabe "abl: sbab" in den Suchschlitz). Die Musicalplakate der Sammlung Baberg wurden separiert und werden mit anderen Graphiken aufbewart.