Dissertation / Doctoral Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Repüléstudományi Közlemények
Matyas Palik, Máté Nagy BRIEF HISTORY OF UAV DEVELOPMENT DOI: 10.32560/rk.2019.1.13 In this article, the authors present the technical development of the drones from the beginning to the present. The reader will get to know the most important periods and events of the drone's military application. At the end of the article, the authors summarize the four main purposes of military use of drones. Keywords: Flying Bomb, Pilotless Target Aircraft, Unmanned Aerial Vehicle, UAV, drone INTRODUCTION The human’s desire to fly high in the sky emerged as early as its common sense. However, it took a long time to make this dream real. A large number of scientists had worked on this topic and it had demanded so many brave people’s life, until finally men could ascend from the ground. By that, people’s enthusiasm towards the aviation led to success. At first they con- quered the air by balloons, later by airships, and finally with airplanes. Meanwhile, the idea to use a machine that can fly without a person on board has always been in the researchers mind. This idea is not surprising at all, because such a system’s advantages are obvious. We don’t have to count with the death of the on-board personnel, if the aircraft is destroyed for some reason. In addition, we can use them for such boring tasks, like aerial re- connaissance. Finally, their financial advantage is unquestionable, due to the fact, that in gen- eral a UAV’s1 price is lower than the price of a conventional aircraft. -

CRUISE MISSILE THREAT Volume 2: Emerging Cruise Missile Threat
By Systems Assessment Group NDIA Strike, Land Attack and Air Defense Committee August 1999 FEASIBILITY OF THIRD WORLD ADVANCED BALLISTIC AND CRUISE MISSILE THREAT Volume 2: Emerging Cruise Missile Threat The Systems Assessment Group of the National Defense Industrial Association ( NDIA) Strike, Land Attack and Air Defense Committee performed this study as a continuing examination of feasible Third World missile threats. Volume 1 provided an assessment of the feasibility of the long range ballistic missile threats (released by NDIA in October 1998). Volume 2 uses aerospace industry judgments and experience to assess Third World cruise missile acquisition and development that is “emerging” as a real capability now. The analyses performed by industry under the broad title of “Feasibility of Third World Advanced Ballistic & Cruise Missile Threat” incorporate information only from unclassified sources. Commercial GPS navigation instruments, compact avionics, flight programming software, and powerful, light-weight jet propulsion systems provide the tools needed for a Third World country to upgrade short-range anti-ship cruise missiles or to produce new land-attack cruise missiles (LACMs) today. This study focuses on the question of feasibility of likely production methods rather than relying on traditional intelligence based primarily upon observed data. Published evidence of technology and weapons exports bears witness to the failure of international agreements to curtail cruise missile proliferation. The study recognizes the role LACMs developed by Third World countries will play in conjunction with other new weapons, for regional force projection. LACMs are an “emerging” threat with immediate and dire implications for U.S. freedom of action in many regions . -

Desind Finding
NATIONAL AIR AND SPACE ARCHIVES Herbert Stephen Desind Collection Accession No. 1997-0014 NASM 9A00657 National Air and Space Museum Smithsonian Institution Washington, DC Brian D. Nicklas © Smithsonian Institution, 2003 NASM Archives Desind Collection 1997-0014 Herbert Stephen Desind Collection 109 Cubic Feet, 305 Boxes Biographical Note Herbert Stephen Desind was a Washington, DC area native born on January 15, 1945, raised in Silver Spring, Maryland and educated at the University of Maryland. He obtained his BA degree in Communications at Maryland in 1967, and began working in the local public schools as a science teacher. At the time of his death, in October 1992, he was a high school teacher and a freelance writer/lecturer on spaceflight. Desind also was an avid model rocketeer, specializing in using the Estes Cineroc, a model rocket with an 8mm movie camera mounted in the nose. To many members of the National Association of Rocketry (NAR), he was known as “Mr. Cineroc.” His extensive requests worldwide for information and photographs of rocketry programs even led to a visit from FBI agents who asked him about the nature of his activities. Mr. Desind used the collection to support his writings in NAR publications, and his building scale model rockets for NAR competitions. Desind also used the material in the classroom, and in promoting model rocket clubs to foster an interest in spaceflight among his students. Desind entered the NASA Teacher in Space program in 1985, but it is not clear how far along his submission rose in the selection process. He was not a semi-finalist, although he had a strong application. -

Ground Fatality Probability Model Sensitivity Analysis
Appendix A Ground Fatality Probability Model Sensitivity Analysis That is what we meant by science. That both question and answer are tied up with uncertainty, and that they are painful. But that there is no way around them. And that you hide nothing; instead, everything is brought out into the open. Peter Høeg (Borderliners, 1995) A.1 Background In Sect. 5.1.5, the following model was proposed to calculate the probability of fatality given a ground impact: | 1 P(fatality exposure)= 1 (A.1) β p 1 + α 4 s β Eimp In this Section a sensitivity analysis will be carried out to evaluate the effect of perturbations of the model inputs and parameters. Typically such an analysis assumes that model inputs and parameters are random variables. It is then possible to determine the joint distribution of these random variables and consequently the distribution of the model as a function of the characteristics of the random variables. Alternatively each parameter and input can be evaluated separately, considering the rest known. Assuming a function g(x) of a random variable x with a distribution function f (x), then its expected value of g(x) is given by [2]: +∞ E [g(x)] = g(x) f (x)dx (A.2) −∞ Using the expectation of g(x), it is possible to calculate the bias as: Bias[g(x)] = g(µ) − E [g(x)] (A.3) where µ is the true value of x, and the variance from: Var[g(x)] = E g2(x) − E [g(x)]2 (A.4) Nevertheless, the functional form of the model makes an analytical derivation of its expected value difficult, regardless of the assumed probability distribution functions for the parameters and input and whether they are considered separately or together. -
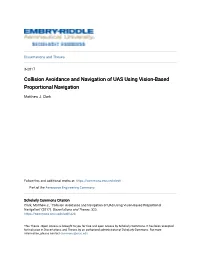
Collision Avoidance and Navigation of UAS Using Vision-Based Proportional Navigation
Dissertations and Theses 3-2017 Collision Avoidance and Navigation of UAS Using Vision-Based Proportional Navigation Matthew J. Clark Follow this and additional works at: https://commons.erau.edu/edt Part of the Aerospace Engineering Commons Scholarly Commons Citation Clark, Matthew J., "Collision Avoidance and Navigation of UAS Using Vision-Based Proportional Navigation" (2017). Dissertations and Theses. 323. https://commons.erau.edu/edt/323 This Thesis - Open Access is brought to you for free and open access by Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. COLLISION AVOIDANCE AND NAVIGATION OF UAS USING VISION-BASED PROPORTIONAL NAVIGATION A Thesis Submitted to the Faculty of Embry-Riddle Aeronautical University by Matthew J. Clark In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Aerospace Engineering March 2017 Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, Florida ACKNOWLEDGMENTS This work could not have been completed without the inspiration and guidance from Dr. Richard Prazenica. I am grateful for all his efforts in directing me through any obstacles encountered while allowing me to follow my own path (pun intended). I would also like to thank Dr. Hever Moncayo and Dr. Troy Henderson for their support as my advisory committee. I would like to acknowledge Dr. Heidi Steinhauer and the entire Engineering Fundamentals Department. It has been an absolute pleasure to work as a Graduate Teaching Assistant alongside a group I consider family. I would not have been able to complete this work without the emotional support of my family and friends. -

EW Concepts and Tactics for Single Or Multiple UAS Over the Net-Centric Battlefield
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 2009-09 General use of UAS in EW environment--EW concepts and tactics for single or multiple UAS over the net-centric battlefield Erdemli, Mustafa Gokhan. Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/4512 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS GENERAL USE OF UAS IN EW ENVIRONMENT—EW CONCEPTS AND TACTICS FOR SINGLE OR MULTIPLE UAS OVER THE NET-CENTRIC BATTLEFIELD by Mustafa Gokhan Erdemli Thesis Co-Advisors: Edward Fisher Wolfgang Baer Approved for public release; distribution is unlimited THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED September 2009 Master’s Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE General Use of UAS in EW Environment—EW 5. FUNDING NUMBERS Concepts and Tactics for Single or Multiple UAS over the Net-Centric Battlefield 6. AUTHOR(S) Mustafa Gokhan Erdemli 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. -

Aviation History and Unmanned Flight
Chapter 2 Aviation History and Unmanned Flight Heavier-than-air flying machines are impossible. Lord Kelvin, 1895 It is apparent to me that the possibilities of the aeroplane, . have been exhausted, and that we must turn elsewhere. Thomas Edison, 1895 Flight by machines heavier than air is unpractical and insignificant, if not utterly impossible. Simon Newcomb, 1902 This ‘pictorial’ Chapter presents a historical perspective on unmanned flight starting from the ancient times and reaching the beginning of the 21st Century. This is not aimed to be an exhaustive account of the history of neither aviation nor UAS. It is rather a glimpse of the stages of UAS evolution, complemented by an overview of the broad range of modern UAS sizes, types and capabilities, as well as, the large number of roles they are called upon to play. This will also put into perspective the daunting task of integrating all these different types of unmanned aircraft into an already crowded airspace. We believe that the best way to achieve this goal is through an account of key events and a series of photos. This Chapter is divided into four sections corresponding to different time periods and — to a degree — to a different concept of what an unmanned aircraft is. The first Section concerns the first flying machines of antiquity and the Renaissance. The second Section is devoted to the first designs of unmanned aircraft that led to target drones and cruise missiles; followed by a section on the developments of the Cold War era, when the focus on research and development turned to unmanned, airborne reconnaissance. -

Estación De Tierra Autónoma Para La Gestión De Telemetría En Vehículos Aéreos No Tripulados (Uavs)
Estación de tierra autónoma para la gestión de telemetría en Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs) PROYECTO FIN DE CARRERA Ingeniería Industrial, especialidad en Automática y Electrónica Realizado en Universitat Politècnica de València Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática Autor: Juan Enrique López Carcelén Director: Javier Sanchis Sáez Sergio García-Nieto Rodríguez Co-director: Basam Musleh Lancis Valencia, Junio de 2013 PFC – Estación de tierra autónoma para la gestión de telemetría en Vehículos Aéreos no Tripulados Este libro contiene los siguientes documentos: Memoria – pág. 8 Manual de Programación – pág.96 Manual de Usuario – pág. 127 2 PFC – Estación de tierra autónoma para la gestión de telemetría en Vehículos Aéreos no Tripulados AGRADECIMIENTOS En primer lugar, agradecer a mi director de proyecto Javier la posibilidad de trabajar en este proyecto que me ha aportado mucho tanto en lo académico como en lo personal. Durante la realización de mi trabajo, he de agradecer a mi supervisor Sergio toda su paciencia y apoyo continuo desde el primer día. Además, agradecer a Jesús por todo su tiempo y desearle mucha suerte en su futuro como doctorando. Quiero agradecer también el apoyo recibido por la gente que he conocido en mi Séneca y que ha estado muy cerca de mí este año, especialmente a Celia, Pedro, Laura, Pepe, María, Sandra y Joaquín, sin los cuales este último año de mis estudios de ingeniería no se hubiese convertido en uno de los mejores. Por último y lo más importante, agradecer el calor durante todos estos años de mi familia. Especialmente a mi tía María Elena, a mi tío Quique al cual considero un padre, a la persona que me ha ayudado a alcanzar lo que soy hoy, mi madre. -

Afganistan 2014 – Rok Zwycięstwa Czy Rok Porażki? Doświadczenia Dla Przyszłości
Afganistan 2014 – rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP PRACOWNIA KOORDYNACJI BADAŃ I DYDAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AFGANISTAN 2014 – rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości redakcja naukowa: Artur Drzewicki Grzegorz Rdzanek Wrocław 2015 Redakcja naukowa: Dr Artur Drzewicki Dr Grzegorz Rdzanek Recenzja: dr hab. prof. nadzw. Jan Maciejewski Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Skład, projekt graficzny okładki: Marta Rydz Zdjęcia wykorzystane na okładce: Mariusz Wojtan Publikację wydano ze środków Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. ISBN: 978-83-7798-163-4 Wydawca: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Koszarowa 3/21, 51–149 Wrocław © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Nakład: 150 egz. Realizacja wydawnicza: BEL Studio Sp. z o.o. 00–355 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 67b tel./fax (0-22) 665 92 22 e-mail: [email protected] www.bel.com.pl księgarnia: http://www.iknt.edu.pl/ Spis tReśCI Od redakcji 7 ASPEKTY POLITYCZNE Mariusz Wojtan Wybrane uwarunkowania wyborów prezydenckich w Afganistanie 2014 roku 13 Jerzy Dereń Afganistan: ofiara geopolitycznych gier czy wojownik etnicznych wojen 39 Piotr Pietrakowski Polityczno-militarna i gospodarcza sytuacja w Islamskiej Republice Afganistanu po 12 latach budowania stabilizacji 79 ASPEKTY MILITARNE Grzegorz Rdzanek Udział wojska polskiego -

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2015/3 Pp
− Dr. Békési Bertold (PhD) Bertold Békési Dr. (PhD) alezredes, egyetemi docens Lieutenant Colonel, Associate Professor Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Faculty of Military Science and Officer Training Katonai Repülő Intézet Institute of Military Aviation Fedélzeti Rendszerek Tanszék Department of Aircraft Onboard Systems [email protected] [email protected] orcid.org/0000-0002-5709-789X orcid.org/0000-0002-5709-789X Dobi Sándor Gábor Sándor Gábor Dobi junior kutatás-fejlesztési szakértő Junior Research and Development Specialist HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Üzletfejlesztési Igazgatóság Business Development Directorate Szakmai Fejlesztési Osztály Research, Development and Simulation Department Kutatás Fejlesztési Csoport Research and Development Unit [email protected] [email protected] orcid.org/0000-0001-6093-7805 orcid.org/0000-0001-6093-7805 Domán László őrnagy, Major László Domán főtechnológus (osztályvezető helyettes) chief technologist (Deputy Head of Dep.) Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem Hungarian Defence Forces Aircraft Repair Plant Műszaki Fejlesztési és Technológiai Osztály Technical Development and Technological Department [email protected] [email protected] orcid.org/0000-0002-4472-2609 orcid.org/0000-0002-4472-2609 Horváth Krisztina Horváth Krisztina kutatás-fejlesztési csoportvezető Head of Research and Development Unit HungaroControl -

Ta[ T.0, 13520 DATE, JI+D167dzt?
uilLtsstFtr0 BY At/l|0tl tA[ t.0, 13520 DATE, JI+d167DZt? TPPROVEO FOR P|JBL II REI.EA$E THE AIR FORCE AND THT NATIONAL GUIDED MISSILE PNOffi 1944-1950 (u) By Max Roeenberg June L964 , . USAI' Hietorical Divieion Liaiaon Office sno-c-54/38 If-hen this study is no ronger need.ed, please return it to the usAF Historical Division Liaison office, Headquar;; uiar. SECURITY NOTICE Classification This document ig claseified CONFIDENTIAL in accordance with paragraph Z-5, AFR 205-1. @ This document contains information affecting the National Defense of the United States, within the rneaning of the Espion- age Laws (Title 18, U. S. C.,. sections 793 and 7941, the trans- mission or revelation of which in any Inanner to an unauthorized person is prohibited by law. Individual portions of the docurnent may be reproduced to satisfy official needs of agencies within the United States Air Force, but the document may not be reproduced in ite entirety without permission of the office of origin. Release of portions or the whole of the docurnent to agencies outside the United States Air Force is forbidden without permission of the office of origin. EXCLUDED FROM AUTOMATIC DOWNGRADING : DOD Dir 5200. tO DOES NOT APPLY **x: tG,) 1'\ \r1 ,83,, , \\* \ \:'c *--: x\/r.ut- hw rr"*^^ ra #s_:'=:_ FOREWORD This historical monograph was originally planned as part of a multi-volume hietory of the USAF guided miesile program. However, Personnel, organizatlonaL, and program realignments within the USAr Historical Division Liaison Office (AFCHO) forced abandonment of these plans. Consequently, the ecope of the study ie not that initially contern: plated but its content seemed of eufficient intereet to warrant publication. -

Unmanned Aircraft System (UAS) Service Demand 2015 - 2035 Literature Review & Projections of Future Usage
Unmanned Aircraft System (UAS) Service Demand 2015 - 2035 Literature Review & Projections of Future Usage Technical Report, Version 0.1 — September 2013 DOT-VNTSC-DoD-13-01 Prepared for: United States Air Force Aerospace Management Systems Division, Air Traffic Systems Branch (AFLCMC/HBAG) Hanscom AFB, Bedford, MA Notice This document is disseminated under the sponsorship of the Department of Defense in the interest of information exchange. The United States Government assumes no liability for the contents or use thereof. The United States Government does not endorse products or manufacturers. Trade or manufacturers’ names appear herein solely because they are considered essential to the objective of this report. Cover Page photo source: United States Air Force (www.af.mil) REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188), Washington, DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED September 2013 Initial Technical Report 4. TITLE AND SUBTITLE 5a. FUNDING NUMBERS Unmanned Aircraft System (UAS) Service Demand 2015-2035: Literature Review and Projections of VHD2 Future Usage, Version 0.1 6.