Urfttalsperre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
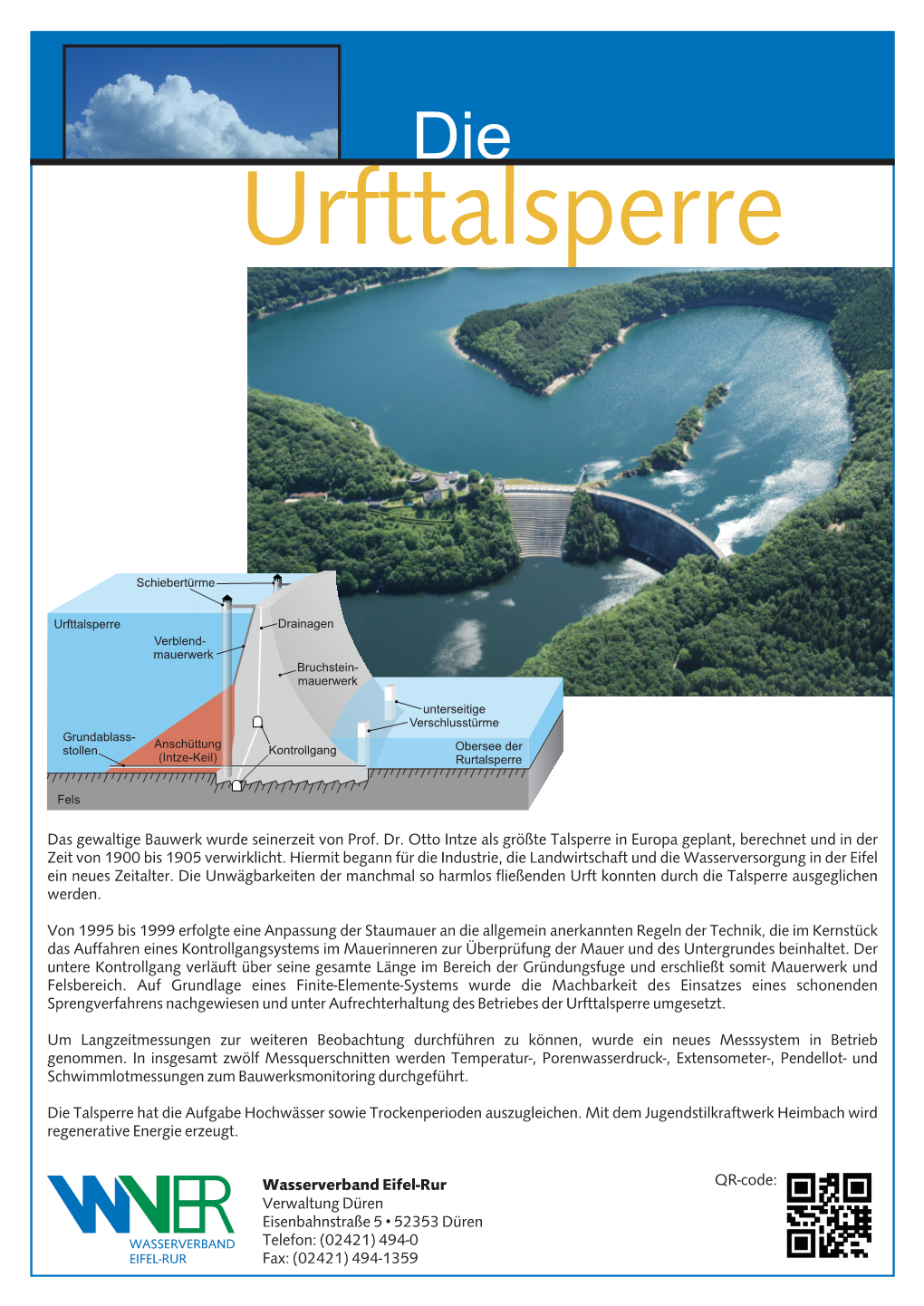
Load more
Recommended publications
-

Of Water Resources in the Eifel-Rur Region
Dezernat IV UB Gewässer IUSF-TIAS Autumn School 2015 The management and governance of water resources in the Eifel-Rur region Antje Goedeking 1 Wasserverband Eifel-Rur Dezernat IV UB Gewässer Where we are 2 Dezernat IV UB Gewässer Where we are 3 Dezernat IV UB Gewässer Where we are 4 Dezernat IV UB Gewässer Where we are 5 Dezernat IV UB Gewässer Where we are The Netherlands Belgium 6 Dezernat IV UB Gewässer Where we are The Netherlands Belgium 7 Dezernat IV UB Gewässer Where we are The Netherlands Belgium 8 Dezernat IV UB Gewässer Where we are The Netherlands the Ruhr Belgium Rur catchment 9 Dezernat IV UB Gewässer Who we are Organisation and duties German Watermanagement Germany Water- and Shipping Authotity Ministery of Environment (Ministery of Transport) Waterframework-law 16 federal states exchanging in the 16 federal states LAWA e.g. Northrhine-Westfalia (Länderarbeits- gemeinschaft Each with its own water law Wasser) 10 Dezernat IV UB Gewässer Who we are Organisation and duties Northrine-Westfalian Watermanagement Min. Environment (MKULNV) (Highest Water Authority) Department No. IV Safety of Soil & Water Water - und Wastemanagement Environmental 5 administrative Districts Agency NRW (Higher Water Authority) Dezernat No. 54 Water Management 31 Counties operation permits/supervision 10 Waterboards (Lower Water Authority) each on own law Municipalities (e.g. WVER) 11 Dezernat IV UB Gewässer Creation of Special law of the federal state the Water Board North Rhine-Westphalia from the year 1990 Start of activities 1st January 1993 Legal form The Water Board is a corporate body under public law 12 Dezernat IV UB Gewässer Administrative Headquarters 13 Dezernat IV UB Gewässer Assembly Supervisory board Chief Executive Officer Division Water Bodies Staff units Division Division Operation of Waste Administration Water Plants and Financing Division Manpower 14 Dezernat IV UB Gewässer Assembly Supervisory board Members who pay the work Chief Executive Officer Employees who do the work Division (approx. -

Zur Ermittlung Von Hydrologischen Bemessungsgrößen an Flussmündungen Mit Verfahren Der Multivariaten Statistik
Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen Jens Bender Zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungs- größen an Flussmündungen mit Verfahren der multivariaten Statistik Heft 9 ISSN 1868-6613 2015 Jens Bender Zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen an Flussmündungen mit Verfahren der multivariaten Statistik Erscheinungsort: Siegen Erscheinungsjahr: 2015 D 467 Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen Heft 9 | 2015 Herausgeber: Forschungsinstitut Wasser und Umwelt (fwu) der Universität Siegen Paul-Bonatz-Str. 9-11 57076 Siegen Druck: UniPrint, Universität Siegen ISSN 1868-6613 Vorwort Mit der ersten Promotion am Forschungsinstitut Wasser und Umwelt (fwu) im Jahr 2009 wurde eine eigene fwu-Schriftenreihe etabliert. Neben den Promotionen am fwu werden in dieser Schriftenreihe die Ergebnisse von Institutsveranstaltungen, Konferenzen und Work- shops sowie andere Forschungsergebnisse, die im Kontext des fwu erarbeitet werden, veröf- fentlicht. Bis dahin wurden die Forschungsergebnisse in verschiedenen internen und externen Schriftenreihen publiziert. Eine Übersicht der bisher veröffentlichten Schriftenreihen kann der letzten Seite entnommen werden. In dem vorliegenden Heft 9 (2015) wird die Promotion von Herrn Jens Bender mit dem Titel „Zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen an Flussmündungen mit Verfahren der multivariaten Statistik” in Papierform veröffentlicht; die digitale Veröffentlichung erfolgte im Oktober 2015 über die Universitätsbibliothek Siegen. Herr Jens Bender hat die Dissertati- on als Monografie in deutscher Sprache verfasst. Inhalte der Dissertationsschrift wurden pa- rallel auch in begutachteten Beiträgen in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Für die Bemessung von Hochwasserschutzbauwerken im Bereich von Flussmündungen, d. h. dem Zusammenfluss von Haupt- und Nebengewässer, können die gängigen Bemessungsan- sätze nicht angewendet werden, da die Abflüsse aus beiden Gewässern Berücksichtigung fin- den müssen. -

Die Radroute Im April Und Mai Findet All- Die Schlosskirche, Pfarrkirche Die Abwechslungsreiche Radroute, Insgesamt Rd
1 Narzissenwiesen im Oleftal 6 Schlosskirche Schleiden Die Radroute Im April und Mai findet all- Die Schlosskirche, Pfarrkirche Die abwechslungsreiche Radroute, insgesamt rd. jährlich in den Wiesentälern der katholischen Gemeinde 50 km, verläuft von Hellenthal über Schleiden- des oberen Oleftales ein Schleiden, wurde 1516 bis 1525 Gemünd bis Nettersheim entlang der Täler von einmaliges Naturschauspiel als dreischiffige spätgotische Olef und Urft. Gute Fahrradwege mit weitgehend statt: Die wildwachsenden Hallenkirche nach Plänen von geringen Steigungen bieten ein angenehmes "Gelben Narzissen" recken Johann Vianden aus Kyllburg Raderlebnis. Der kurze Anstieg nach Kall-Steinfeld sich millionenfach der Früh- errichtet (Info: 02444-2011). wird belohnt mit dem An- und Einblick auf und in lingssonne entgegen und die einzigartige Eifelbasilika am Kloster Steinfeld. verwandeln die Wiesen in Die Radroute entlang von Urft und Olef folgt weit- gelbe Blütenteppiche. gehend der Tälerroute und auf der Teilstrecke Während der Blütezeit wer- Nettersheim - Hellenthal der Naturparkroute, die in den regelmäßig Führungen 7 Freibad "Dieffenbachtal" der Radwegeausschilderung gekennzeichnet sind. angeboten (Info: 02482- Das neue beheizte Freibad in Schleiden bietet eine abwechs- 85115). lungsreiche Abkühlung und viele Attraktionen wie Strömungs- kanal, Breitdusche, Spitzdusche, Whirlliege, Wasserpilz, Teilstrecke Hellenthal – Gemünd (13 km) 2 Geologisch-Montanhistorischer Wanderpfad Massagedüsen, Bodenblubber und Riesenwasserrutsche (Info: Von Hellenthal geht -

Die Eifel an Rur, Kall Und Urft Erradeln!
2012 | Freizeit Tour 1 Die Eifel Tickets und Preise Fahrplan – sonn- und feiertags vom 6.4. bis 21.10.2012 Veranstaltungskalender Über das Venn zum Eupener Stausee Auch für Fahrten mit dem Fahrradbus gilt der AVV-Tarif. Für Haltestelle Hinfahrt Rückfahrt Landschaftserlebnis im Osthertogenwald Folgende Veranstaltungs-Tipps erreichen Sie bequem mit den angegebenen an Rur, Kall und Urft erradeln! Eifel Tourismus GmbH Tourismus Eifel Ihren Tagesausflug stellen wir Ihnen einige attraktive Tickets Touren. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf 2 www.eifel.de © Aachen Bushof (H. 5) 8:00 9:13 9:20 18:16 18:40 19:15 vor – egal ob Sie alleine oder als Gruppe unterwegs sind. Bahnhof Rothe Erde - 9:28 - - 18:31 - Brand - 9:42 - - 18:14 - Länge: 38 km • Fahrzeit: 4,5 Stunden 15.04. - 21.10. Kutschfahrt über die Dreiborner Hochfläche Sie wollten schon immer mal durchs Rurtal oder das Hohe Venn radeln, im Je Fahrrad ist entfernungsunabhängig ein Fahrrad-Ticket zu lösen: Eine Ein- Kornelimünster - 9:51 - - 18:08 - Start: Haltestelle Roetgen Post • Ziel: Haltestelle Roetgen Post (jeden 1. und 3. Sonntag ab Vogelsang) Tour 3 4 Nationalpark Eifel in die Pedale treten, fanden die Anfahrt aber bisher zu zelfahrt kostet 2,00 Euro, ein 4Fahrten-Ticket 8,00 Euro; ein Ticket für beliebig Walheim - 9:55 - - 18:03 - Kondition: Bis Lammersdorf leichter stetiger Anstieg auf der Vennbahntrasse 22.04. Tag der CRIE im Haus Ternell Tour 1 7 Aachen Hauptbahnhof 8:14 - 9:39 18:07 - 19:06 Mit dem Fahrradbus beschwerlich? Dann ist der Fahrradbus genau das richtige Angebot für Sie! viele Fahrten an einem Tag erhalten Sie für 3,00 Euro. -
Aeb E Sep 2020 NAEI62 Aeb06 Offen.Qxd 15.05.2020 14:38 Seite 2 Seite 14:38 15.05.2020 2020 NAEI62 Aeb06 Offen.Qxd Aeb E Sep
5 4 3 2 more information, please see table). table). see please information, more forests for rearing its young. In total, approximately 1,000 wildcats live live wildcats 1,000 approximately total, In young. its rearing for forests ride through expansive landscapes in a horse-drawn carriage (for (for carriage horse-drawn a in landscapes expansive through ride wise benefits from the National Park. It makes use of the continuous continuous the of use makes It Park. National the from benefits wise www.nationalpark-eifel.de www.nationalpark-eifel.de born Plateau, from April to the end of October it is also possible to to possible also is it October of end the to April from Plateau, born The rare wildcat, almost exterminated during the 19th century, like- century, 19th the during exterminated almost wildcat, rare The For additional information, please see the website: website: the see please information, additional For ger tour to the deserted village of Wollseifen and back. On the Drei- the On back. and Wollseifen of village deserted the to tour ger diversity and exceptional scenery. scenery. exceptional and diversity and the Urftsee reservoir. In addition, every Sunday there is a free ran- free a is there Sunday every addition, In reservoir. Urftsee the and flowers protected by the Park. Park. the by protected flowers develop in the Eifel National Park, which is already fascinating in its its in fascinating already is which Park, National Eifel the in develop Your Eifel National Park Administration Administration Park National Eifel Your where you can enjoy a unique view of the National Park landscape landscape Park National the of view unique a enjoy can you where St Bernhard’s lily, bog bean and perennial honesty are other valuable valuable other are honesty perennial and bean bog lily, Bernhard’s St natural dominance. -

Pressemitteilung Wasserverband Eifel-Rur Beantwortet Fragen Rund Um Das Corona-Virus Und Das Wasser
Körperschaft des öffentlichen Rechts Wasserverband Eifel-Rur Postfach 10 25 64 52325 Düren Kommunikation Auskunft erteilt: Marcus Seiler Verwaltungsgebäude: Eisenbahnstraße 5 - mit der Bitte um Veröffentlichung - 52353 Düren Telefon: 02421 494 - 1541 Telefax: 02421 494 - 1542 E-Mail: [email protected] Internet: www.wver.de Pressemitteilung Datum: 07.04.2020 Wasserverband Eifel-Rur beantwortet Fragen rund um das Corona-Virus und das Wasser Wegen des Corona-Virus fühlen sich viele Menschen verunsichert und haben auch Fragen, die sich auf das Wasser beziehen: Kann man sich über Trinkwasser oder Abwasser infizieren? Werden auch in der Krisenzeit die Versorgung mit Trinkwasser und die Reinigung von Abwasser gesichert bleiben? Werden Industrie und Gewerbe weiter mit ausreichend Wasser versorgt sein? Diese Fragen erreichen auch den Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Er ist im Einzugsgebiet der Rur (einschließlich von Nebenflüssen wie der Olef, der Urft, der Inde und der Wurm) unter anderem zuständig für die Abwasserreinigung, die Belieferung der Trinkwasserversorgungsunter- nehmen mit Rohwasser aus den Talsperren des WVER und die Versorgung der Industrie mit Betriebswasser sowie Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Der Wasserverband bietet auf seiner Internet-Homepage www.wver.de eine Vielzahl von Antworten auf Fragen, die die Menschen bezüglich des Wassers im Moment bewegen. Bürger*innen können ihre Fragen und Verbandsrat: Paul Larue, Vorsitzender ● Vorstand: Dr.-Ing. Joachim Reichert Sparkasse Düren Commerzbank Aachen Deutsche Bank Düren BIC: SDUEDE33XXX BIC: DRESDEFF390 BIC: DEUTDEDK395 IBAN: DE66 3955 0110 0000 1690 60 IBAN: DE02 3908 0005 0250 4200 00 IBAN: DE50 3957 0061 0811 1189 00 Anregungen aber auch direkt an den Verband schicken. Er hat dazu die Mailadresse [email protected] eingerichtet. -
VOGELSANG IP INTERNATIONAL PLACE in the EIFEL NATIONAL PARK at a GLANCE January 2017 Please find an Orientation Map for Vogelsang IP at the End of the Booklet
VOGELSANG IP INTERNATIONAL PLACE IN THE EIFEL NATIONAL PARK AT A GLANCE January 2017 Please find an orientation map for Vogelsang IP at the end of the booklet. Please find a map showing the historic buildings on page 17. Please find a a hiking map for the Eifel National Park with suggestions for walks around Vogelsang IP in the middle of the booklet. Please find an overview of the offers provided by the Vogelsang IP International Place on the internal flap. The impressions that people take away from Vogelsang IP are as diverse as the visitors themselves. Contemplation, amazement, discoveries, enthusiasm or simply relaxation... everything has its place here. A warm welcome to the Vogelsang International Place in the Eifel National Park! AN OVERVIEW OF THE OFFERS Ascent of the tower and panoramic view of Vogelsang IP NS documentation | individual site tour NS documentation | open guided site tours NS documentation | Permanent exhibition “Destiny: Master Race. ...” NS documentation | Guided exhibition tours “Destiny: Master Race. ...” NS documentation | Group offers (basic tours, special tours) Vogelsang IP Academy | Historico-cultural guided tour of Wollseifen Vogelsang IP Academy | Guided site tour “Belgian period” Vogelsang IP Academy | Political and cultural youth and adult education Vogelsang IP Academy | Special events for political and cultural education National Park Centre | Permanent exhibition “Wilderness Dreams” National Park Centre | Guided exploration tour through the exhibition National Park Centre | Group offers (guided tours, -

Schleiden" Umweltbericht
Kreis Euskirchen – Der Landrat LANDSCHAFTSPLAN "Schleiden" Umweltbericht LANDSCHAFTSPLAN 36a “SCHLEIDEN“ Umweltbericht im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung gemäß § 14 UVPG Stand: Januar 2009 Kreis Euskirchen, Abt. 60 – Umwelt und Planung Dipl.-Ing. Kirsten Kröger Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen Tel. 02251-15-579, Fax 02251-15-654, Email: [email protected] Dipl.-Ing. (FH) Alexander Oeliger Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen Tel. 02251-15-583, Fax 02251-15-654, Email: [email protected] ____________________________________________________________________________ Stand: Januar 2009 Kreis Euskirchen – Der Landrat LANDSCHAFTSPLAN "Schleiden" Umweltbericht ____________________________________________________________________________ Stand: Januar 2009 Kreis Euskirchen – Der Landrat LANDSCHAFTSPLAN "Schleiden" Umweltbericht Inhaltsverzeichnis 0 Einleitung ..............................................................................................................3 1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms sowie die Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen .........................................................................................................3 2 Darstellung der für den Plan oder das Programm geltenden Ziele des Umweltschutzes sowie die Art, wie diese Ziele und sonstige Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder des Programms berücksichtigt wurden............................................................................................7 -

IKEK Schleiden.De
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGS KONZEPT IKEKSCHLEIDEN BERESCHEID · BROICH · BRONSFELD · DREIBORN · ETTELSCHEID · GEMÜND · HARPERSCHEID · HERHAHN · KERPERSCHEID · MORSBACH · NIERFELD · OBERHAUSEN · OLEF · SCHEUREN · SCHLEIDEN · SCHÖNESEIFFEN · WINTZEN · WOLFGARTEN INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT STADT SCHLEIDEN IMPRESSUM Stadt Schleiden Bürgermeister Udo Meister Blankenheimer Straße 2 53937 Schleiden Ansprechpartner Stadt Schleiden Andreas Glodowski E-Mail: [email protected] www.schleiden.de BEARBEITUNG Susanne Neumann, neuland+ neuland+ Tourismus-, Standort- und Regionalentwicklung GmbH & Co KG Regionalbüro Nordrhein-Westfalen, Ober dem Hofe 18, 51515 Kürten E-Mail: [email protected] www.neulandplus.de Christine Loth Loth Städtebau + Stadtentwicklung Marburger Tor 4-5, 57072 Siegen E-Mail: [email protected] www.loth-stadtentwicklung.de In Zusammenarbeit mit der von der Stadt Schleiden berufenen Steuerungs gruppe, deren Mitglieder waren: Herr Bürgermeister Udo Meister Herr Klaus Ranglack (UWG-Ratsmitglied) Frau Sophia Eckerle (Stabstelle Tourismus und Kultur) Herr Wolfgang Laukart (CDU-Ratsmitglied) Herr Andreas Glodowski (Stabstelle Stadtentwicklung) Herr Norbert Müller (FDP-Ratsmitglied) Herr Hubert Linscheidt (CDU-Ratsmitglied) Frau Bettina Wagner (SPD-Ratsmitglied) Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete Gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ANMERKUNG 1) Im Konzept wird überwiegend -

Wandererlebnis Eifel
3 ODER 4 TAGE WANDERN OHNE GEPÄCK AUF DEM EIFELSTEIG & SEINEN PARTNERWEGEN Buchen Sie jetzt unser Wanderpaket mit folgenden Leistungen: > 3 oder 4 Übernachtungen mit Frühstück bei einem wanderfreundlichen Gastgeber > Gepäcktransfer > Wanderkarte Einzelzimmer, Halbpension, Lunchpaket und Zusatzübernachtungen optional zubuchbar. > ab 185 EUR pro Person im Doppelzimmer DETAILLIERTE INFOS www.natuerlich-eifel.de PERSÖNLICHE BERATUNG & BUCHUNG WANDERERLEBNIS EIFEL 18 Touren Tourist-Info im Nationalpark-Tor Gemünd Schleidener Tal und auf der Höhe Kurhausstraße 6 53937 Schleiden/Eifel Telefon +49 (0) 2444 2011 Fax +49 (0) 2444 1641 [email protected] #natuerlicheifel ÜBERSICHTSKARTE RUNDWANDERWEGE WANDERKARTE DREIBORNER HOCHFLÄCHE TIPPS Alle Wandertourentipps fi nden Sie auch on- In der Tourist-Information im Nationalpark-Tor line auf unserer Website inkl. GPS-Daten zum Gemünd erhalten Sie eine Auswahl an Wan- Download. Einfach QR-Code scannen, Wan- derkarten der Region, die vom Eifelverein he- dertour auswählen und loswandern! rausgegeben werden. INHALTSVERZEICHNIS Herzlich willkommen.................................................................................................. 2 Legende.............................................................................................................................. 3 Wanderleitsystem (D/EN/F/NL) ............................................................................ 4 - 8 Wanderwegemanagement (D/EN/F/NL) ........................................................ 9 SOS-Rettungspunkte -

Eifel-Rur: Old Water Rights and Fixed Frameworks for Action R
Eifel-Rur: Old Water Rights and Fixed Frameworks for Action R. Vidaurre, U. Stein, A. Browne, M. Lordkipanidze, C. Furusho, A. Goedeking, H. Polczyk, C. Homann To cite this version: R. Vidaurre, U. Stein, A. Browne, M. Lordkipanidze, C. Furusho, et al.. Eifel-Rur: Old Water Rights and Fixed Frameworks for Action. Governance for Drought Resilience - Land and Water Drought Management in Europe, Springer, pp.67-82, 2016, 978-3-319-29669-2. 10.1007/978-3-319-29671-5_4. hal-01362657 HAL Id: hal-01362657 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01362657 Submitted on 9 Sep 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Chapter 4 Eifel-Rur: Old Water Rights and Fixed Frameworks for Action Rodrigo Vidaurre, Ulf Stein, Alison Browne, Maia Lordkipanidze, Carina Furusho, Antje Goedeking, Herbert Polczyk and Christof Homann 4.1 Introduction This chapter summarises our analysis of drought governance in the Eifel-Rur region of Germany. Within the Interreg IV-B project DROP a team of researchers from five universities and knowledge institutes performed two field visits to the Eifel-Rur region and held interviews with authorities and stakeholders. -

Oleftalsperre
Die Oleftalsperre 5,50 m Die Staumauer der Oleftalsperre wurde in den Jahren Erstausbau 466,90 1955-1959 errichtet - bestehend aus insgesamt 16 465,50 (Vollstau) 1.Verstärkung der Pfeilerzellen, die jede für sich eine statische Einheit Pfeilerscheiben bilden und nur durch je zwei Dichtungselemente aus Vorsatzschale 2.Verstärkung Kupferblech und Kunstkautschuk miteinander verbunden sind. Höhenangaben in mNN Schon beginnend während der Bauphase und in der NHN-Höhe = NN-Höhe + 0,032 m weiteren zeitlichen Entwicklung traten nach und nach Risse in den Pfeilerscheiben auf. Die Ursache dieser Risse waren Zwängungskräfte zwischen dem Gründungsfels und dem Fundamentbeton. Aus 1:0,61 diesem Grund wurden in den Jahren 1962-1965 (1. 59,40 m 1:0,39 Verstärkung) die Hohlpfeilerwände innen rundum durch Stahlbeton verstärkt. Etwa 10 Jahre später wurden Haarrisse am Absperr- ZugbalkenFertigteile bauwerk festgestellt. Rissursache waren zu hohe Zugspannungen, die auf die ständig schwankenden Druckbalken Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen zurückzuführen sind. Daher erfolgte in den Jahren 1982-1985 durch das Aufbringen einer wasser - 407,50 seitigen Vorsatzschale und den Einbau vorgespannter 56,50 m Druck- und Zugbalken innerhalb der Hohlzellen eine 2. Verstärkung des Absperrbauwerks. Die Talsperre hat die Aufgabe Hochwässer sowie Trockenperioden auszugleichen und versorgt im südwestlichen Teilgebiet des Kreises Euskirchen und im Großraum Aachen die Trinkwasserversorgungsunternehmen. Das angegliederte Wasserkraftwerk erzeugt mit umweltschonenden